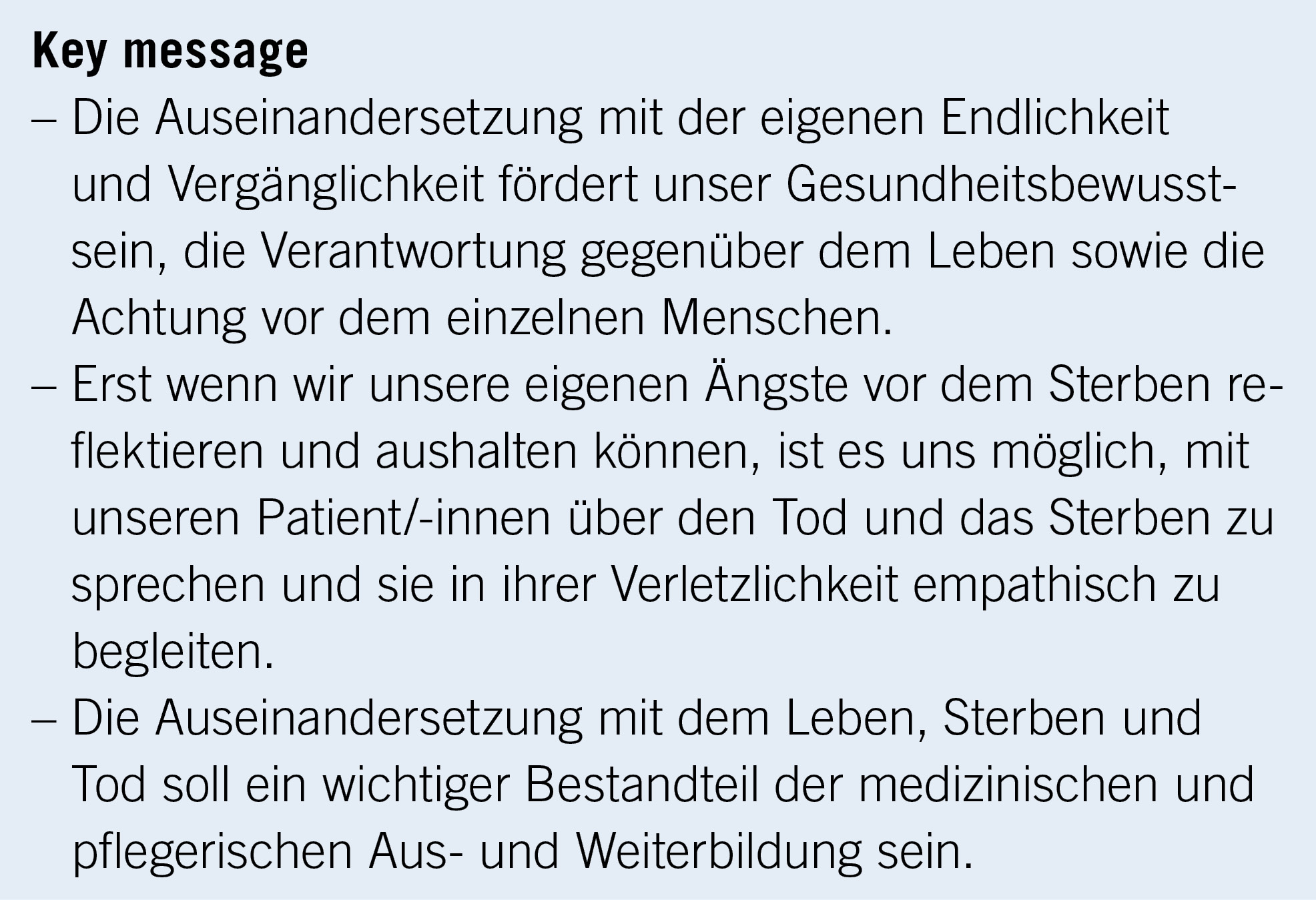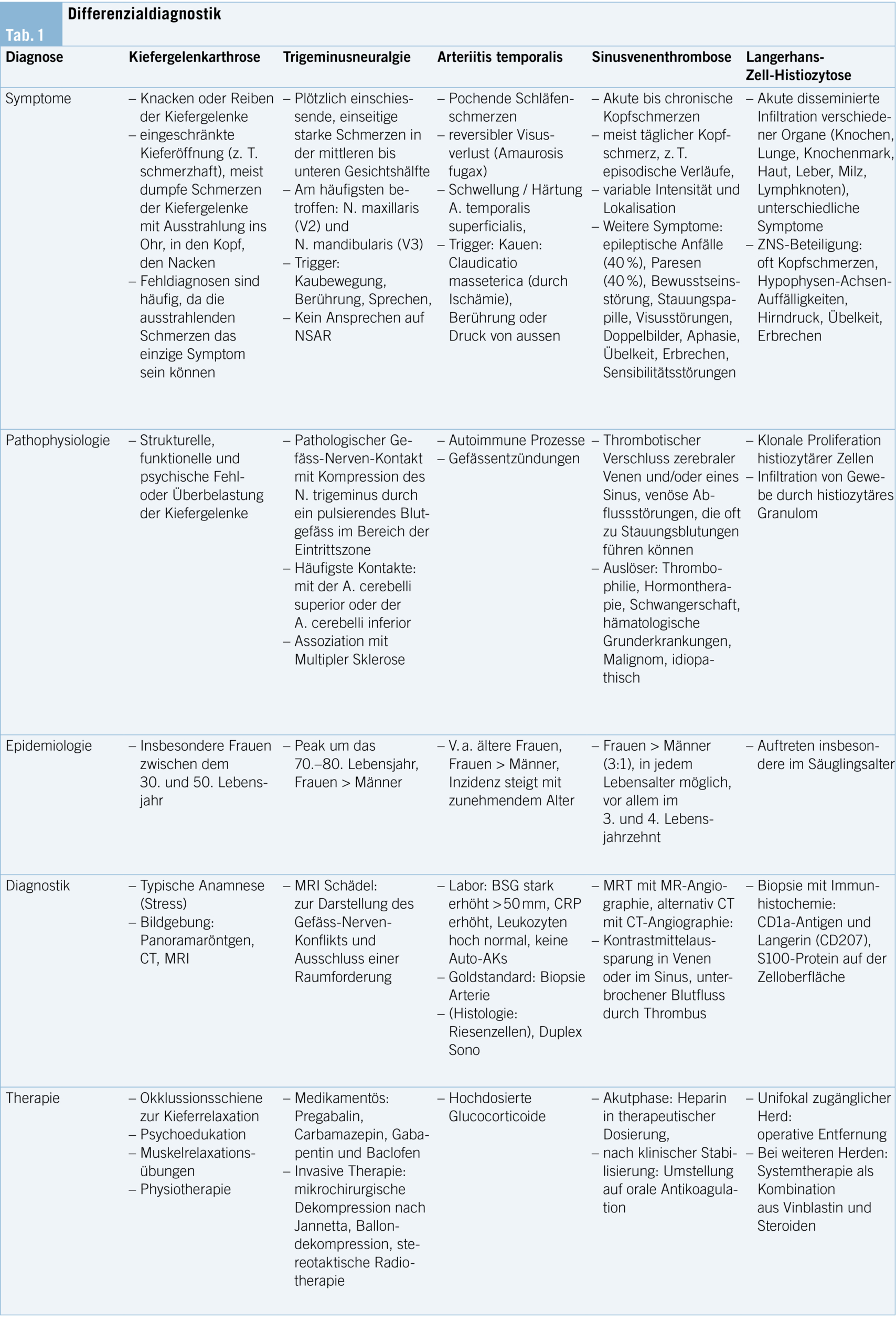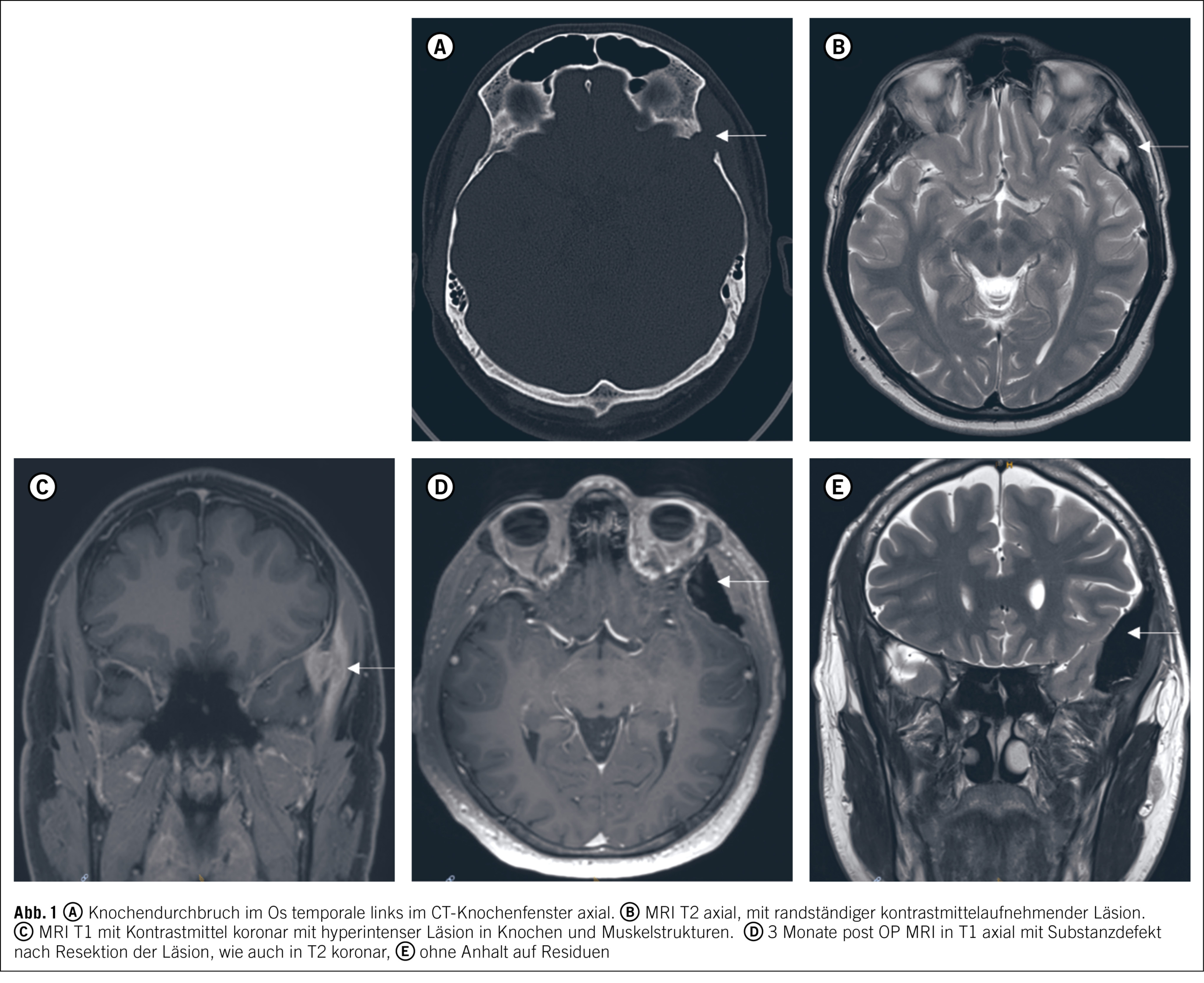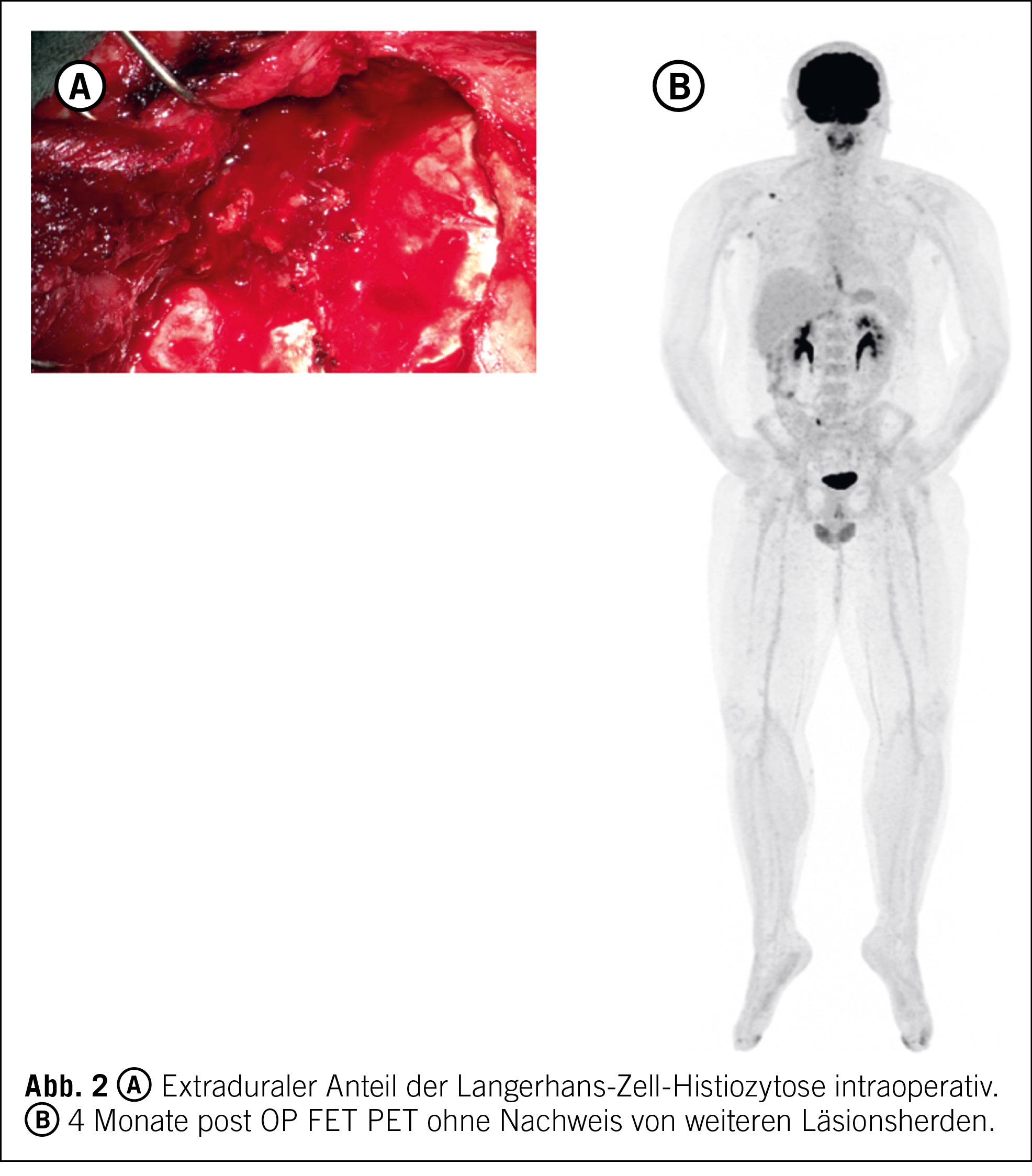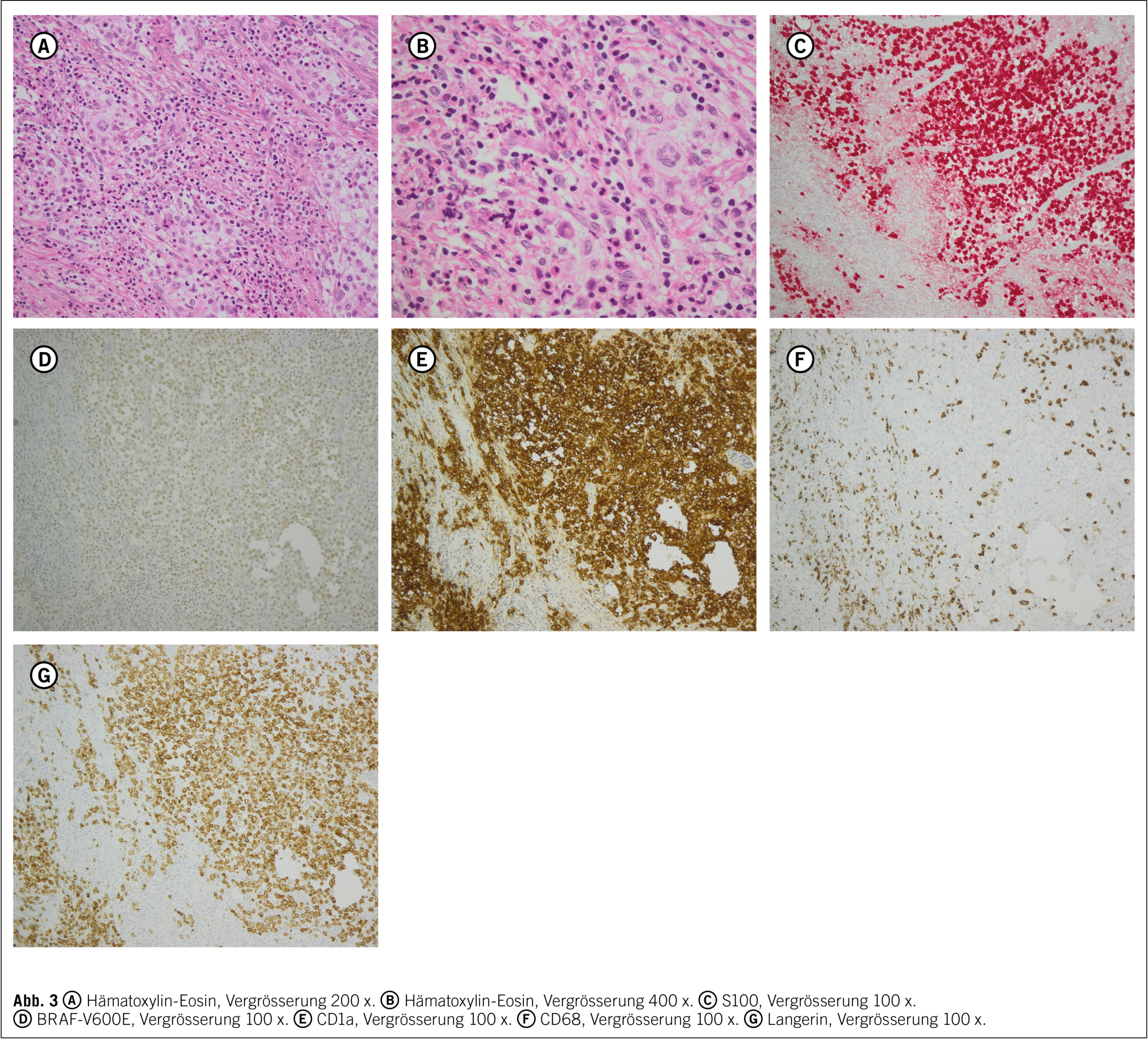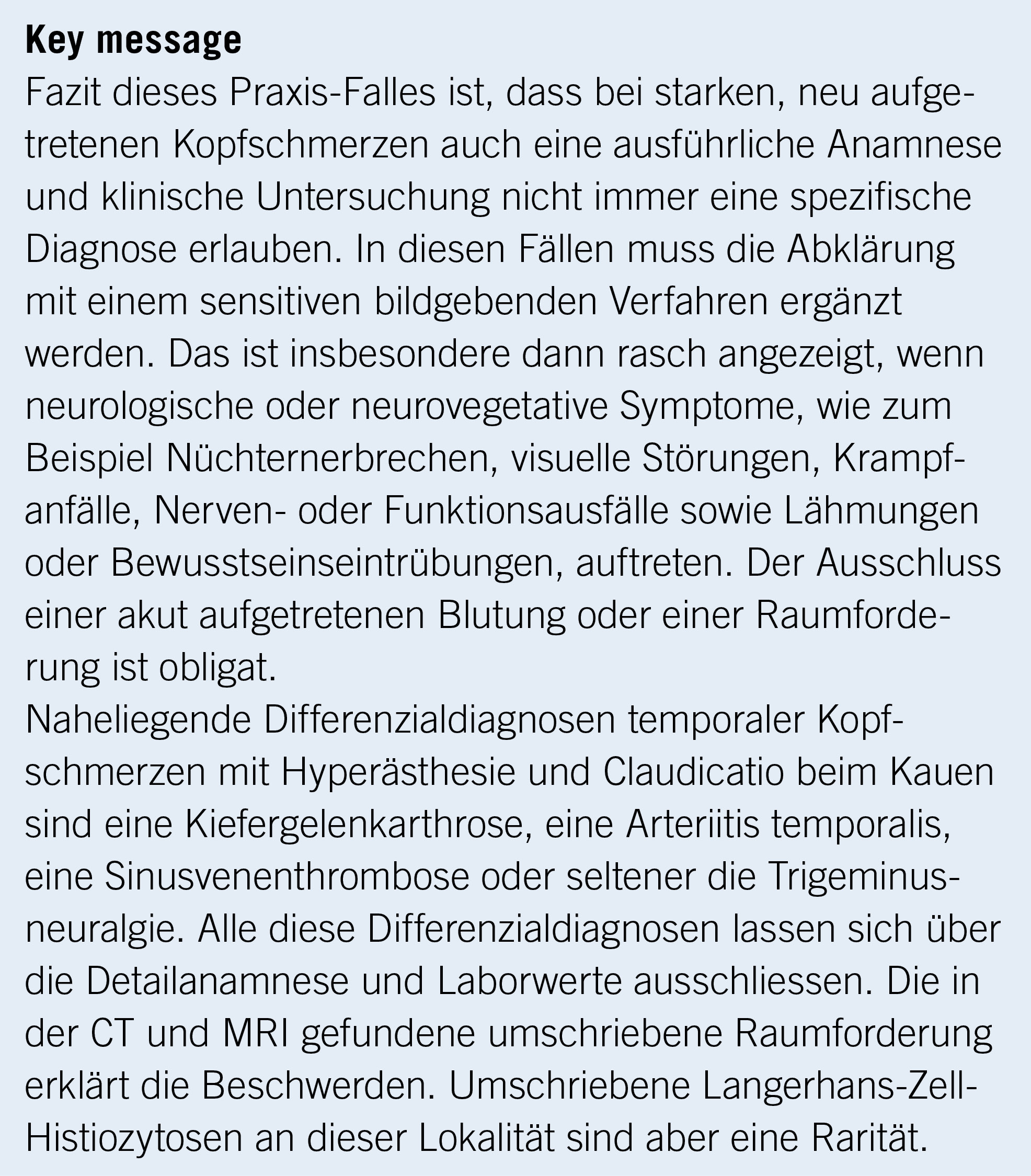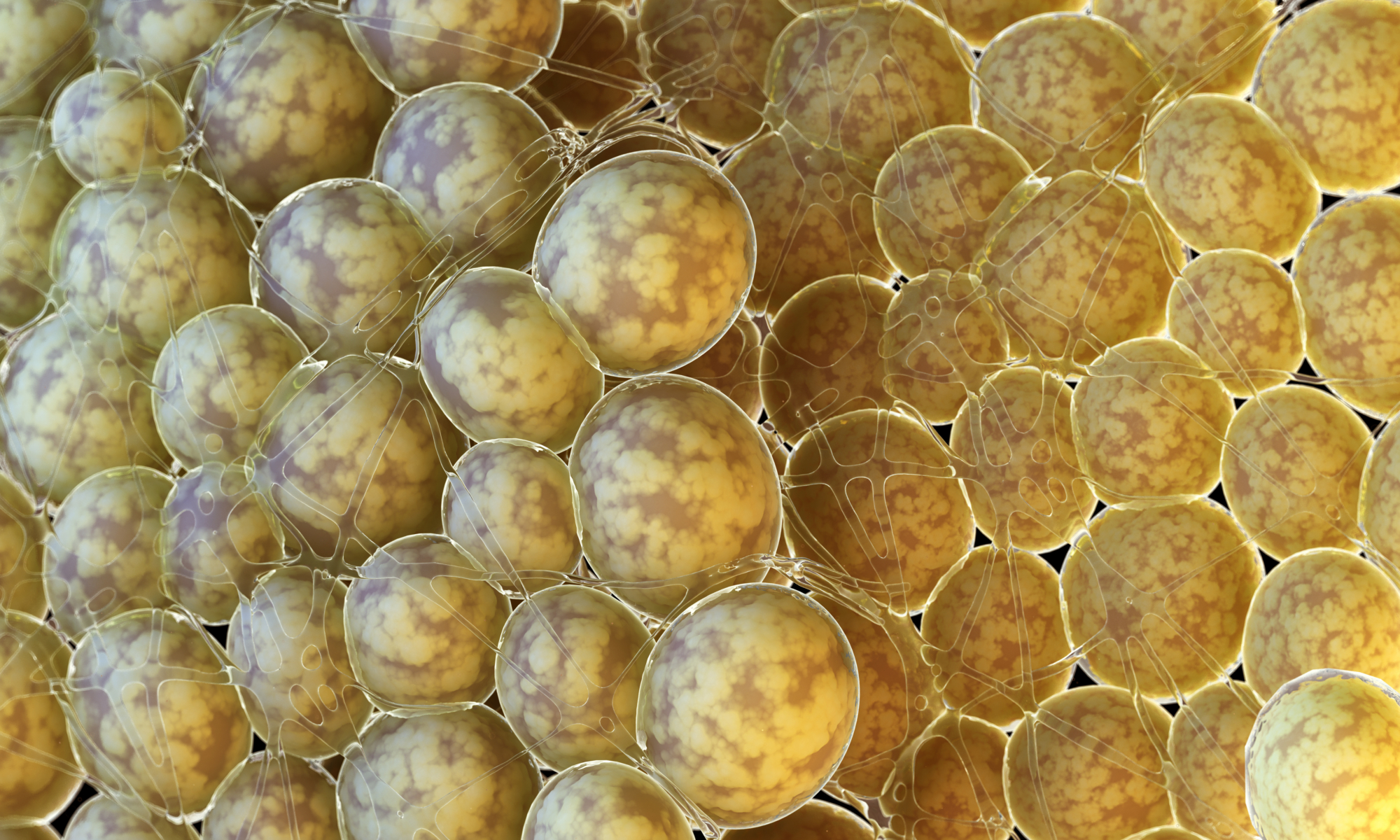Oberflächliche Venenthrombose (OVT)
Man unterscheidet OVT in primär gesunden Venen (Thrombophlebitis) und varikös-veränderten Venen (Varikothrombose). Zu 90 % sind die unteren Extremitäten betroffen, meist auf Grundlage einer Varikosis. Bei OVT einer nicht varikösen Vene muss ursächlich an Systemerkrankungen (z.B. Thromboangiitis obliterans, M. Behçet, Autoimmunerkrankungen) und Tumoren gedacht werden, sofern kein Trigger für einen Endothelschaden ersichtlich ist (Trauma, I.v.-Zugänge etc.).
Da die tatsächliche Ausdehnung des Prozesses oft langstreckiger ist als klinisch oder durch Blickdiagnose erfasst und gemäss POST-Studie (7) in bis zu 30 % gleichzeitig eine asymptomatische TVT und bis 4 % eine LE vorliegen, soll bei V.a. einer OVT der unteren Extremität die Diagnose sonografisch gesichert und eine begleitende TVT ausgeschlossen werden (1, 2). Das Therapieregime richtet sich nach dem Durchmesser der betroffenen Vene, der Gesamtlänge des Thrombus (Schwellenwert 5 cm) sowie dem Abstand zur Mündung ins tiefe Venensystem (mündungsnah definiert als < 3 cm) (1):
– Bei jeder OVT soll eine Kompressionsbehandlung bis zum Abklingen der Symptome erfolgen.
– Bei OVT kleiner Astvarizen sowie OVT < 5 cm Länge mündungsferner Stammvenen (V. saphena magna und parva) steht die Lokaltherapie im Vordergrund mit Kühlung, Kompression, NSAR und Heparinsalbe. Wichtig ist eine fortgesetzte Mobilisation zur Thromboseprophylaxe. Operative Verfahren wie eine Stichinzision oder Venenligatur bei akuter OVT haben keinen Stellenwert mehr und werden auch in gefässchirurgischen Leitlinien nicht mehr empfohlen (3).
– Eine OVT ≥ 5cm Länge grosskalibriger Astvarizen oder in mündungsfernen Stammvenen soll bevorzugt mit Fondaparinux in der Prophylaxedosis von 1 × 2.5 mg/d s.c. behandelt werden. Wichtig ist eine ausreichend lange Therapie über 4–6 Wochen, eine kürzere Dauer (oftmals 1–2 Wochen im klinischen Alltag) hat keine nachhaltige Wirkung und zeigt nach Absetzen thromboembolische Komplikationen gleicher Grössenordnung wie unter Placebo (8). Auf Daten der SURPRISE-Studie (9) basierend kann alternativ eine Behandlung mit Rivaroxaban 1 × 10 mg/d über 45 d Tage erfolgen, das dem Fondaparinux in der VTE-Prävention nicht unterlegen war, jedoch mehr klinisch-relevante, nicht schwere Blutungen zeigte (HR 6.1; 95 %–KI 0.7–50). Für die Indikation OVT besteht für DOAK bislang keine Zulassung, der Patient ist über den Off-Label-Use aufzuklären.
– Eine mündungsnahe OVT wird volltherapeutisch wie eine TVT antikoaguliert.
– Im Fall einer OVT bei Varikosis kann eine endovenöse oder operative Sanierung erwogen werden, um das Risiko für Rezidive und VTEs zu senken. Der Eingriff sollte erst nach Abklingen der Symptome, frühestens
3 Monate nach akuter OVT erfolgen (10).
Schulter-Armvenenthrombose (SAVT)
Die SAVT ist mit 5–7 % nach der TBVT die zweithäufigste Manifestation tiefer Thrombosen. Meistens handelt es sich um sekundäre Thrombosen, die assoziiert mit Risikofaktoren auftreten wie Katheter, Elektroden von Schrittmachern/ICDs, aktiver Tumorerkrankung, Trauma oder einer Überbeanspruchung der Schultermuskulatur (Paget-von-Schroetter-Syndrom, Thrombose par effort). In ca. 20–25 % kommt es zu primären Thrombosen ohne erkennbaren Anlass. Hier muss als anatomisch für eine TVT prädisponierend an ein Thoracic-outlet-Syndrom (TOS) gedacht werden, Ursachen hierfür können eine kostoklavikuläre Enge, Halsrippe, Kallusbildung nach Klavikulafraktur oder Exostosen der 1. Rippe sein.
Als evidenzbasiertes, effizientes Vorgehen wird folgender Diagnosealgorithmus empfohlen (Abb. 1) (1, 5):
– In Analogie zur Abklärung einer TBVT kann zunächst die klinische Wahrscheinlichkeit (KW) für eine SAVT anhand des hierfür validierten Constans-Scores (11) abgeschätzt werden und in Kombination mit einer D-Dimer-Testung helfen, die Notwendigkeit einer weiteren Bildgebung zu klären. Bei einem Score ≤1 liegt eine geringe KW vor (Prävalenz ≤ 10 % in Validierungskohorten). Ergänzt mit dem D-Dimer-Test, schliesst ein negatives Resultat eine TVT aus, bei positivem Test wird sonografisch weiter abgeklärt. Bei einem Score ≥ 2 besteht eine hohe KW (Prävalenz ≥ 40 %), und es sollte direkt eine Sonografie erfolgen.
Dieses Procedere mit Verzicht auf eine Bildgebung bei niedriger KW und normwertigen D-Dimeren zeigte sich nur sicher für nicht hospitalisierte Patienten vor dem 75. Lj., die keine aktive Tumorerkrankung hatten und bei denen der V.a. eine SAVT nicht in zeitlichem Zusammenhang mit venösen Zugangswegen oder intravenösen Sonden auftrat (12). Trifft eines dieser Kriterien zu, wird der Patient ebenfalls einer Hochrisikopopulation zugerechnet und sollte direkt einer Bildgebung zugeführt werden.
– Erschwert wird die Diagnostik durch den Umstand, dass das Thrombosegeschehen am häufigsten die V. subclavia und zentralvenöse Abschnitte betrifft. Durch Kombination des klassischen KUS (distal der V. axillaris) mit einem Farbduplex (beurteilt wird die vollständige Farbcodierung der Venen sowie der atem- und herzzyklusmodulierte Fluss in der V. subclavia im Seitenvergleich) wird eine Sensitivität von 91 % und eine Spezifität von 93 % erreicht. Bei nicht eindeutigem Befund kann man die Untersuchung innert 4–7 Tagen wiederholen oder direkt eine Schnittbildgebung (d.h. CT-, MR-Venografie) durchführen, insbesondere bei ausgeprägter Symptomatik, hoher KW, V.a. ein zentralvenöses Abstromhindernis und/oder bekannter Tumorerkrankung.
– Bei primärer SAVT sollte auf ein (neuro-)vaskuläres Kompressionssyndrom hin abgeklärt werden. Da im Fall eines TOS auch die begleitende Arterie betroffen ist, kann ein positives Adson-Manöver (Verschwinden des Radialispulses bei Armabduktion und Elevation) erste Hinweise geben, der Test hat aber eine geringe Sensitivität und Spezifität. Die Diagnostik auf ein venöses TOS ist erst nach Wiedereröffnung der Venen sinnvoll. Geprüft wird der venöse Abstrom in Funktionsstellung (Hyperabduktion) des Arms mittels Duplexsonografie. Vor einer chirurgischen Massnahme sollte die Diagnose durch ein weiteres bildgebendes Verfahren (z.B. konventionelle Phlebografie, CT- oder MR-Venografie) bestätigt werden.
Therapie
Insgesamt werden geringere Komplikationsraten nach SAVT beobachtet als nach TBVT. Das LE-Risiko infolge einer SAVT beträgt 10–15 %, das Rezidivrisiko 5–10 % (unter Malignom 2-bis 3-mal häufiger). Da RCTs fehlen, erfolgen die Therapieempfehlungen in Analogie zur TBVT und basieren auf Beobachtungsstudien. Bei einer ersten SAVT sollte über mind. 3 Monate antikoaguliert werden.
Bei Malignom- und Katheter-assoziierter SAVT wird auch länger antikoaguliert, solange der Tumor aktiv ist bzw. das intravenöse Fremdmaterial verbleibt. Es ist etabliert, dass ein nicht infizierter, nicht dislozierter und funktionsfähiger Katheter belassen werden kann, sofern er für die Fortführung der Therapie erforderlich ist. Eine Katheterokklusion allein ist ebenfalls kein Grund, den Katheter zu entfernen. Durch Instillation eines Fibrinolytikums (z. B. 2 mg rt-PA/2 ml NaCl–0.9 %) kann in über 90 % der Fälle die Durchgängigkeit wiederhergestellt werden.
Ob eine Kompressionstherapie bei SAVT von Nutzen ist, ist nicht belegt und wird bei der im Vergleich zur TBVT niedrigen Inzidenz eines PTS von 5–10 % nicht routinemässig empfohlen. Eine Kompressionstherapie mit Kurzzugbinden oder Kompressionsärmel kann aber in der Akutphase zur Linderung der Beschwerden erwogen werden, wenn eine ausgeprägte Stauungssymptomatik vorliegt.
Nach primärer SAVT und gesichertem venösen TOS kann eine chirurgische Dekompressionstherapie (z.B. transaxilläre Resektion der 1. Rippe) erwogen werden.
Hormon- und Schwangerschafts-assoziierte TVT
Stellenwert der Hormontherapie (Pille, HRT) als Risikofaktor
Das Risiko für eine VTE ist bei Frauen im gebärfähigen Alter insgesamt niedrig, altersabhängig liegt es bei 15–35-Jährigen bei 1–2, im Alter von 35–44 Jahren bei 3–5 pro 10 000 Frauenjahren.
Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK, Pille) können das Thromboserisiko erhöhen, dabei ist neben der Östrogendosis insbesondere die Art des Gestagenanteils entscheidend (Tab. 1) (13). Das VTE-Risiko ist vor allem bei Erstanwenderinnen und im ersten Anwendungsjahr erhöht, was die Bedeutung der Prädisposition zeigt. Vor Kontrazeptiva-neuverordnung bedarf es einem Screening auf das individuelle Basisrisiko. Risikoindikatoren sind (14):
– Alter > 35 J.
– BMI > 30 kg/m2 *
– Rauchen (> 15 Zig./Tag) *
– positive Familienanamnese für VTE bei erstgradig Verwandten vor dem 45. Lj. ohne Auslöser oder bekannte Thrombophilie in der Familie
– Eigenanamnese für VTE (insbesondere Hormon-assoziierte und spontane Ereignisse ohne identifizierbare Risikofaktoren*)
Das Alter per se ist keine Kontraindikation für KOK, bei den mit Stern* gekennzeichneten Risikofaktoren soll möglichst auf KOK verzichtet und eine andere Form der Kontrazeption gewählt werden. Bei Eigen- oder Familienanamnese für ungetriggerte VTE in jungem Alter ist eine Thrombophilietestung zu erwägen, ansonsten ist sie zur individuellen Risikoabschätzung wenig hilfreich und soll nicht routinemässig vor Verschreibung von Kontrazeptiva durchgeführt werden. Beispielsweise läge die «Number needed to test», um eine VTE zu vermeiden, für die Faktor-V-Leiden-Mutation bei 666 (15).
Die ersten «Pillen» in den 1960er-Jahren hatten einen Östrogengehalt von weit mehr als 50 µg Ethinylestradiol (EE), mit Entwicklung der Mikropille (≤ 35 µg EE) konnte das VTE-Risiko gesenkt werden. Heutige in der Schweiz zugelassene KOK enthalten EE, für eine ausreichende kontrazeptive Sicherheit und Blutungsstabilität, in einer Dosis von 20–30 µg oder 1–3 mg Estradiol. Die Gestagene Levonorgestrel (Pille der 2. Generation) sowie in der KOK-Gruppe der «neueren Pillen» enthaltenes Nomegestrol und Dienogest (in Kombination mit Estradiol) haben ein vergleichsweise niedriges VTE-Risiko mit einer ca. 2- bis 3-fachen Risikoerhöhung für ein Initialereignis gegenüber Nichtanwenderinnen. Die Pillen der 3. Generation mit Desogestrel und Gestoden sowie der neueren Pillen mit Chlormadinon und Drospirenon haben ein hohes VTE-Risiko mit 4- bis 6-facher Risikoerhöhung.
Gestagenmonopräparate, mit Ausnahme von Depot-Medoxyprogesteronacetat/DMPA («3-Monatsspritze»), sind nicht mit einem erhöhten VTE-Risiko assoziiert. Als reine Gestagenpräparate mit Ovulationshemmdosis stehen in der Schweiz z.B. die Minipille mit Desogestrel, die Hormonspirale mit Levonorgestrel oder das Implantat mit Etonogestrel zur Verfügung.
Bei einer akuten VTE empfiehlt die Internationale Gesellschaft für Thrombose- und Hämostase (ISTH) eine Weiterführung der hormonellen Kontrazeption unter der Antikoagulation (16), da der Nutzen das Risiko übersteigt. Aktuell gibt es keine prospektive Evidenz, dass das Risiko thromboembolischer Komplikationen damit erhöht wird. Eine Post-hoc-Analyse der EINSTEIN-DVT/PE-Studien (17) zeigte keine Risikoerhöhung unter Antikoagulation mit Rivaroxaban respektive VKA und Hormonexposition gegenüber Patientinnen ohne hormonelle Kontrazeption. Es fanden sich auch keine Unterschiede in der VTE-Rezidivrate östrogenhaltiger Kontrazeptiva und Gestagenmonopräparaten. Demgegenüber steht das Risiko einer ungeplanten Schwangerschaft bei Umstellung bzw. Absetzen einer Kontrazeption und schwerer vaginaler Blutungen unter Hormonentzug und Antikoagulation. Während einer oralen Antikoagulation ist auch im Hinblick auf deren potenzielles Embryotoxizitätsrisiko eine sichere Empfängnisverhütung erforderlich. Vor Beenden der Antikoagulation soll dann eine östrogenhaltige auf eine östrogenfreie Kontrazeption (reines Gestagen – mit Ausnahme von DMPA- oder hormonfreie Spirale) umgestellt werden (13).
In der peri- und postmenopausalen Hormonersatztherapie (HRT) variiert das VTE-Risiko dosis- und substanzabhängig sowie mit der Applikationsform. Das Thromboserisiko steigt mit der oral zugeführten Östrogendosis, nach Metaanalysen (18) ist es in den ersten 6–12 Monaten am höchsten mit einer etwa 4- bis 6-fachen Risikoerhöhung und fällt danach auf das 2-fache in den Folgejahren. Bei frühem Beginn nach der Menopause (i.e. innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Menopause resp. vor dem 60. Lj.) kann eine individualisierte HRT in mittlerer und niedriger Dosierung (Tab. 2) bei gesunden Frauen ohne erhöhtes Basisrisiko als sicher eingestuft werden (19).
Die transdermale Estradiolgabe scheint gerinnungsphysiologisch neutral zu sein, vermutlich aufgrund der Vermeidung des First-pass-Effekts und Metabolismus in der Leber und dadurch ausbleibender Stimulation der Gerinnungsfaktorsynthese. So zeigten englische Registerdaten von mehr als 950 000 postmenopausalen Frauen für transdermal applizierte Östrogene im Vergleich zu unbehandelten Kontrollen kein erhöhtes Thromboserisiko, unabhängig der Dosis, mit und ohne oralem Gestagen (20), was sich in weiteren Studien bestätigte (21).
Die in den vorgenannten Untersuchungen (20, 21) vergleichbare Risikoerhöhung einer Östrogenmonotherapie (nur geeignet für Frauen nach Hysterektomie) und einer kombinierten Therapie mit Gestagen (indiziert bei intaktem Uterus zum Schutz des Endometriums) implizieren, dass die Auswahl des Gestagens möglicherweise von untergeordneter Bedeutung ist. Die Daten diesbezüglich sind jedoch inkonsistent, während mikronisiertes Progesteron und 17-Hydroxyprogesteronderivate sich nicht zusätzlich zum Östrogeneffekt auswirken, gibt es auch Hinweise, dass synthetische Gestagene (wie Medroxyprogesteronacetat) ein erhöhtes VTE-Risiko haben (22, 23).
Thrombosen in Schwangerschaft und Wochenbett (1, 24)
Das VTE-Risiko von Schwangeren ist durchschnittlich 6-fach höher als das von nicht schwangeren Frauen und liegt bei ca. 1–2/1000 Schwangerschaften. Im Verlauf der Schwangerschaft steigt es an zu einer etwa 10- bis 20-fachen Risikoerhöhung um den Geburtszeitpunkt und den ersten Wochen postpartal, danach sinkt es wieder ab und ist 6–12 Wochen post partum nur noch geringfügig erhöht (25).
Zur Diagnostik des Thromboseverdachts bei Schwangeren gibt es bisher keinen anerkannten Algorithmus, das sonst übliche Vorgehen einer der Bilddiagnostik vorgeschalteten Stratifizierung über die klinische Wahrscheinlichkeit (KW) mittels Score und D-Dimeren ist nicht für die Schwangerschaft validiert.
– Die KW wird mit dem Wells-Score nur ungenügend erfasst. Isolierte Beckenvenenthrombosen, die durch fötusbedingte Kompression der Iliakalvenen mit 15–20 % d.F. in der Schwangerschaft gehäuft vorkommen, äussern sich klinisch oft atypisch ohne Beinschwellung, nur mit Schmerzen im Gesäss, in der Leiste oder im Bauchraum.
– Die D-Dimere, die einen hohen Stellenwert in der Diagnostik bei nicht schwangeren Patientinnen haben, steigen im Verlauf der Schwangerschaft physiologisch an. Im 1. Trimenon haben etwa 50–85 % der Frauen noch normale D-Dimer-Werte, der Anteil mit normalen D-Dimeren sinkt im 2. Trimenon auf 23–33 % und im 3. Trimenon auf 0–4 % (25). Prospektive Managementstudien für Schwangerschafts-adaptierte Cutoff-Werte fehlen, es ist aber davon auszugehen, dass innerhalb der etablierten Referenzbereiche normale D-Dimere eine klinisch relevante VTE bei Schwangeren genauso sicher ausschliessen wie bei Nichtschwangeren.
– Aufgrund der genannten Limitationen soll bei jedem Verdacht initial eine Bildgebung erfolgen. Methode der Wahl ist ein Ultraschall mit Kompressionssonografie der Beinvenen inklusiv Darstellung der Iliakalvenen.
– Bei nicht eindeutigem Befund wird eine Wiederholungssonografie innert von 7 Tagen, eine D-Dimer-Bestimmung und/oder – bei Verdacht auf eine isolierte Beckenvenenthrombose – eine native MR-Venografie (ohne Gadolinium-Kontrast) empfohlen.
Zur Therapie sind NMH die Antikoagulantien 1. Wahl in der Schwangerschaft und Stillzeit, sie sind nicht plazentagängig und werden nicht in nennenswerten Mengen in die Muttermilch sezerniert. VKA sind aufgrund embryotoxischer Nebenwirkung in der Schwangerschaft kontraindiziert, für die Stillzeit sind sie zugelassen. DOAK sind in der Schwangerschaft aufgrund mangelnder Sicherheitsdaten kontraindiziert. Danaparoid und Fondaparinux können in Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden, da jedoch nur begrenzte Erfahrungen zu deren Anwendung in der Schwangerschaft vorliegen, sollen sie lediglich als Reservemedikamente bei Kontra-
indikationen von Heparinen (z.B. HIT oder kutane Heparinallergie) verordnet werden.
– Die Antikoagulation soll für mindestens 3 Monate erfolgen und in jedem Fall bis 6 Wochen post partum fortgeführt werden (1, 2, 26).
– Man beginnt mit NMH in gewichtsadaptierter, volltherapeutischer Dosis. Nach 4 Wochen kann bei erhöhtem Blutungsrisiko eine Reduktion auf eine intermediäre NMH-Dosis (50–75 % der Ausgangsdosis) erwogen werden. Dies bleibt bei wenig Studiendaten zu diesem Dosisregime eine Einzelfallentscheidung.
– Postpartal kann auf einen VKA umgestellt werden (Ziel-INR von 2–3). Die kurz wirksamen VKA Acenocoumarol und Warfarin werden nicht, das lipophilere Phenprocoumon in geringem Mass in die Muttermilch sezerniert. Bei letzterem sollte daher das Neugeborene eine Vitamin-K-Substitution erhalten (1 ×/Wo 2 mg Konakion®MM paediatric p.o.)
Rezidivrisiko und -prophylaxe nach Hormon- und Schwangerschafts-assoziierter TVT
Die ISTH klassifiziert in ihrem Guidance-Dokument (27) KOK, HRT und Schwangerschaft als schwache, aber wichtige transiente Risikofaktoren. Das Rezidivrisiko halbiert sich, sobald der hormonelle Einfluss als potenzieller Trigger wegfällt, und ist nur halb so hoch wie bei spontanen VTE-Ereignissen ohne identifizierbaren Risikofaktor.
– Wegen des niedrigen Rezidivrisikos nach Beendigung des hormonellen Triggers wird in den nationalen (13, 28) und internationalen Guidelines (1–3) nur eine reguläre, keine verlängerte, d.h. in der Regel 3-monatige (in der Schwangerschaft in jedem Fall aber bis 6 Wochen postpartale), Antikoagulation empfohlen.
– Nach einer Schwangerschafts-assoziierten VTE ist das Rezidivrisiko für ein erneutes Ereignis in der Folgeschwangerschaft höher (29) als bei Frauen, die eine nicht Schwangerschafts-assoziierte VTE hatten. Diesen Frauen und auch Patientinnen nach einer Hormon-assoziierten VTE wird bei künftiger Schwangerschaft von Beginn an bis 6 Wochen postpartal zu einer prophylaktischen Antikoagulation geraten (30).
Carcinom-assoziierte Thrombose (CAT)
Bei CAT wird eine Antikoagulation über 3–6 Monate empfohlen (IA), anschliessend sollte eine prolongierte Sekundärprophylaxe erfolgen (IIaA), solange die Tumorerkrankung aktiv ist. Eine aktive Tumorerkrankung ist definiert als lokal fortgeschrittenes, metastasiertes oder rezidivierendes bzw. in den letzten 6 Monaten diagnostiziertes oder behandeltes Malignom.
Lange galten NMH als Standardtherapie bei Tumor-assoziierter VTE. Internationale Guidelines (2, 31, 32) empfehlen nun auf neuen Daten basierend direkte Faktor-Xa-Inhibitoren (DXI) als präferierte Behandlung (IA), sofern keine Kontraindikationen vorliegen. In Vergleichsstudien und nachfolgenden Metaanalysen zeigte sich eine Nichtunterlegenheit für DXI und unter Berücksichtigung der besseren Therapietreue eine signifikante Abnahme der VTE-Rezidive im Vergleich zu NMH, allerdings mit Hinweis auf vermehrte Blutungsraten (33–37). Für den Thrombininhibitor Dabigatran liegen keine Daten zur Wirksamkeit für die Behandlung Tumor-assoziierter VTE im Vergleich zu NMH vor.
Bei der Substanzwahl «DXI vs. NMH» sind individuell neben Blutungsrisiken und Aspekten der Tumorerkrankung (Tumorentität, Antitumortherapie) auch die klinische Situation und Praktikabilität einer oralen vs. parenteralen Therapie und die Patientenpräferenz zu berücksichtigen sowie im Verlauf in regelmässigen Intervallen zu überprüfen (Abb. 2). Speziell ist zu beachten:
– Bei nicht operierten oder verbleibenden gastrointestinalen und urogenitalen Tumoren sind NMH weiterhin die Therapie der Wahl aufgrund des unter DOAK im Vergleich erhöhten Blutungsrisikos.
– Für Apixaban besteht zudem eine Einschränkung bei primären oder metastatischen Hirntumoren und akuter Leukämie, weil diese Tumorentitäten in der relevanten Caravaggio-Studie (33) nicht eingeschlossen waren.
– Bei DXI muss im Gegensatz zu den NMH das Interaktionspotenzial mit einer laufenden oder geplanten Anti- tumortherapie berücksichtigt werden (Prüfmöglichkeit unter www.drugs.com).
– Bei erhöhtem Blutungsrisiko können NMH nach 6 Wochen gemäss CLOT-Studie (38) auf eine intermediäre 75 %-Dosis reduziert werden. Die DXI-Studien zu CAT wurden alle in der Therapiephase nach akuter VTE in volltherapeutischer Dosierung durchgeführt, prospektive Studien mit Vergleich unterschiedlicher Intensitäten der Antikoagulation fehlen. In Anlehnung an die Daten bei Nichttumorpatienten kann im Einzelfall nach Nutzen-Risiko-Abwägung eine Dosisreduktion von Apixaban (2 × 2.5 mg/d) oder Rivaroxaban (1 × 10 mg/d) zur prolongierten Prophylaxe erwogen werden (1).
– Besteht ein erhöhtes Blutungsrisiko aufgrund einer Thrombozytopenie, die Malignom-bedingt oder aufgrund der spezifischen Therapie bei Tumorpatienten häufig vorkommt, sind DXI bei einer Thrombozytenzahl < 50 000/µl kontraindiziert. NMH sollen ab diesem Schwellenwert auf die halbe Dosis reduziert und unter 25 000/µl pausiert werden (1, 32).
– Bei Thromboserezidiv unter therapeutischer Dosis mit NMH wird eine Fortsetzung der Therapie mit erhöhter Dosis um 20–25 % oder ein Wechsel auf DXI empfohlen (39). Bei Rezidiv unter DXI gibt es keine auf höhergradiger Evidenz basierenden Empfehlungen. Bei Therapie-adhärenz und Ausschluss ursächlicher Medikamenteninteraktionen kann mit der erhöhten Initialdosis der VTE-Therapie von Apixaban oder Rivaroxaban behandelt oder auf NMH (ggf. mit erhöhter Dosis) umgestellt werden(1). Im Einzelfall können auch Plasmaspiegelkontrollen sinnvoll sein.
Abkürzungen
AK Antikoagulation
APS Antiphospholipid-Syndrom
APA Antiphospholipid-Antikörper
CAT Carcinom-assoziierte Thrombose
CVST Cerebrale Venen- und Sinusthrombosen
CT Computertomografie
CTPA CT-Pulmonalisangiografie
DOAK Direkte orale Antikoagulanzien
DXI Direkter Faktor-Xa-Inhibitor
GFR Glomeruläre Filtrationsrate
HIT Heparin-induzierte Thrombozytopenie
HRT Peri-/postmenopausale Hormonersatztherapie
LE Lungenembolie
KKL Kompressionsklasse
KOK Kombinierte orale Kontrazeptiva
KUS Kompressionsultraschall
KW Klinische Wahrscheinlichkeit
MR Magnetresonanz
NMH Niedermolekulares Heparin
NSAR Nichtsteroidale Antirheumatika
OAK Orale Antikoagulation
OVT Oberflächliche Venenthrombose
PNH Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie
POCT Point-of-Care-Test
PTS Postthrombotisches Syndrom
SAVT Schulter-Armvenenthrombose
TBVT Tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose
TOS Thoracic-outlet-Syndrom
TVT Tiefe Venenthrombose
UFH Unfraktioniertes Heparin
VKA Vitamin-K-Antagonisten
VTE Venöse Thromboembolie
Historie
Manuskript eingereicht: 03.06.2024
Manuskript angenommen: 02.07.2024
Anhang
Informationen zur Methodik der Guidelineerstellung des IHAMZ mit den angewandten FMH- und IOM
(Institute of medicine)-Qualitätskriterien (Evidenz-Niveaus, Empfehlungsgrade etc.) finden sich auf der Homepage
www.hausarztmedizin.uzh.ch unter dem Themenblock
Guidelines im Positionspapier.
Institut für Hausarztmedizin Universitätsspital Zürich (IHAMZ)
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
andrea.rosemann@usz.ch
Klinik für Gynäkologie
Universitätsspital Zürich (USZ)
isabell.witzel@usz.ch
Institut für Hausarztmedizin
Universität und UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich (IHAMZ), Zürich
Institut für Hausarztmedizin
Universitätsspital Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
thomas.rosemann@usz.ch
Institut für Hausarztmedizin
Universität und UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
oliver.senn@usz.ch
Klinik für Kardiologie,
Kantonsspital Graubünden,
Chur
Die Autorinnen und Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.
1. Linnemann B, Blank W, Doenst T, al e. Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und Lungenembolie – AWMF-S2k-Leitlinie. 2023;https:/register.awmf.org/de/leitlinien/detail/065-002.
2. Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, Bounameaux H, Doerschug K, Geersing GJ, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2021;160(6):e545-e608.
3. Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, Bauersachs R, Bellmunt-Montoya S, Black SA, et al. Editor‘s Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021;61(1):9-82.
4. Mazzolai L, Ageno W, Alatri A, Bauersachs R, Becattini C, Brodmann M, et al. Second consensus document on diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: updated document elaborated by the ESC Working Group on aorta and peripheral vascular diseases and the ESC Working Group on pulmonary circulation and right ventricular function. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(8):1248-63.
5. Lim W, Le Gal G, Bates SM, Righini M, Haramati LB, Lang E, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: diagnosis of venous thromboembolism. Blood Adv. 2018;2(22):3226-56.
6. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, Beyth R, Clark NP, Cuker A, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Blood Adv. 2020;4(19):4693-738.
7. Decousus H, Quere I, Presles E, Becker F, Barrellier MT, Chanut M, et al. Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, prospective epidemiologic study. Ann Intern Med. 2010;152(4):218-24.
8. Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, Bauersachs RM, Boda Z, Brenner B, et al. Fondaparinux for the treatment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med. 2010;363(13):1222-32.
9. Beyer-Westendorf J, Schellong SM, Gerlach H, Rabe E, Weitz JI, Jersemann K, et al. Prevention of thromboembolic complications in patients with superficial-vein thrombosis given rivaroxaban or fondaparinux: the open-label, randomised, non-inferiority SURPRISE phase 3b trial. Lancet Haematol. 2017;4(3):e105-e13.
10. Sullivan V, Denk PM, Sonnad SS, Eagleton MJ, Wakefield TW. Ligation versus anticoagulation: treatment of above-knee superficial thrombophlebitis not involving the deep venous system. J Am Coll Surg. 2001;193(5):556-62.
11. Constans J, Salmi LR, Sevestre-Pietri MA, Perusat S, Nguon M, Degeilh M, et al. A clinical prediction score for upper extremity deep venous thrombosis. Thromb Haemost. 2008;99(1):202-7.
12. van Es N, Bleker SM, Di Nisio M, Kleinjan A, Beyer-Westendorf J, Camporese G, et al. A clinical decision rule and D-dimer testing to rule out upper extremity deep vein thrombosis in high-risk patients. Thromb Res. 2016;148:59-62.
13. Franik S, Bauersachs R, Beyer-Westendorf J, Buchholz T, Buhling K, Diener HC, et al. Hormonal Contraception. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S3 Level, AWMF Registry Number 015/015, January 2020). Geburtshilfe Frauenheilkd. 2021;81(2):152-82.
14. Curtis KM, Tepper NK, Jatlaoui TC, Berry-Bibee E, Horton LG, Zapata LB, et al. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2016. MMWR Recomm Rep. 2016;65(3):1-103.
15. Middeldorp S. Evidence-based approach to thrombophilia testing. J Thromb Thrombolysis. 2011;31(3):275-81.
16. Baglin T, Bauer K, Douketis J, Buller H, Srivastava A, Johnson G, ISTH SSCot. Duration of anticoagulant therapy after a first episode of an unprovoked pulmonary embolus or deep vein thrombosis: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2012;10(4):698-702.
17. Martinelli I, Lensing AW, Middeldorp S, Levi M, Beyer-Westendorf J, van Bellen B, et al. Recurrent venous thromboembolism and abnormal uterine bleeding with anticoagulant and hormone therapy use. Blood. 2016;127(11):1417-25.
18. Miller J, Chan BK, Nelson HD. Postmenopausal estrogen replacement and risk for venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2002;136(9):680-90.
19. Birkhäuser M, Bürki R, De Geyter C, Imthurn B, Schiessl K, Streuli I, et al. Aktuelle Empfehlungen zur Menopausalen Hormon-Therapie (MHT). Expertenbrief No 42. Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe2015.
20. Renoux C, Dell‘Aniello S, Suissa S. Hormone replacement therapy and the risk of venous thromboembolism: a population-based study. J Thromb Haemost. 2010;8(5):979-86.
21. Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. BMJ. 2019;364:k4810.
22. Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, Conard J, Meyer G, Levesque H, et al. Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women: impact of the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER study. Circulation. 2007;115(7):840-5.
23. Sweetland S, Beral V, Balkwill A, Liu B, Benson VS, Canonico M, et al. Venous thromboembolism risk in relation to use of different types of postmenopausal hormone therapy in a large prospective study. J Thromb Haemost. 2012;10(11):2277-86.
24. Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S, McLintock C, Rodger MA, James AH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018;2(22):3317-59.
25. Linnemann B, Bauersachs R, Rott H, Halimeh S, Zotz R, Gerhardt A. Diagnosis of pregnancy-associated venous thromboembolism – position paper of the Working Group in Women‘s Health of the Society of Thrombosis and Haemostasis (GTH). VASA. 2016;45(2):87–101.
26. Chan WS, Rey E, Kent NE, Chan WS, Kent NE, Rey E, et al. Venous thromboembolism and antithrombotic therapy in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2014;36(6):527-53.
27. Kearon C, Ageno W, Cannegieter SC, Cosmi B, Geersing GJ, Kyrle PA, et al. Categorization of patients as having provoked or unprovoked venous thromboembolism: guidance from the SSC of ISTH. J Thromb Haemost. 2016;14(7):1480-3.
28. Ortmann O, Beckermann MJ, Inwald EC, Strowitzki T, Windler E, Tempfer C, guideline g. Peri- and postmenopause-diagnosis and interventions interdisciplinary S3 guideline of the association of the scientific medical societies in Germany (AWMF 015/062): short version. Arch Gynecol Obstet. 2020;302(3):763-77.
29. White RH, Chan WS, Zhou H, Ginsberg JS. Recurrent venous thromboembolism after pregnancy-associated versus unprovoked thromboembolism. Thromb Haemost. 2008;100(2):246-52.
30. Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e691S-e736S.
31. Lyman GH, Carrier M, Ay C, Di Nisio M, Hicks LK, Khorana AA, et al. American Society of Hematology 2021 guidelines for management of venous thromboembolism: prevention and treatment in patients with cancer. Blood Adv. 2021;5(4):927-74.
32. Lyon AR, Lopez-Fernandez T, Couch LS, Asteggiano R, Aznar MC, Bergler-Klein J, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J. 2022;43(41):4229-361.
33. Agnelli G, Becattini C, Meyer G, Munoz A, Huisman MV, Connors JM, et al. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. N Engl J Med. 2020;382(17):1599-607.
34. Young AM, Marshall A, Thirlwall J, Chapman O, Lokare A, Hill C, et al. Comparison of an Oral Factor Xa Inhibitor With Low Molecular Weight Heparin in Patients With Cancer With Venous Thromboembolism: Results of a Randomized Trial (SELECT-D). J Clin Oncol. 2018;36(20):2017-23.
35. Raskob GE, van Es N, Verhamme P, Carrier M, Di Nisio M, Garcia D, et al. Edoxaban for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2018;378(7):615-24.
36. Schrag Dea. Direct Oral Anticoagulants vs Low-Molecular-Weight Heparin and Recurrent VTE in Patients With CancerA Randomized Clinical Trial. . 2023 Jun 13;329(22):1924-1933.
37. Moik FP, F.; Zielinski, C.; Pabinger, I.; Ay, C. Direct oral anticoagulants compared to low-molecular-weight heparin for the treatment of cancer-associated thrombosis: Updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Res Pract Thromb Haemost. 2020.
38. Lee AY, Levine MN, Baker RI, Bowden C, Kakkar AK, Prins M, et al. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med. 2003;349(2):146-53.
39. Farge D, Frere C, Connors JM, Khorana AA, Kakkar A, Ay C, et al. 2022 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer, including patients with COVID-19. Lancet Oncol. 2022;23(7):e334-e47.