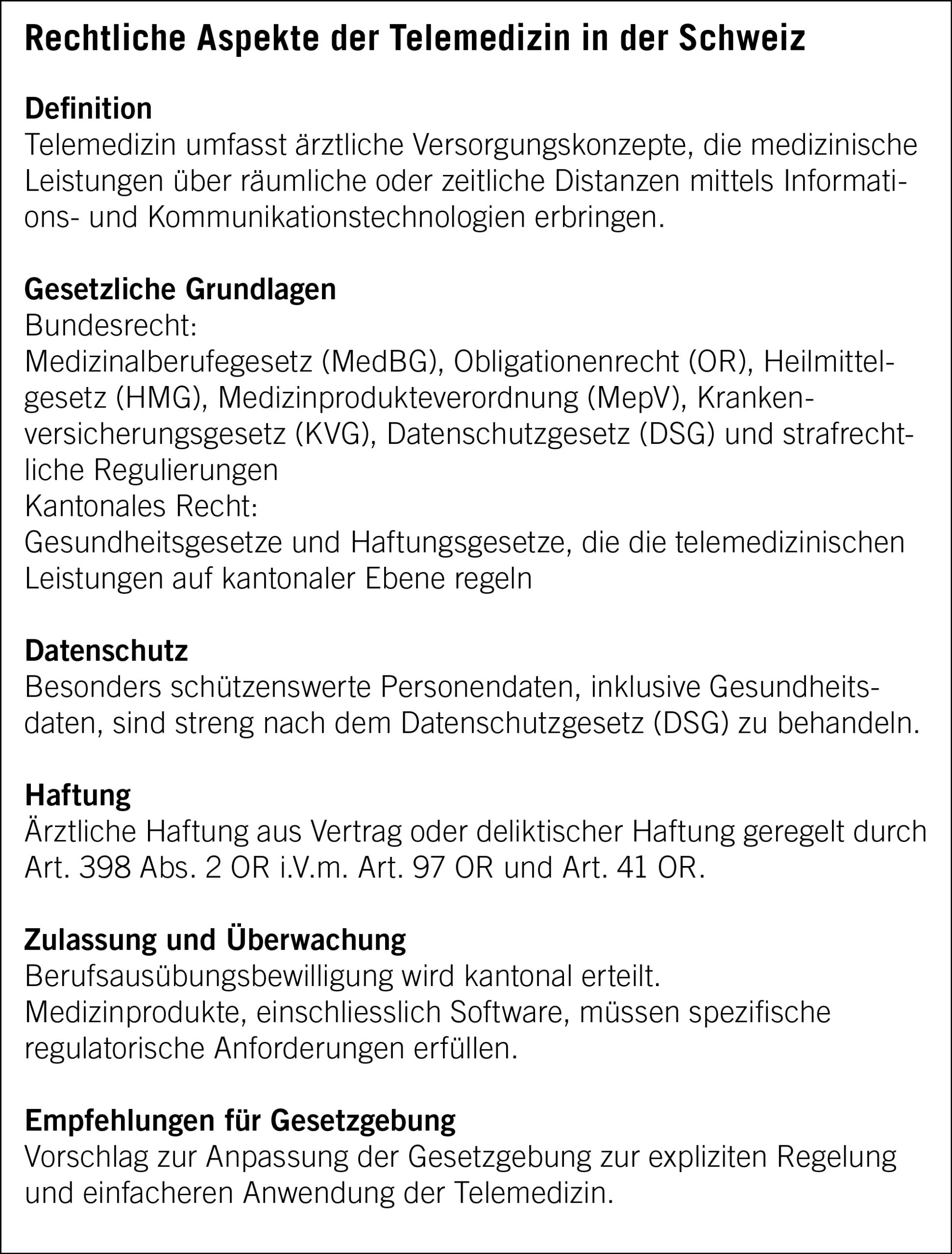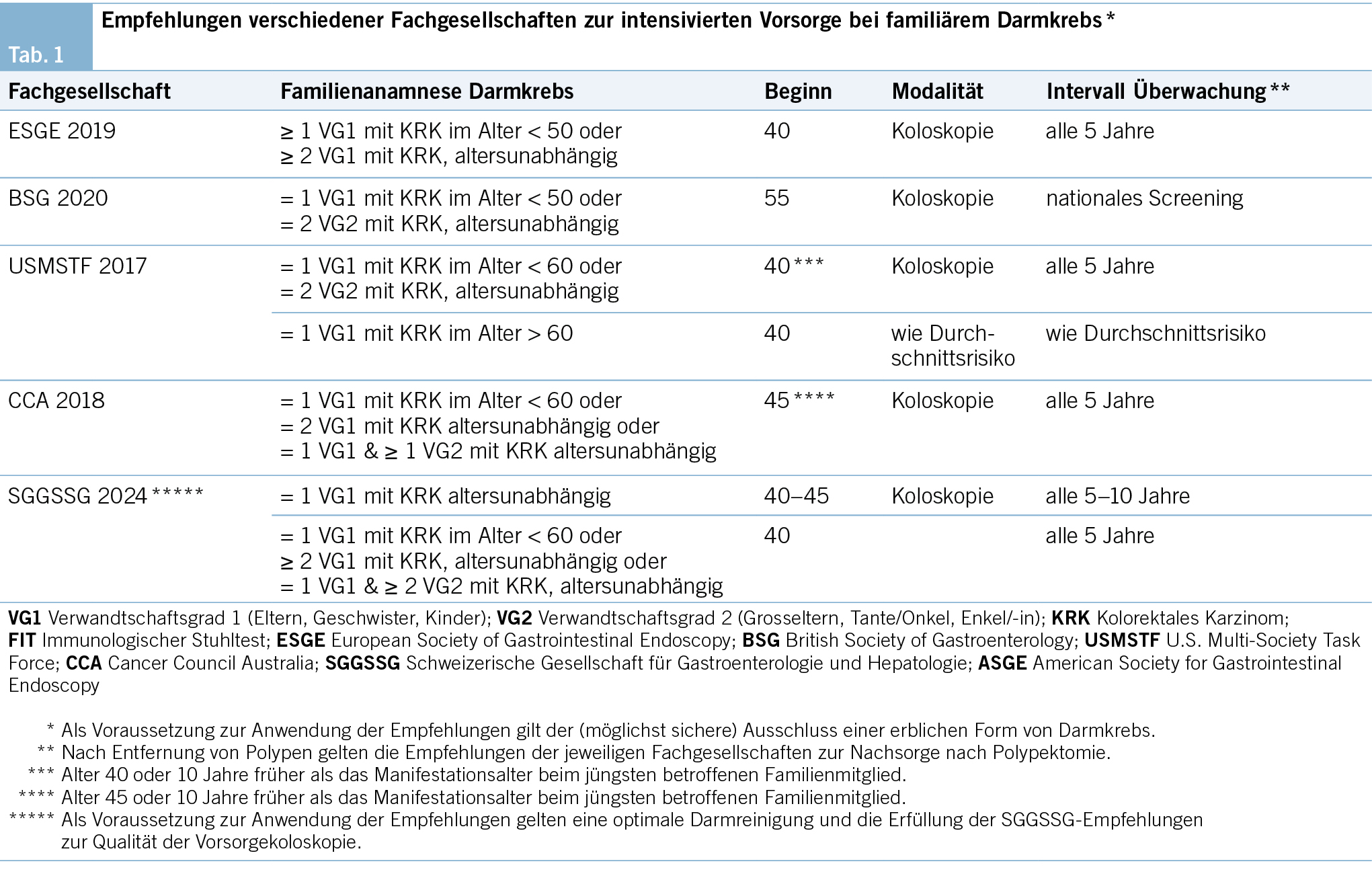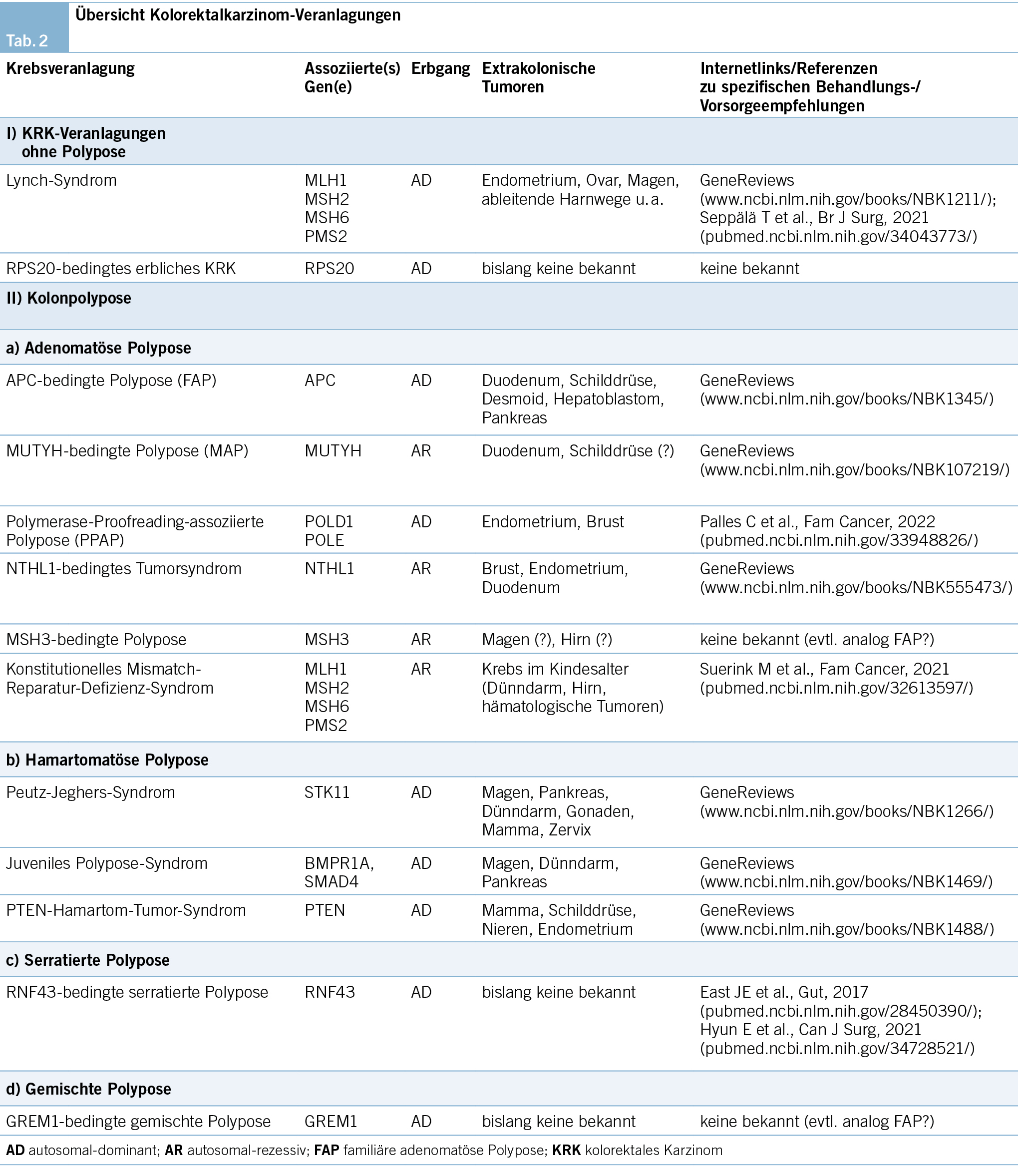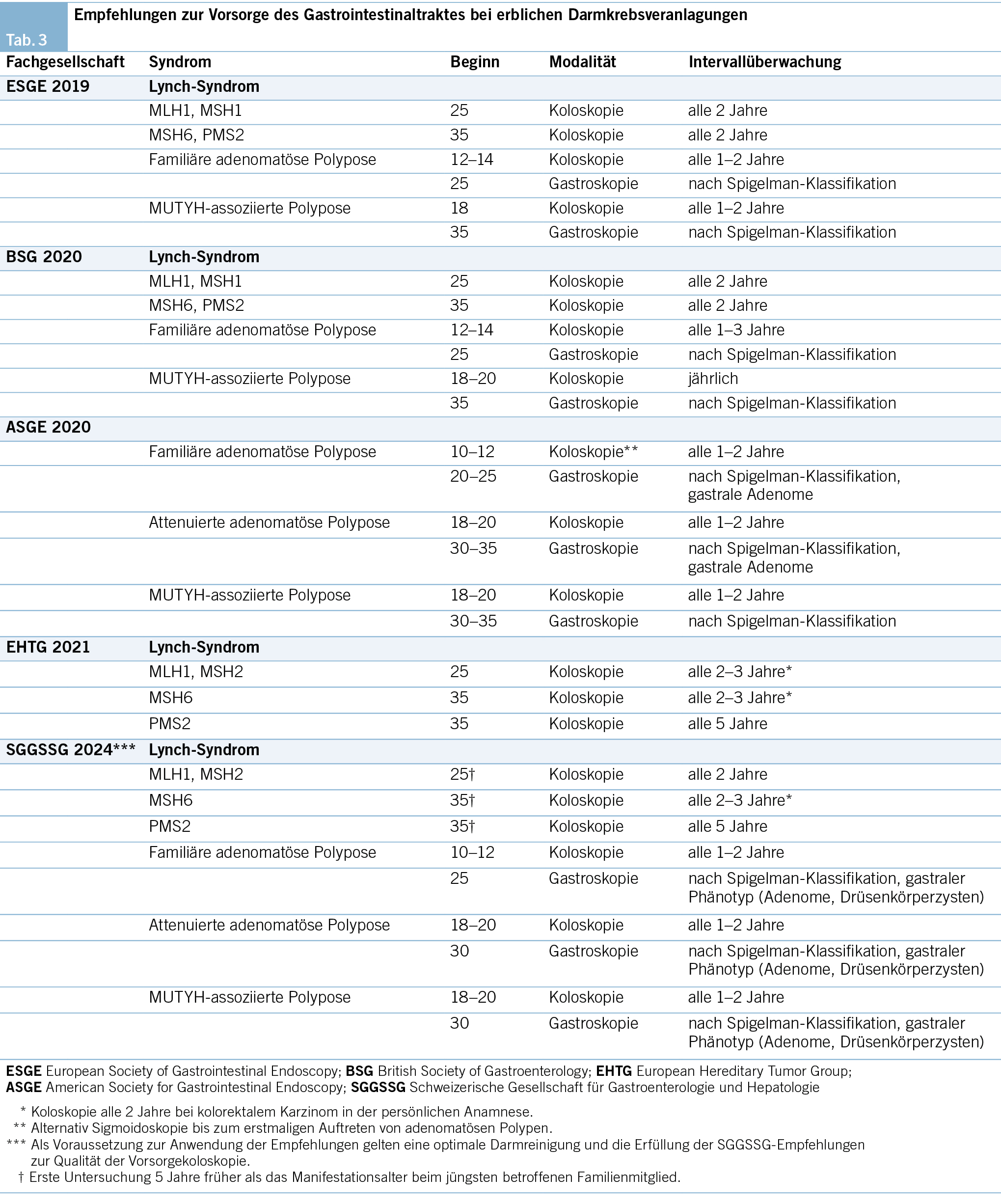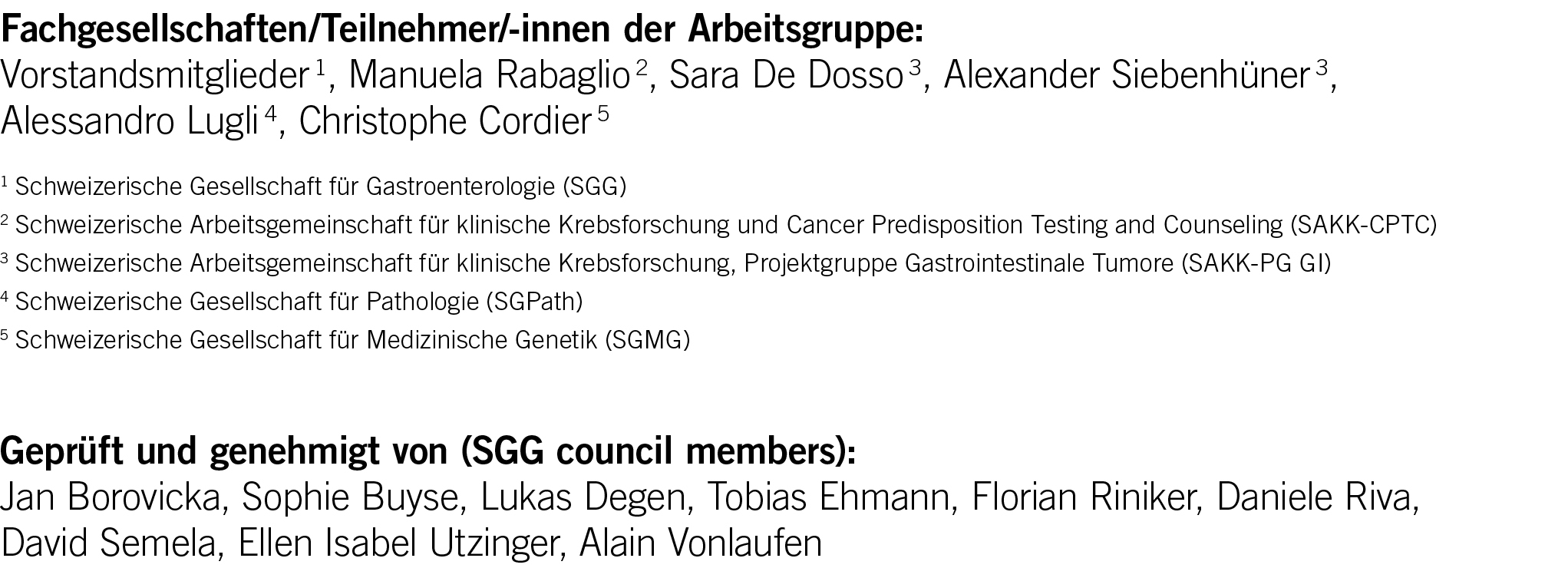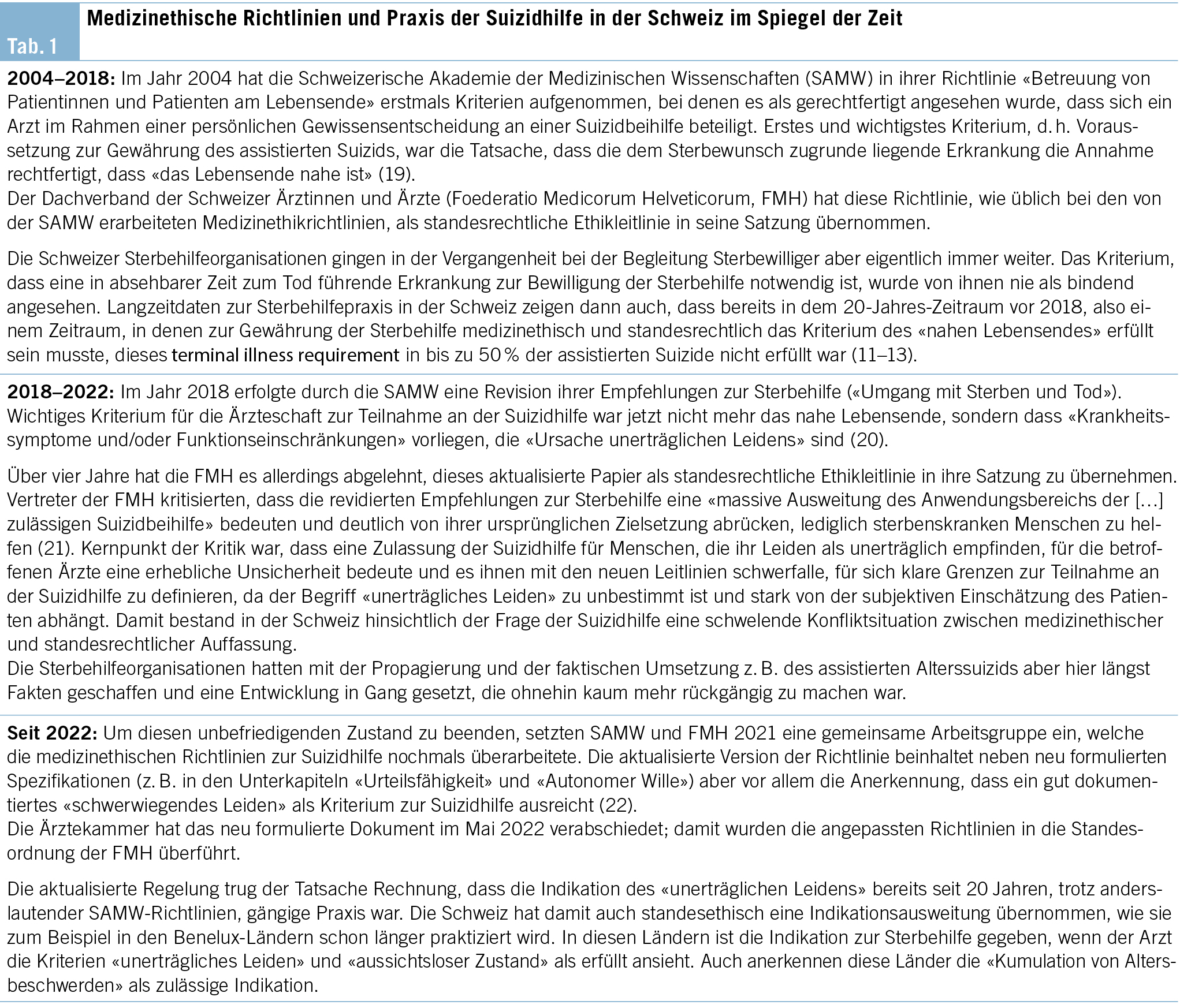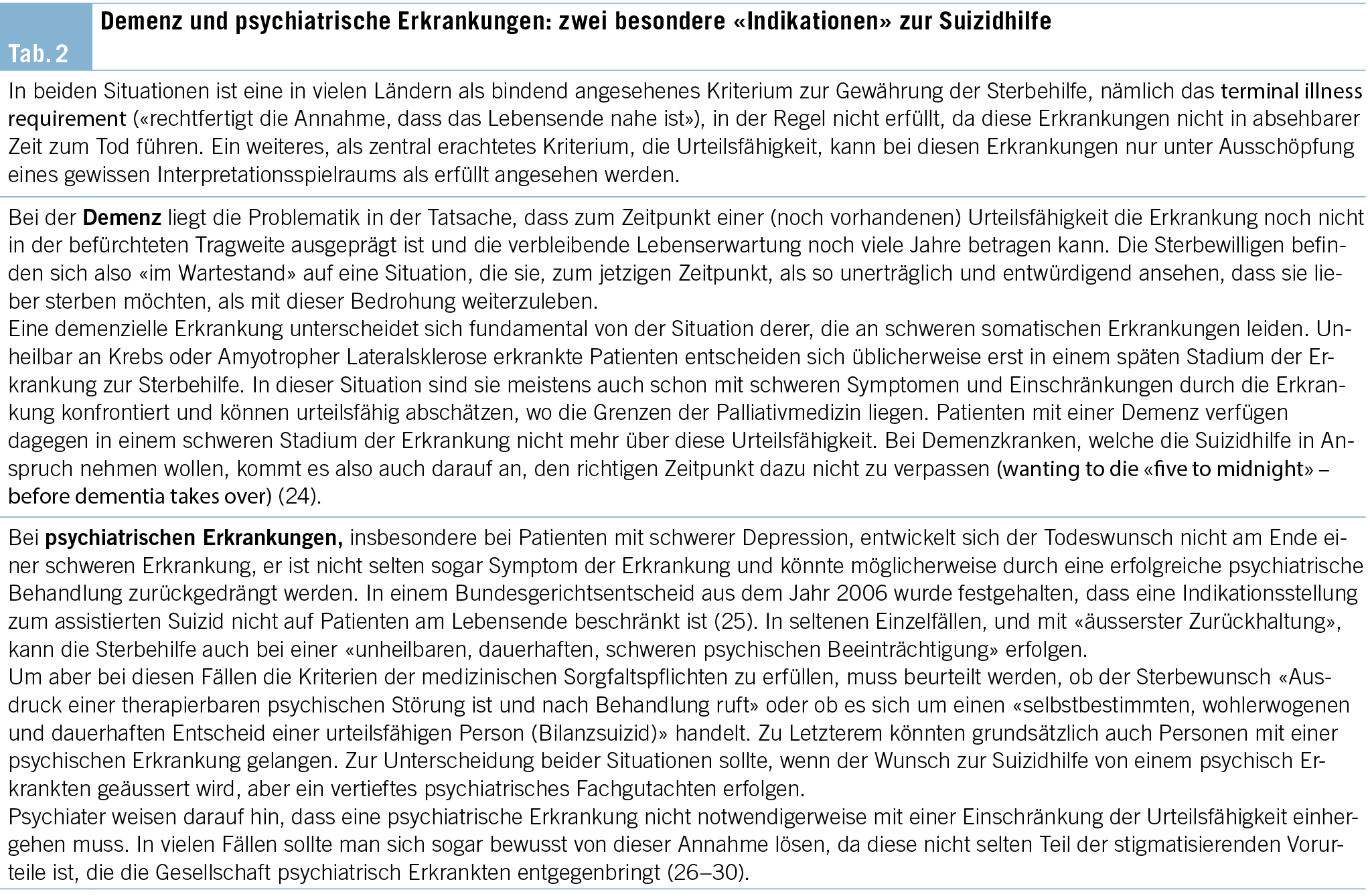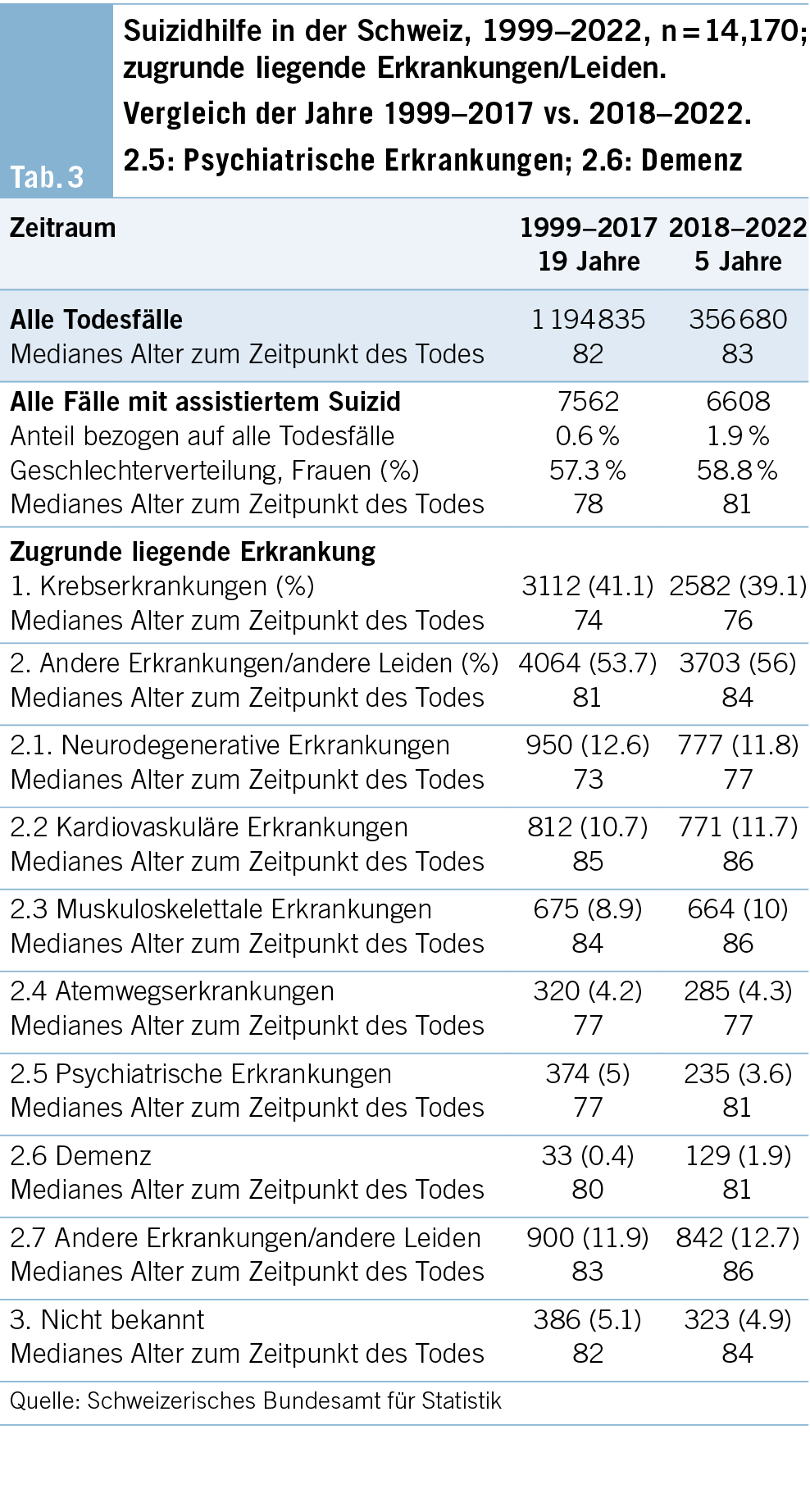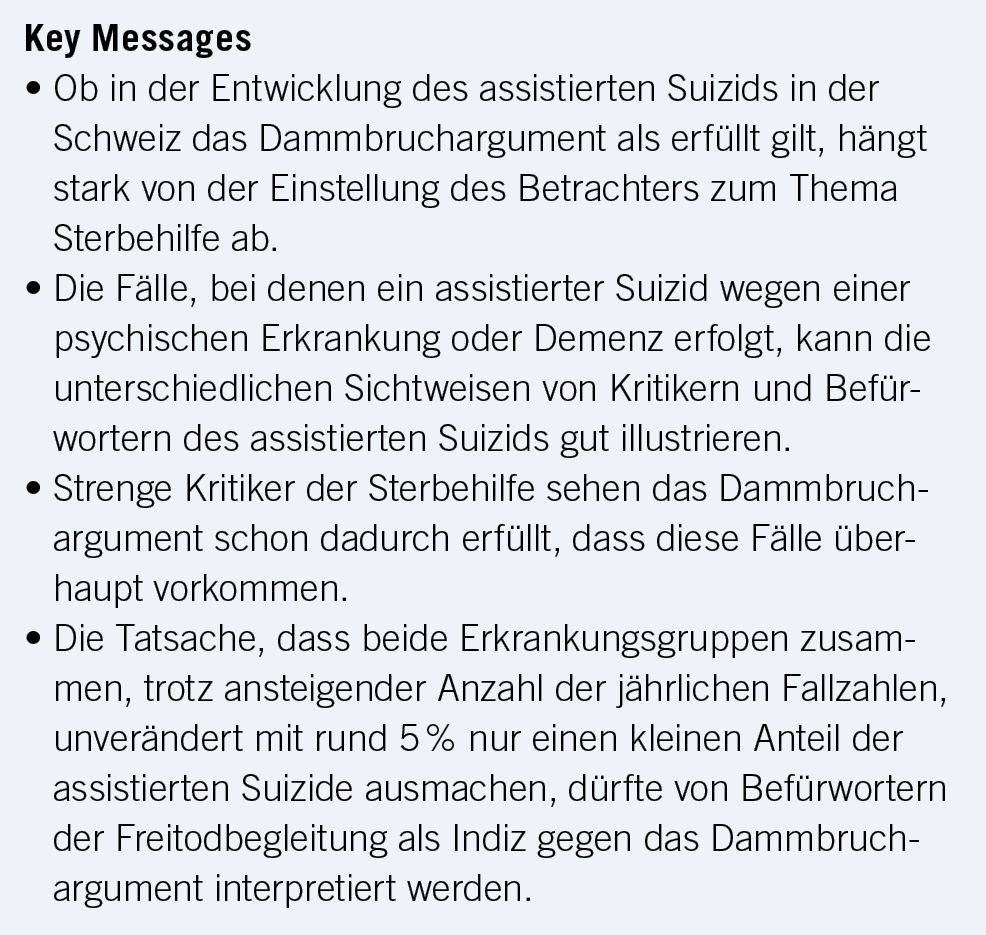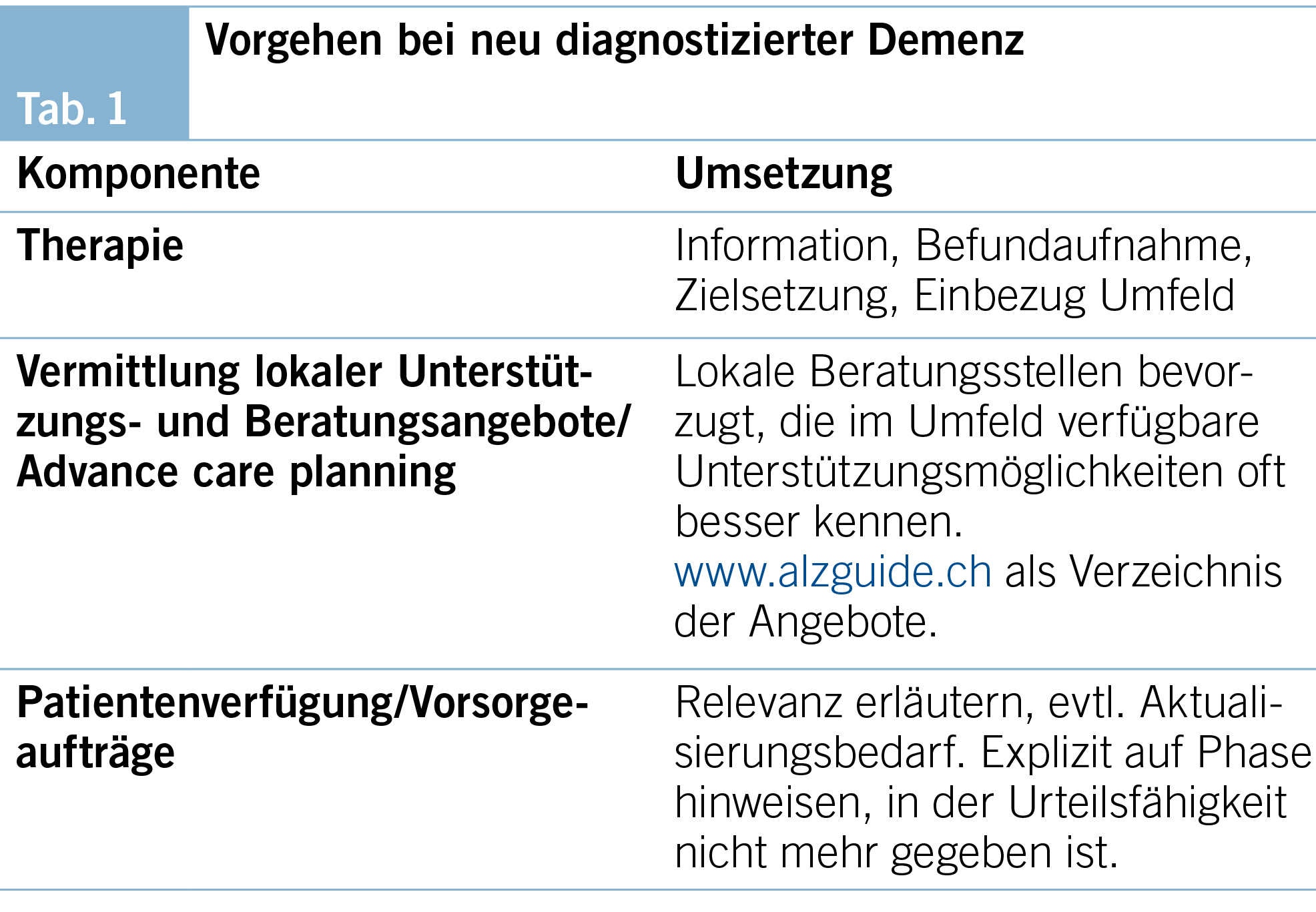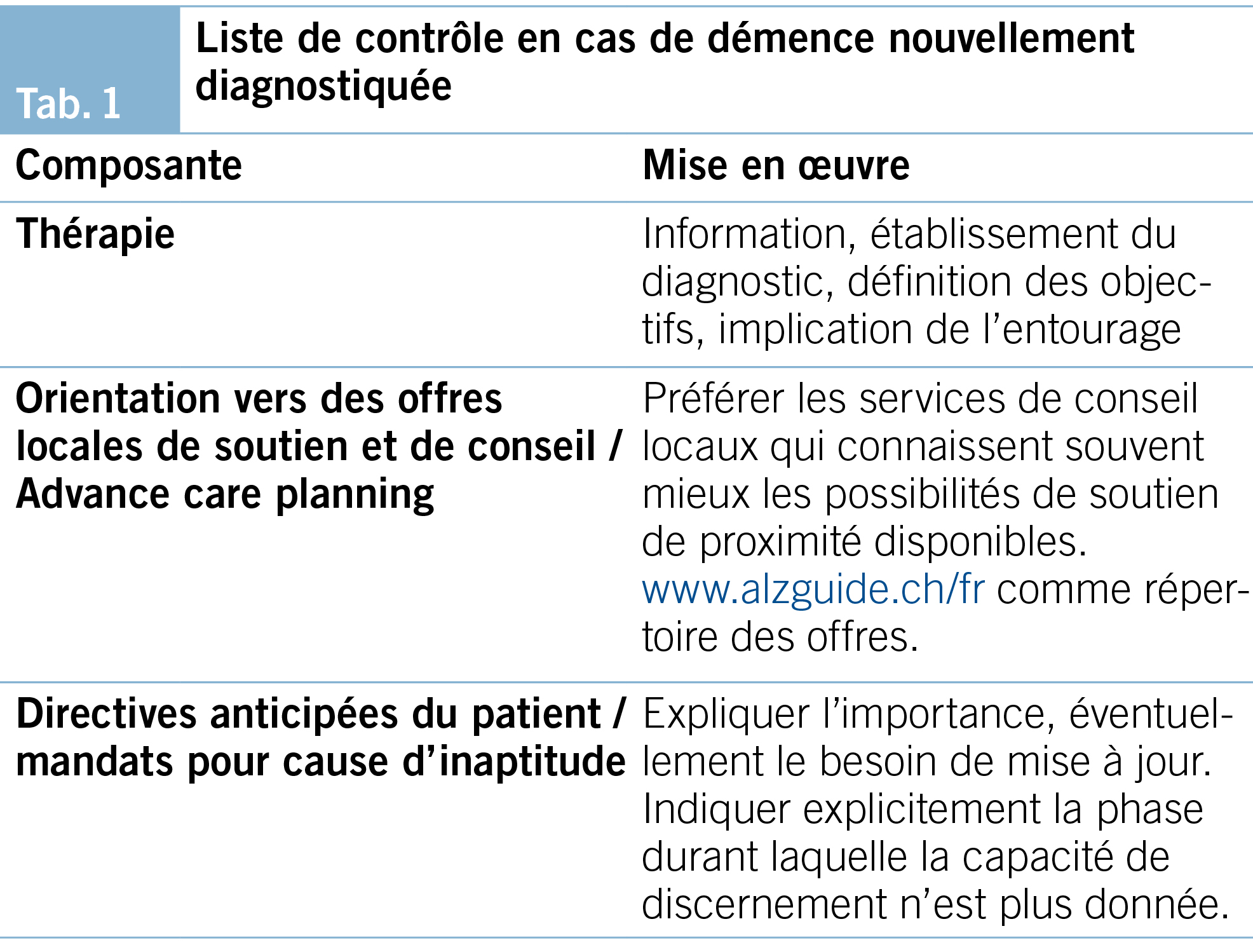Arzneimittel und Medizinprodukte können ein Risikopotenzial für die Gesundheit aufweisen. Sie dürfen daher nur in Verkehr gebracht werden, wenn ihre Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität belegt sind. Die Anforderungen an die Sicherheit sind dabei nicht absolut zu verstehen. Vielmehr liegt der Sicherheitsbewertung eine Nutzen-Risiko-Abwägung zugrunde. Für Arzneimittel und Medizinprodukte bestehen verschiedene Vorgaben, wonach Arzneimittel grundsätzlich einem Zulassungsverfahren unterliegen, während Medizinprodukte ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen müssen. Dieser Beitrag legt zunächst die Grundlagen und die Systematik des Heilmittelrechts in der Schweiz dar und geht auf die Kategorisierung von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie auf ihre Abgrenzung zu anderen Produkten, insbesondere Lebensmittel und Kosmetika, ein. Danach werden die Grundzüge des Inverkehrbringens vorgestellt, wobei der Fokus auf den Zulassungsverfahren für Arzneimittel liegt. Des Weiteren befasst sich dieser Beitrag in einem kurzen Überblick mit den Schutzrechten für Arzneimittel. Neben dem heilmittelrechtlichen Schutzrecht, dem Unterlagenschutz, sind dies immaterialgüterrechtliche Schutzrechte. Neben dem Patent gewährt das Immaterialgüterrecht ein weiteres Schutzrecht für Produkte, welche eine Zulassung für ihr Inverkehrbringen benötigen. Das Ergänzende Schutzzertifikat, welches nur Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel als zulassungspflichtige Produkte gewährt wird, soll dabei teilweise die fehlende Nutzungsmöglichkeit der patentgeschützten Erfindung während des Zulassungsverfahrens kompensieren. Aufgrund des Umfangs der angesprochenen heilmittel- und immaterialgüterrechtlichen Regulierungen muss sich der vorliegende Beitrag in einem Überblick auf ausgewählte Bereiche beschränken.
Schlüsselwörter: Pharmazeutische Präparate, Medizinprodukte, Patentschutz, Ergänzendes Schutzzertifikat
Regulierung von Arzneimitteln und Medizinprodukten
Arzneimittel und Medizinprodukte als Produkte mit Risikopotenzial
Der Begriff Heilmittel umfasst als Oberbegriff Arzneimittel und Medizinprodukte (1). Sowohl Arzneimittel als auch Medizinprodukte dienen der Prävention und Heilung von Krankheiten, der Wiederherstellung der Gesundheit oder der Bekämpfung und Linderung von Schmerzen. Jedoch weisen diese Produkte auch ein besonderes Risiko- oder Gefährdungspotenzial auf, welches zu Gesundheitsgefährdungen oder zu Gesundheitsschäden führen kann (2). Dieses Risiko- oder Gefährdungspotenzial kann sich in zweifacher Hinsicht realisieren: Einerseits können – insbesondere bei Arzneimitteln – Nebenwirkungen und Wechselwirkungen auftreten, oder die Produkte können verunreinigt oder von mangelnder Qualität und mithin unsicher sein. Anderseits kann auch die gewünschte Wirkung ausbleiben, was ebenfalls zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann, wenn sich Patienten auf eine entsprechende Wirkung von Arzneimitteln oder eine Funktion von Medizinprodukten verlassen, die jedoch nicht eintritt (2, 3). Hinzu kommt das Problem des Handels mit illegalen Heilmitteln, insbesondere mit gefälschten Arzneimitteln, die keine oder verunreinigte Wirkstoffe enthalten können (4).
Gewährleistung von Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität
Aufgrund ihres Risikopotenzials ist das Inverkehrbringen von Arzneimitteln und Medizinprodukten gesetzlich reguliert. Der Gesetzgeber sieht insbesondere bestimmte Verfahren für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Schutz der Gesundheit vor. Die Grundlage für das Inverkehrbringen sowie weiterer Pflichten bildet das Heilmittelgesetz (HMG) (5), welches als Rahmengesetz durch eine Vielzahl verschiedener Rechtsverordnungen, sonstiger Verwaltungsverordnungen und Wegleitungen als Ausführungsrecht konkretisiert und ergänzt wird (6). Die Ziele des Heilmittelrechts sind in Art. 1 HMG festgelegt. In diesem Zweckartikel wird aufgeführt, was Gegenstand des Heilmittelrechts ist. So legt Art. 1 Abs. 1 HMG fest, dass das HMG gewährleisten soll, dass zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier nur qualitativ hochstehende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr gebracht werden.
Daneben verfolgt das Heilmittelgesetz in Art. 1 Abs. 2 HMG noch weitere Ziele, wie etwa der Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten von Heilmitteln vor Täuschungen, insbesondere aufgrund von nicht erwiesenen oder irreführenden Wirkaussagen (lit. a), oder das Ziel, dass die in Verkehr gebrachten Heilmittel ihrem Zweck entsprechend und massvoll verwendet werden sollen (lit. c). Zudem soll das HMG dazu beitragen, dass eine sichere und geordnete Versorgung mit Heilmitteln, einschliesslich der dafür benötigten fachlichen Informationen und Beratung, in der Schweiz angeboten wird (Art. 1 Abs. 2 lit. c HMG). Zudem sind beim Vollzug des HMG noch weitere Zwecke zu beachten, so die Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit der schweizerischen Heilmittelkontrolle, die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Forschung und Entwicklung im Heilmittelbereich sowie die Anwendung der gleichen gesetzlichen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für alle Marktpartner in der Schweiz (Art. 1 Abs. 3 HMG). Die genannten Zwecke werden jeweils durch spezifische Vorschriften im HMG und dem dazugehörigen Ausführungsrecht ausgestaltet und konkretisiert (7). Auch wenn die Kosten für Heilmittel für den Gesundheitssektor zu den wesentlichen Ausgaben gehören, sind sämtliche Fragen der Finanzierung, der Kostenerstattung oder der Preiskontrolle nicht Gegenstand des Heilmittelrechts, sondern ausschliesslich des Krankenversicherungsrechts (8). Daher sind sie im Krankenversicherungsgesetz (KVG) und dem dazugehörigen Ausführungsrecht geregelt (9).
Unterschiedliche Regulierung von Arzneimitteln und Medizinprodukten
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Wirkweise sieht das HMG und das dazugehörige Ausführungsrecht unterschiedliche Vorgaben für Arzneimittel und Medizinprodukte insbesondere im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen sowie für verschiedene Pflichten nach ihrem Inverkehrbringen vor. Daher enthält das HMG jeweils zwei spezifische Kapitel: für Arzneimittel Kapitel 2 (Art. 5I–44 HMG) und für Medizinprodukte Kapitel 3 (Art. 45I–51 HMG). Die Kapitel 1 und 4 enthalten Bestimmungen für beide Produktkategorien. Aufgrund des Umfangs der jeweiligen Artikel fällt bereits auf, dass Arzneimittel umfangreicher reguliert sind als Medizinprodukte. Neben einer Vielzahl von speziellen Bestimmungen zu Bewilligungen und Zulassungen sind insbesondere Vertrieb, Verschreibung, Abgabe und Anwendung sowie Werbung und Preisvergleiche für Arzneimittel geregelt. Speziell für Arzneimittel sieht das HMG eine vorgängige Prüfung in Form einer präventiven Zulassung durch verschiedene Zulassungsverfahren vor, welche sich grundsätzlich danach unterscheiden, ob das Arzneimittel neu ist und erstmals zugelassen werden soll oder ob es sich um ein sog. Nachfolgeprodukt eines bereits zugelassenen Arzneimittels handelt.
Begriffe der Arzneimittel und Medizinprodukte
Arzneimittel
Der Begriff des Arzneimittels umfasst verschiedene Arzneimittelformen. In Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG sind Arzneimittel definiert als «Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind oder angepriesen werden, insbesondere zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen», wobei zu den Arzneimitteln auch Blut- und Blutprodukte gehören (10). Die verschiedenen Arzneimittelformen umfassen zunächst Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs (Biopharmazeutika). Chemischen Ursprungs sind chemische Elemente und ihre chemischen Verbindungen, wobei es nicht darauf ankommt, ob diese natürlich vorkommen oder synthetisch erzeugt werden (11). Als anorganisch gelten Stoffe und ihre Gemische, die aus der unbelebten Natur stammen, während organische Stoffe der belebten Natur zuzurechnen sind, so Menschen, Tiere und Pflanzen sowie Mikroorganismen (11). Unter Produkte biologischen Ursprungs fallen auch Stoffe und Stoffgemische, die mittels der Biotechnologie hergestellt worden sind, wie etwa Proteine, die mittels gentechnologischer Verfahren hergestellt werden (11).
Eine weitere Unterscheidung betrifft – neben den Human- und Veterinärarzneimitteln – die Anscheins- und Funktionsarzneimittel. Anscheinsarzneimittel werden auch als Präsentationsarzneimittel bezeichnet, Funktionsarzneimittel auch als Bestimmungsarzneimittel (12). Aus dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG, «Produkte», die «zur medizinischen Einwirkung […] bestimmt sind oder angepriesen werden», wird aufgrund des Wortes «oder» deutlich, dass es sich um zwei verschiedene Produktformen handelt. Nach dieser Unterscheidung muss ein Produkt entweder zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sein oder es muss als solches angepriesen werden, damit ein Arzneimittel vorliegt. Der Zweck eines Arzneimittels bestimmt sich folglich entweder nach den Eigenschaften seiner Stoffe oder Stoffzusammensetzung oder nach der Anpreisung des Herstellers oder Inverkehrbringers.
Bei der Frage, ob eine Anpreisung vorliegt, wird auf die sog. subjektive Zweckbestimmung abgestellt, die durch die Aufmachung bzw. Präsentation des Produkts zum Ausdruck kommt, wie etwa das Anbieten, die Kennzeichnung oder die Bewerbung des Produkts als Arzneimittel, in dem ihm z. B. Wirkaussagen zugeschrieben werden (12). Hieraus ergibt sich, dass ein Produkt auch dann als Arzneimittel gilt, wenn es entsprechend angepriesen wird, also beworben oder aufgemacht ist, und dies selbst dann, wenn es an einer medizinischen Einwirkung fehlt. In diesem Fall ist das Produkt nicht wirksam und wird daher auch keine Zulassung erhalten oder abgegeben werden können. Infolgedessen wird das Produkt als Arzneimittel mangels Zulassung nicht verkehrsfähig sein und darf nicht abgegeben werden (12). Blut und Blutprodukte, wie z. B. Blutplasma und Zellpräparate, sind keine Produkte chemischen oder biologischen Ursprungs. Sie werden aber nach Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG zu den Arzneimitteln gezählt und unterstehen damit den Regelungen des Heilmittelrechts und des einschlägigen Verordnungsrechts.
Medizinprodukte
Das Heilmittelgesetz enthält in Art. 4 Abs. 1 lit. b HMG eine Legaldefinition für Medizinprodukte. Danach sind Medizinprodukte «Produkte, einschliesslich Instru- mente, Apparate, In-vitro-Diagnostika, Software und andere Gegenstände oder Stoffe, die für die medizinische Verwendung bestimmt sind oder angepriesen werden und deren Hauptwirkung nicht durch ein Arzneimittel erreicht wird». Medizinprodukte werden näher in der Medizinprodukteverordnung (MepV) geregelt (13). Art. 3 Abs. 1 MepV enthält eine im Vergleich zu HMG 4 Abs. 1 lit. b weitergehende und detailliertere Legaldefinition. Medizinprodukte werden in unterschiedliche Gruppen und Risikoklassen eingeteilt, wonach sich die Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Leistungsfähigkeit je nach Einteilung unterscheiden (14).
Abgrenzungsfragen
Abgrenzungsfragen stellen sich hinsichtlich Arzneimittel und Medizinprodukt sowie insbesondere im Hinblick auf Arzneimittel und Lebensmittel sowie Kosmetika (15). Für die Abgrenzung zwischen Arzneimittel und Medizinprodukt stellt bereits Art. 4 Abs. 1 lit. b HMG fest, dass ein Produkt sowohl Arzneimittel als auch Medizinprodukt sein kann (15). Gleichwohl muss jedoch ein Produkt einer Kategorie zugerechnet werden, da feststehen muss, ob es als Arzneimittel einzuordnen ist und mithin einer Zulassung für das Inverkehrbringen bedarf oder nicht (15). Für die Frage der Kategorisierung wird auf die Hauptwirkung des Produkts abgestellt. Massgebliches Kriterium für das Vorliegen eines Medizinprodukts ist danach, ob das Produkt zur Anwendung beim Menschen bestimmt ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a MepV) und die bestimmungsgemässe Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper nicht durch ein Arzneimittel i.S.v. Art. 4 Abs. 1 lit. b HMG, d.h. durch pharmakologische, immunologische oder metabolische Mittel (Art. 3 Abs. 1 lit. b MepV), erreicht wird (15). Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein (15).
Noch schwieriger kann die Abgrenzung zwischen Arzneimittel und Lebensmittel oder Kosmetika sein. Dies betrifft beispielsweise angereicherte Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel sowie Lebensmittel oder Kosmetika mit einer höheren Dosierung, z. B. einer höheren Fluoridkonzentration bei Zahnpasta oder Mundspüllösungen (15). Lebensmittel können wie manche Arzneimittel in den menschlichen Körper aufgenommen werden und können dort ebenfalls eine Wirkung auf den Organismus entfalten (15). Hier stellt sich für die Abgrenzung die Frage, ob diese Wirkung auf den Organismus einer pharmakologischen Wirkung gleichkommt. Lebensmittel sind nach der Legaldefinition des Art. 4 Abs. 1 LMG (16) «alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen sich vernünftigerweise vorhersehen lässt, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden». Die Abgrenzung erfolgt über den Ausschluss des Heilmittels aus dem Anwendungsbereich des Lebensmittelrechts in Art. 2 Abs. 2 lit. d LMG. Die Abgrenzung zwischen Lebensmittel und Arzneimittel bestimmt sich folglich nach den Definitionen des Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG: Erfüllt ein Stoff die Definition eines Arzneimittels, d.h., weist er eine medizinische Einwirkung auf, ist er kein Lebensmittel. Die medizinische Einwirkung, auch pharmakologische Wirkung, auf den Organismus ist daher das Entscheidungskriterium, was die Abgrenzungsschwierigkeiten im Einzelfall deutlich machen. Jedenfalls fallen Nahrungsergänzungsmittel, die zur medizinischen Einwirkung auf den Organismus angepriesen werden, unabhängig von ihrer Zusammensetzung unter den Begriff der Arzneimittel nach Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG (17). Eine klare Einordnung der Produkte ist jedoch vor dem Hintergrund von Bedeutung, dass Arzneimittel grundsätzlich eine Zulassung benötigen (Art. 9 Abs. 1 HMG), Lebensmittel jedoch nicht. Ein Produkt kann daher nicht zugleich Lebensmittel und Arzneimittel sein. Es gilt insofern das Entweder-oder-Prinzip (15).
Umgang mit Heilmitteln
Das HMG regelt in Art. 2 Abs. 1 HMG den Umgang mit Arzneimitteln und Medizinprodukten und enthält für beide Bereiche allgemeine Vorschriften, welche durch spezifische Regelungen auf Verordnungsstufe konkretisiert werden. Der Begriff des Umgangs wird weder im HMG noch im Verordnungsrecht definiert. Entsprechend der Zielsetzung nach Art. 1 Abs. 1 HMG ist der Begriff des Umgangs mit Heilmitteln jedoch weit zu verstehen und umfasst die Herstellung, die Ein- und Ausfuhr sowie den Handel mit Heilmitteln. Mit dem Begriff des Umgangs werden sowohl staatliche als auch private Tätigkeiten im Zusammenhang mit Heilmitteln in der Schweiz erfasst (18). In Art. 4 Abs. 1 lit. c, d, e und f HMG finden sich Legaldefinitionen der Begriffe Herstellen, Inverkehrbringen, Vertreiben und Abgeben. Das Herstellen (Art. 4 lit. c HMG) von Heilmitteln umfasst nach Art. 4 Abs. 1 lit. c HMG Arbeitsgänge der Heilmittelproduktion und mithin auch Qualitätskontrollen, das Lagern und Verpacken sowie die Freigabe und die Auslieferung (18). Das Herstellen umfasst damit nicht nur den Herstellungsprozess eines Heilmittels. Die Herstellung muss nach Art. 3 lit. o AMBV den Internationalen Regeln der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) entsprechen (20).
Die Abgrenzung zwischen Herstellen und Vertreiben ist folglich unscharf, da der weite Herstellungsbegriff auch Teile bzw. Vorstufen des Vertreibens umfasst. Das Inverkehrbringen meint nach Art. 4 Abs. 1 lit. d HMG das Vertreiben und das Abgeben. Das Vertreiben kann nach Art. 4 Abs. lit. e HMG als Übertragen oder Überlassen eines Heilmittels, mit Ausnahme des Abgebens, verstanden werden (21). Es kommt nur auf die tatsächliche faktische Zurverfügungstellung des Produkts an, sodass es unerheblich ist, ob das Übertragen oder Überlassen entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Das Abgeben umfasst nach Art. 4 Abs. 1 lit. f HMG die Übertragung oder Überlassung eines verwendungsfertigen Heilmittels an die Endverbraucher, welche das Heilmittel an sich oder anderen anwenden. Anders als die vorgenannten Schritte bezieht sich das Abgeben nur auf verwendungsfertige Heilmittel und nicht auf Vorstufen. Im Hinblick auf Arzneimittel kommt dem Abgeben die Bedeutung der Verabreichung zu, bei Medizinprodukten die Inbetriebnahme (22).
Systematik des Heilmittelrechts
Das Heilmittelgesetz regelt im ersten Kapitel in den Art. 1 bis 4 HMG die Zweckbestimmung, die Sorgfaltspflichten sowie Begriffsbestimmungen und somit allgemeine Bestimmungen, die sowohl für Arzneimittel als auch für Medizinprodukte gelten. Das zweite Kapitel regelt in den Art. 5 bis 44 HMG die Arzneimittel, während das dritte Kapitel in den Art. 45 bis 51 Vorschriften für Medizinprodukte umfasst. Das vierte Kapitel enthält in den Art. 52 bis 67 HMG wiederum gemeinsame Bestimmungen für Arzneimittel und Medizinprodukte, während das fünfte Kapitel in den Art. 82 und 83 HMG Vorschriften zum Eidgenössischen Heilmittelinstitut Swissmedic vorsieht. Schliesslich enthält das siebte Kapitel in den Art. 84 und 85 HMG Regelungen zum Verwaltungsverfahren, während das achte Kapitel in den Art. 91 bis 96 HMG Strafbestimmungen bei Verstössen normiert. Neben den Bestimmungen des HMG als Rahmengesetz ist das Heilmittelrecht durch eine Vielzahl von Verordnungen des Bundesrates sowie durch Verwaltungsverordnungen von Swissmedic geprägt. Hinzu kommen noch Anleitungen, Merkblätter und Informationen von Swissmedic (23). Bei der Systematik des HMG fällt auf, dass der grösste Anteil der Bestimmungen auf den Bereich der Arzneimittel fällt. Dies beruht darauf, dass Arzneimittel aufgrund ihres im Vergleich zu den Medizinprodukten grundsätzlich grösseren Risiko- bzw. Gefahrenpotenzials einer umfangreicheren Regulierung, so insb. eines Zulassungsverfahrens, bedürfen.
Arzneimittel
Grundsätze
Für Arzneimittel gelten separate Regulierungen, welche im HMG einen grösseren Raum einnehmen als jene für Medizinprodukte. So statuieren die Art. 5 bzw. 18 ff. HMG sowohl für die Herstellung als auch die Einfuhr, Ausfuhr und den Handel mit Arzneimitteln in der Schweiz Bewilligungspflichten. Daneben enthält Art. 9 Abs. 1 HMG den Grundsatz, wonach verwendungsfertige Arzneimittel nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie von Swissmedic zugelassen sind.
Aus rechtlicher Sicht handelt es sich sowohl bei den Bewilligungen als auch bei den Zulassungen um mitwirkungsbedürftige Verfügungen, d.h., eine Verfügung kann nur aufgrund eines Gesuchs ergehen. Es handelt sich zudem um Polizeiverfügungen, d.h., es besteht grundsätzlich kein Ermessen von Swissmedic, sodass eine Bewilligung bzw. Zulassung zu erteilen ist, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Erteilung vorliegen (24). Zudem dürfen andere als die gesetzlich genannten Voraussetzungen nicht eingebracht oder berücksichtigt werden (25). Der Unterschied zwischen Bewilligung und Zulassung besteht darin, dass sich die Bewilligung grundsätzlich auf den Inverkehrbringer bezieht, während die Zulassung für das Produkt (Arzneimittel) erforderlich ist.
Bewilligungen
Art. 5 Abs. 1 HMG sieht vor, dass für die Herstellung von Arzneimitteln eine Bewilligung von Swissmedic erforderlich ist. Die Herstellung stellt eine private Erwerbstätigkeit dar, welche unter den Schutz der Wirtschaftsfreiheit gem. Art. 27 BV fällt, da aufgrund der Bewilligungspflicht für die Herstellung von Arzneimitteln die Ausübung der Wirtschaftsfreiheit eingeschränkt wird. Diese Einschränkung ist jedoch nur dann zulässig, wenn sie gem. Art. 36 BV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist. Die Vorschriften des Heilmittelrechts, welche den Schutz der öffentlichen Gesundheit bezwecken, genügen diesen Anforderungen, da die Bewilligungspflicht dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dient und gesundheitspolizeilich ausgerichtet ist (26). So ist nach Art. 6 Abs. 1 HMG eine Bewilligung zu erteilen, wenn die erforderlichen fachlichen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (lit. a) und ein geeignetes Qualitätssicherungssystem vorhanden ist (lit. b). Die Einfuhr und Ausfuhr sowie der Handel im Ausland bestimmen sich nach Art. 18 HMG ff., welche ebenfalls eine Bewilligungspflicht vorsehen.
Zulassungspflicht und Ausnahmen
Art. 9 Abs. 1 HMG statuiert den Grundsatz, wonach verwendungsfertige Arzneimittel für ihr Inverkehrbringen grundsätzlich eine Zulassung durch Swissmedic benötigen (Grundsatz der Zulassungspflicht). Auch die Zulassungspflicht stellt einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV dar, welche jedoch ebenfalls wie die Bewilligungspflicht zulässig ist (27). Dem Zulassungsentscheid geht ein aufwendiges Zulassungsverfahren voraus, welches als präventives Kontrollverfahren ausgestaltet ist, sodass eine Zulassung grundsätzlich präventiv, d.h. vor Abgeben oder Inverkehrbringen, erfolgen muss (28). Im Hinblick auf den Grundsatz der Zulassungspflicht nach Art. 9 Abs. 1 HMG gelten zahlreiche Ausnahmen, welche in Art. 9 Abs. 2 HMG normiert sind. Hierunter fallen insbesondere die sog. Formula-Arzneimittel (29).
Bei der Herstellung der Formula-Arzneimittel sind die anerkannten Regeln der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft zu beachten (30). So benötigen Arzneimittel, die in einer öffentlichen Apotheke oder in einer Spitalapotheke in Ausführung einer ärztlichen Verschreibung für eine bestimmte Person oder einen bestimmten Personenkreis hergestellt werden (Formula magistralis), nach Art. 9 Abs. 2 lit. a HMG keine Zulassung. Das Gleiche gilt nach Art. 9 Abs. 2 lit. b HMG für Arzneimittel, die in einer öffentlichen Apotheke, einer Spitalapotheke, einer Drogerie oder in einem anderen Betrieb, der über eine Herstellungsbewilligung verfügt, nach einem anerkannten Arzneibuch oder Formularium ad hoc oder defekturmässig hergestellt werden und die für die Abgabe an die eigene Kundschaft bestimmt sind (Formula officinalis). Ebenso keine Zulassung benötigen insbesondere Arzneimittel für klinische Versuche (Art. 9 Abs. 2 lit. d HMG) sowie Arzneimittel, die nicht standardisierbar sind (Art. 9 Abs. 2 lit. e HMG).
Zulassungsverfahren
Hintergrund
Nach dem Grundsatz der Zulassungspflicht nach Art. 9 Abs. 1 HMG dürfen Arzneimittel nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie vorgängig von Swissmedic zugelassen sind, sodass nur Arzneimittel auf den Markt kommen dürfen, die den gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität i.S.v. Art. 1 Abs. 1 HMG genügen. Der Zulassung geht grundsätzlich eine eingehende Prüfung voraus, ob ein Arzneimittel den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen entspricht und zugelassen wird. Dazu muss für das Arzneimittel, für das eine Zulassung von Swissmedic beantragt wird, eine umfangreiche Dokumentation, das sog. Datendossier, mit den Ergebnissen der präklinischen und klinischen Studien (Phase I–III) bei Swissmedic eingereicht werden, aufgrund dessen die Wirksamkeit, die Qualität und die Sicherheit des Arzneimittels durch Swissmedic geprüft werden können. Die Zulassungsverfahren sind in den Art. 10-14 HMG sowie in der Arzneimittel-Zulassungsverordnung (AMZV) geregelt (31).
Sicherheit als Nutzen-Risiko-Abwägung
Eine Zulassung wird nur erteilt, wenn das Arzneimittel hinreichend sicher ist. Gefordert wird jedoch keine absolute Sicherheit, da ansonsten die Arzneimittelverfügbarkeit sehr eingeschränkt wäre. Selbst bei zugelassenen Arzneimitteln können bei bestimmungsgemässer Verwendung unerwünschte Wirkungen, insbesondere Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, auftreten. Damit bleibt grundsätzlich ein sozialadäquates Restrisiko. Im Hinblick auf die Sicherheit kann daher nur eine relative Sicherheit verlangt werden, welche sich nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung beurteilt (32). Die Sicherheit ist folglich nicht juristisch zu bestimmen, sondern ist ein medizinisch pharmakologischer Begriff.
Ordentliches Zulassungsverfahren
Für alle neuen Arzneimittel, die in der Schweiz erstmals in Verkehr gebracht werden sollen, bedarf es nach Art. 9 Abs. 1 HMG grundsätzlich einer Zulassung. Hier kommt das ordentliche Zulassungsverfahren, auch Erstzulassung genannt, zur Anwendung, welches in den Art. 10 und 11 HMG statuiert ist. So bestimmt Art. 10 HMG in abschliessender Weise die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von verwendungsfertigen Arzneimitteln i.S.v. Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG. Aufgrund des Zulassungsgesuchs muss Swissmedic in der Lage sein zu beurteilen, ob das Arzneimittel oder das Verfahren i.S.v. Art. 1 HMG qualitativ hochstehend, sicher und wirksam ist. Danach muss der Gesuchsteller belegen, dass das Arzneimittel qualitativ hochstehend, sicher und wirksam ist (lit. a), er über eine entsprechende Herstellungs-, Einfuhr- oder Grosshandelsbewilligung (lit. b) sowie über einen Wohnsitz, Geschäftssitz oder Niederlassung in der Schweiz (lit. c) verfügt.
Für bereits zugelassene Wirkstoffe gilt je nach Art und Umfang der Neuerung das ordentliche Zusalleungsverfahren nach Art. 10 HMG oder das vereinfachte Verfahren nach Art. 14 HMG. Folglich kann auch bei bereits zugelassenen Arzneimitteln ein ordentliches Zulassungsverfahren in Betracht kommen, wenn sich beispielsweise die Indikation, die Dosierung oder die Verabreichungsform ändern. Bei der Zulassung handelt es sich um eine Polizeiverfügung, d.h., Swissmedic kommt kein Ermessen zu, vielmehr besteht ein Rechtsanspruch auf Zulassung, wenn die Voraussetzungen nach Art. 10 HMG erfüllt sind (33). Das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen ist durch den Gesuchsteller zu beweisen und durch Einreichung der entsprechenden Dokumentation im Zulassungsgesuch nach Art. 11 HMG nachzuweisen (33). Das Zulassungsgesuch muss nach Art. 11 Abs. 1 lit. a bis c HMG sämtliche für die Beurteilung wesentlichen Angaben und Unterlagen enthalten, so insbesondere die Indikation(en), die Bezeichnung des Arzneimittels (lit. a), den Hersteller oder den Vertreiber (lit. b) sowie die Herstellungsmethode, die Zusammensetzung, die Qualität und die Haltbarkeit (lit. c). Welche sonstigen Angaben und Unterlagen mit Gesuch auf Zulassung bei Swissmedic einzureichen sind, bestimmt sich nach Art. 11 Abs. 2 HMG, so insbesondere die Ergebnisse der präklinischen und klinischen Prüfungen, die Heilwirkungen und die unerwünschten Wirkungen, die Kennzeichnung, die Arzneimittelinformation sowie die Abgabe- und die Anwendungsart. Einzelheiten sind in der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln AMZV geregelt (31). So bestimmen die Art. 3 ff. AMZV die Anforderungen an die Dokumentation für die Zulassung eines Humanarzneimittels.
Da die Entwicklung und Zulassung eines neuen Arzneimittels mit hohen Investitionskosten verbunden ist, wird ein sog. Unterlagenschutz, auch Erstanmelderschutz genannt, nach den Art. 1a ff. HMG gewährt, bei dem es sich um ein arzneimittelrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht handelt (34). Der Erstanmelderschutz soll vertrauliche Daten, die ein Erstanmelder im Rahmen der Zulassung vorzulegen hat und die oft unter erheblichen Investitionen erstellt worden sind, vor unlauterer gewerblichen Verwendung schützen (35). Der Unterlagen- bzw. Erstanmelderschutz ist nicht mit den immaterialgüterrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechten zu verwechseln, die sich nicht nach Heilmittelrecht, sondern nach Immaterialgüterrecht bestimmen.
Vereinfachtes Zulassungsverfahren
Für bestimmte Kategorien von Arzneimitteln ist nach Art. 14 HMG ein vereinfachtes Zulassungsverfahren vorgesehen, «wenn dies mit den Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit vereinbar ist». Die vereinfachte Zulassung beruht aus rechtlicher Sicht auf dem Verhältnismässigkeitsprinzip, da für bestimmte Arten von Arzneimitteln ein ordentliches Verfahren unverhältnismässig wäre. So listet Art. 14 Abs. 1 HMG eine Reihe von Arzneimittelkategorien auf, für die eine vereinfachte Zulassung gilt. Die Liste ist nicht abschliessend, wie durch den Hinweis «insbesondere» bei der Auflistung deutlich wird. Ein vereinfachtes Zulassungsverfahren nach Art. 14 Abs. 1 HMG ist beispielsweise für Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen (lit. a) oder Arzneimittel mit langjähriger medizinischer Verwendung (lit. ater) sowie für Komplementärarzneimittel (lit. b), Phytoarzneimittel (lit. cbis) und Arzneimittel für den Spitalbedarf (lit. d) vorgesehen. Zudem gilt ein vereinfachtes Verfahren auch für Arzneimittel für seltene Krankheiten (lit. f). Die vereinfachten Zulassungsverfahren sind sowohl auf Gesetzes- als auch auf Verordnungsstufe durch Verordnungen des Bundesrats und von Swissmedic detailliert geregelt.
Einer der wichtigsten Anwendungsfälle des vereinfachten Verfahrens gilt nach Art. 14 Abs. 1 lit. a HMG für Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen. Nach Art. 12 Abs. 1 VAZV kann ein Arzneimittel vereinfacht zugelassen werden, dessen Wirkstoff in einem Arzneimittel enthalten ist, das von Swissmedic zugelassen ist oder war (bekannter Wirkstoff). Es handelt sich hierbei um ein Arzneimittel, dessen Wirkstoff in einem Arzneimittel enthalten ist, welches von Swissmedic bereits zugelassen war, sodass damit in erster Linie Generika umfasst sind. Die Zulassung eines Arzneimittels im Rahmen eines ordentlichen Zulassungsverfahrens stellt aufgrund der umfangreichen Dokumentationspflichten und den damit verbundenen Nachweisen, insbesondere aufgrund des Erfordernisses der präklinischen und klinischen Studien, einen grossen zeitlichen Aufwand mit hohen Kosten dar.
Die Vereinfachung des Zulassungsverfahrens besteht darin, dass sich das Arzneimittel als Nachfolgeprodukt unter bestimmten Voraussetzungen auf die bereits eingereichten Zulassungsunterlagen der Erstzulassung abstützen, d.h. referenzieren, kann. Voraussetzung für eine vereinfachte Zulassung ist, dass das Nachfolgeprodukt mit dem bereits zugelassenen Produkt im Wesentlichen gleich i.S. der Bioverfügbarkeit ist und der sog. Erstanmelderschutz bzw. Unterlagenschutz entweder bereits abgelaufen ist oder der Inhaber der Erstzulassung der Referenzierung auf die Unterlagen seines Zulassungsgesuchs zustimmt (36). Die Referenzierung kann daher nicht uneingeschränkt vorgenommen werden.
Nach Art. 12 Abs. 1 HMG kann sich das Gesuch um Zulassung eines Arzneimittels, das im Wesentlichen gleich ist wie ein Arzneimittel, dessen Unterlagen nach Art. 11a und 11b HMG im Rahmen des Unterlagenschutzes geschützt ist, nur auf die Ergebnisse dessen pharmakologischer, toxikologischer und klinischer Prüfungen stützen, wenn der Inhaber der Zulassung des Arzneimittels mit Unterlagenschutz schriftlich zustimmt (lit. a) oder der Schutz der entsprechenden Unterlagen abgelaufen ist (lit. b). Der Unterlagenschutz legt vereinfacht dargelegt fest, in welchen Zeiträumen keine automatische Referenzierung auf die bei Swissmedic vorliegenden Unterlagen der Erstzulassung referenziert werden darf.
Hintergrund des Unterlagen- oder Erstanmelderschutzes ist, dass vertrauliche Daten, die ein Erstanmelder im Rahmen der Zulassung vorzulegen hat und die oft unter erheblichen Investitionen erstellt worden sind, vor unlauterer gewerblicher Verwendung geschützt werden sollen. Der Schutz soll so lange währen, bis ein Zweitanmelder sich zulässigerweise auf die Daten stützen darf, sei es auf- grund einer finanziellen Gegenleistung im Einvernehmen mit dem Erstanmelder, sei es nach Ablauf einer gewissen Zeitdauer (37).
Pharmakovigilanz
Trotz der umfassenden Prüfung der Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität von Arzneimitteln im Rahmen des Zulassungsverfahrens durch Swissmedic können Arzneimittel weitere Risiken aufweisen, die erst nach Inverkehrbringen, d.h. nach der Markteinführung aufgrund einer breiteren Anwendung, auftreten. (38) Dies betrifft insbesondere das Auftreten seltener Risiken, die im Rahmen der klinischen Studien aufgrund der begrenzten Probandenzahl nicht erkennbar waren (39). Die Sicherheit eines Arzneimittels i.S. der Nutzen-Risiko-Abwägung muss dsomit fortlaufend durchgeführt werden. Daher statuieren die Art. 58 ff. HMG verschiedene Überwachungspflichten, so die behördliche Marktüberwachung (Art. 58 HMG) sowie Meldepflichten, Meldesysteme und Melderechte, die sog. Pharmakovigilanzpflichten (Art. 59 HMG).
Medizinprodukte
Grundsätze
Medizinprodukte müssen entsprechend den Vorgaben nach Art. 1 Abs. 1 HMG ebenfalls qualitativ hochstehend, sicher und wirksam sein. Für ihr Inverkehrbringen bedarf es jedoch im Vergleich zu den Arzneimitteln keiner vorgängigen Zulassung. Damit können Medizinprodukte ohne vorherige behördliche Zulassung durch Swissmedic in Verkehr gebracht werden. Zudem können auch Medizinprodukte, welche sich in der EU rechtmässig in Verkehr befinden, grundsätzlich auch in die Schweiz importiert werden. Für Medizinprodukte stützt sich die Schweiz folglich auf die Vorgaben des Systems der Konformitätsbewertung der EU ab. Die Schweiz hat das Medizinprodukterecht der EU, mit welchem eine europäische Harmonisierung in den EU-Mitgliedstaaten erreicht wurde, in nationales Recht umgesetzt und in Detailfragen auf das EU-Recht verwiesen (40). Dies bedeutet, dass die Begriffsdefinition für Medizinprodukte in der Schweiz mit denen in den EU-Mitgliedstaaten übereinstimmen muss. Aus diesem Grund werden Medizinprodukte in unterschiedliche Kategorien, sog. Risikoklassen, eingeteilt, die sich nach dem jeweiligen Risikoprofil richten. Entsprechend sind unterschiedliche Bewertungsverfahren vorgesehen, sodass Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechend der jeweiligen Klassifizierung verschieden sein können. Unterschieden wird entsprechend den EU-Regelungen zwischen Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika. Anders als Arzneimittel durchlaufen Medizinprodukte somit keine behördliche Zulassung, sodass sich die Aufgaben von Swissmedic im Bereich Medizinprodukte auf eine Marktüberwachung beschränken (41).
Inverkehrbringen
Die Anforderungen an Medizinprodukte sind in Art. 45 HMG normiert. Danach darf ein Medizinprodukt bei seiner bestimmungsgemässen Verwendung die Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender, der Konsumentinnen und Konsumenten, Patientinnen und Patienten sowie Dritter nicht gefährden (Abs. 1). Zudem muss derjenige, der ein Medizinprodukt in Verkehr bringt, nachweisen können, dass es die grundlegenden Anforderungen erfüllt (Abs. 2). Das Inverkehrbringen von Medizinprodukten regeln des Weiteren die Bestimmungen der MepV. So enthält Art. 4 lit. b MepG eine Legaldefinition des Inverkehrbringens, wonach hierunter «jede erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Schweizer Markt» zu verstehen ist. Nach Art. 6 Abs. 1 MepV darf ein Medizinprodukt «nur in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn es bei sachgemässer Lieferung, korrekter Installation und Instandhaltung und bei seiner Zweckbestimmung entsprechender Verwendung» den Vorgaben der MepV entspricht.
Konformitätsbewertungsverfahren
Für Medizinprodukte ist zwar kein Zulassungsverfahren vorgesehen, jedoch müssen Medizinprodukte ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, welches in Art. 46 HMG geregelt ist. Der Inverkehrbringer eines Medizinprodukts muss nach Art. 46 Abs. 1 HMG nachweisen, dass die erforderlichen Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt worden sind. Die Konformität der Medizinprodukte zu den EU-Normen wird von privaten Stellen bewertet. Ist eine Konformitätsbewertung erfolgt, so erhält das Medizinprodukt das CE-Zeichen (42). Im Hinblick auf den freien Warenverkehr mit Medizinprodukten gilt eine einseitige Anerkennung des CE-Zeichens: Während Medizinprodukte, welche in der EU mit einem CE-Zeichen in Verkehr gebracht werden, aufgrund der Warenverkehrsfreiheit im EU-Binnenmarkt frei zirkulieren können, gilt dies für die Schweiz nur einseitig: Medizinprodukte aus der EU mit CE-Zeichen können auch in der Schweiz in Verkehr gebracht werden. Da das Konformitätsbewertungsverfahren durch private Stellen erfolgt, kommt Swissmedic nur die Aufgabe der Benennung und Überwachung der Konformitätsbewertungsstellen im Rahmen einer Marktüberwachung zu (42).
Innovationsschutz und Patente
Immaterialgüterrechte im Gesundheitssektor
Grundsätzlich ergeben sich im Gesundheitssektor keine Besonderheiten im Hinblick auf den Immaterialgüterschutz. So bestehen für Arzneimittel und Medizinprodukte die gleichen Schutzrechte wie auch für andere Produkte. Technische Erfindungen können unter den Voraussetzungen des Patentrechts patentiert werden, Bezeichnungen können unter den Schutz des Markenrechts fallen und u.U. kann auch ein urheberrechtlicher Schutz in Betracht kommen. Das häufigste und bedeutendste Immaterialgüterrecht, welches zum Schutz von Erfindungen im Heilmittelbereich zur Anwendung kommt, ist das Patent. Das Patentrecht sorgt durch Gewährung eines Ausschliesslichkeitsrechts an neuen, nicht naheliegenden und gewerblich anwendbaren Erfindungen für Anreize zum Tätigen von Erfindungen und für deren Offenlegung oder Vermarktung (43). Es folgt dem Erfinderprinzip und dem Prioritätsprinzip, wobei die materiellen Erteilungsvoraussetzungen durch das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE) nur eingeschränkt geprüft werden (43).
Innovationsförderung und Anreizfunktion
Immaterialgüterrechte, so insbesondere das Patent, weisen eine Schutz- und Anreizfunktion auf. Patente gewähren Rechte des geistigen Eigentums, verhindern dadurch Imitation der Erfindung und liefern somit einen Anreiz für Forschung und Entwicklung (F&E) durch die zeitlich begrenzte staatliche Garantie, Dritte von der Verwertung der Erfindung ausschliessen zu können (44). Ziel ist die Förderung von Innovation, die ohne den entsprechenden immaterialgüterrechtlichen Schutz unterbleiben würden. Ressourcen werden nur dann in die Forschung investiert, wenn die Forschungsergebnisse, namentlich Erfindungen, vor kommerzieller Verwendungen durch Nachahmer geschützt werden und die Möglichkeit besteht, die aufgewandten Ressourcen wieder einspielen zu können. Dies wird durch die Exklusivitätswirkung des Patents erreicht, welches Wettbewerber von der kommerziellen Nutzungsmöglichkeit der Erfindung ausschliesst. Patente stellen somit Ausschliesslichkeitsrechte dar, welche die kommerzielle Verwertung in Form einer gewerblichen Benützung ausschliesslich dem Patentinhaber zuweisen, sodass sie anderen übertragbaren absoluten Rechten, wie dem Urheberrecht, dem Markenrecht, dem Designrecht oder dem Sacheigentum, vergleichbar sind (45).
Aus ökonomischer Sicht soll ein Patent ein Marktfehler oder -versagen ausgleichen: Ohne Schutz durch die Exklusivitätswirkung unterbliebe die Investition und mithin die Innovation. Damit der Markt für Heilmittel nicht zum Erliegen kommt, sichert der Patentschutz den forschenden Unternehmen und Erfindern während der Patentlaufzeit ein Ausschliesslichkeitsrecht zu (46). Im Gegenzug für diese Exklusivität muss die Erfindung offengelegt werden, d.h., in der Patentschrift wird die Erfindung beschrieben, sodass es aufgrund dieser Offenlegung Dritten möglich ist, die Erfindung als Ausgangslage zu verwenden, um sie weiterzuentwickeln und zu forschen (46). Anstelle der Subventionierung z. B. von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen im Gesundheitssektor kann der Staat somit durch die entsprechende Ausgestaltung des Immaterialgüterschutzes entsprechend eine Verhaltenslenkung erreichen (Lenkungsfunktion).
Patentschutz
Das Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) schützt patentierbare Erfindungen (47). Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden nach Art. 1 Abs. 1 PatG Erfindungspatente erteilt. Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Es muss sich also um eine neue Erfindung handeln. Nach Art. 7 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Das Patent verschafft seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen (Art. 8 Abs. 1 PatG). Als Benützung gelten insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken (Art. 8 Abs. 2 PatG). Betrifft die Erfindung ein Herstellungsverfahren, so erstreckt sich die Wirkung des Patents auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (Art. 8a PatG).
Die Erteilung eines Patents hat jedoch keine Erlaubniswirkung, d.h., es stellt keine Erlaubnis zur Anwendung der geschützten Erfindung dar. Ob eine Erfindung ausgeführt werden darf, ist eine Frage des Regulierungsrechts (48). Für Arzneimittel und Medizinprodukte ist dies das Heilmittelrecht. Vielmehr bietet das Patent die Möglichkeit der (gewerbsmässigen) Benützung der geschützten Erfindung und das Recht, andere während der Patentlaufzeit von dieser Nutzung auszuschliessen (Exklusivitätswirkung oder Ausschliesslichkeitsrecht). Das Recht, anderen die gewerbsmässige Nutzung des Patents zu verbieten, besteht jedoch grundsätzlich nur während der Patentlaufzeit. Die Schutzdauer eines Patents beträgt 20 Jahre (Art. 14 Abs. 1 PatG). Ob eine Erfindung auch tatsächlich wirtschaftlich genutzt werden kann, bestimmt sich nach anderen Gesetzen: Für Arzneimittel sind dies die Vorschriften für das Inverkehrbringen i.S. der Zulassungsregelungen nach den Art. 10 ff. HMG. Gegenstand eines Patents im Bereich des Arzneimittelrechts können nicht nur Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen sein. Vielmehr kann die durch das Patent geschützte Erfindung auch u.a. auf das Herstellungsverfahren, die Galenik und in beschränktem Umfang auch auf die Verwendung des Heilmittels gestützt werden. Nach Art. 7c PatG können Stoffe oder Stoffgemische, die als solche, aber nicht in Bezug auf ihre Verwendung, in einem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren zum Stand der Technik gehören, als neu gelten, soweit sie nur für eine solche Verwendung bestimmt sind.
Forschungs-, Versuchs- und Zulassungsprivileg
Die Forschung mit patentgeschützten Wirkstoffen oder Wirkstoffkombinationen z. B. durch Hersteller von Nachfolgeprodukten verletzt das Patent grundsätzlich nicht, da sie keine kommerzielle Verwertung darstellen. Das Forschungs- und Versuchsprivileg nach Art. 9 PatG erlaubt es Generikahersteller, bereits während der Schutzdauer der noch patentgeschützten Originalarzneimittel Massnahmen für die Zulassung ihrer Generika vorzunehmen, so insbesondere Studien für die Vorbereitung des Zulassungsantrags im Wege des vereinfachten Verfahrens nach Art. 14 HMG. Mit der Revision des Patentrechts hat das Versuchsprivileg Eingang in das PatG gefunden. Nach Art. 9 Abs. 1 PatG erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf Handlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken, die der Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand der Erfindung einschliesslich seiner Verwendungen dienen. Des Weiteren ist jede wissenschaftliche Forschung am Gegenstand der Erfindung frei. Im Hinblick auf die Durchführung von präklinischen und klinischen Studien sieht Art. 9 Abs. 1 PatG ebenfalls eine Ausnahme vor: So erstreckt sich die Wirkung des Patents ebenso nicht auf Handlungen, die für die Zulassung eines Arzneimittels im Inland oder in Ländern mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle vorausgesetzt sind (Art. 9 Abs. 1 lit. d PatG).
Für Arzneimittel von besonderer Bedeutung ist das Zulassungsprivileg nach Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG. Danach erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf Handlungen, die für die Zulassung eines Arzneimittels im Inland oder in Ländern mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle vorausgesetzt sind. Da das patentrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers nach Ablauf der immaterialgüterrechtlichen Schutzrechte endet, können am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer Dritte den Patentinhaber mit seiner eigenen Erfindung, zum Beispiel einem Generikum, konkurrieren (49). Dies gilt dann, wenn keine weiteren Rechte bestehen, wie etwa der Unterlagenschutz. Weil Arzneimittel jedoch einer Zulassungspflicht unterliegen, können Dritte nur dann ein Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen, wenn sie an diesem Tag bereits über die arzneimittelrechtliche Zulassung für das betreffende Arzneimittel verfügen, sodass zulassungsrechtlich relevante Handlungen bereits vor Patentablauf vorgenommen werden dürfen (49).
Patentschutz und Unterlagenschutz
Der Patentschutz ist von der Zulassung zu unterscheiden: Das Patent schützt als gewerbliches Schutzrecht eine patentierbare Erfindung und gibt dem Inhaber ein Recht auf ausschliessliche Nutzung seiner Erfindung, indem er andere Nutzer während der Patentlaufzeit von einer Verwendung der Erfindung ohne Autorisierung durch den Patentinhaber ausschliessen kann. Die Nutzung des Patents richtet sich nach Privatrecht. Die Zulassung stellt dagegen das Recht zum Inverkehrbringen eines Produkts dar. Die Prüfung und Erteilung der Zulassung ist spezialpolizeiliche Aufgabe und richtet sich nach dem öffentlichen Recht. Dem Patentschutz kommt insbesondere im Pharmabereich eine sehr grosse Rolle zu: So können Patentinhaber die kommerzielle Verwertung z. B. generischer Produkte selbst dann verbieten, wenn der Unterlagenschutz bereits abgelaufen ist und Zulassungen im Rahmen des vereinfachten Zulassungsverfahrens nach Art. 14 HMG erteilt werden können, so lange wie ein immaterialgüterrechtlicher Schutz besteht.
Die Patentierung eines Arzneimittels ist daher nicht mit der Zulassung zu verwechseln: Auch ein patentgeschütztes Produkt benötigt eine Zulassung vor dem Inverkehrbringen. Umgekehrt prüft Swissmedic im Rahmen eines ordentlichen oder vereinfachten Zulassungsverfahrens nach den Art. 10 ff. HMG nicht, ob durch die Zulassung Patentrechte Dritter verletzt werden. Patentverletzungen müssen vom Patentinhaber auf zivilrechtlichem Weg geltend gemacht werden. Insgesamt sind daher zwei Schutzformen zu unterscheiden. Der regulatorische Schutz in Form des Unterlagenschutzes bestimmt sich nach dem Heilmittelrecht und mithin nach öffentlichem Recht. Der Patentschutz bestimmt sich nach Immaterialgüterrecht und folglich nach Privatrecht.
Ergänzendes Schutzzertifikat
Ausnahmen für einen zusätzlichen immaterialgüterrechtlichen Schutz bestehen für regulierte Bereiche, bei denen Produkte für das Inverkehrbringen einer Zulassung bedürfen: Dies betrifft neben Pflanzenschutzmitteln den Bereich der Arzneimittel. Produkte dieser beiden Bereiche müssen aufgrund ihres Risiko- oder Gefahrenpotenzials eine präventive (Polizei-)Kontrolle für ihr Inverkehrbringen im Rahmen eines Zulassungsverfahrens durchlaufen. Erst wenn ihre Wirkungen und Nebenwirkungen mittels Studien untersucht und nachgewiesen sind und eine Sicherheits- und Wirksamkeitsüberprüfung i.S. einer Risiko-Nutzen-Abwägung vorgenommen worden ist, wird über ihr Inverkehrbringen bzw. ihre Marktzulassung entschieden. Die Marktzulassung erfolgt i.d.R. in Form einer Polizeibewilligung. Damit muss bei zulassungspflichtigen Produkten eine Zulassung eingeholt werden, bevor die patentierte Erfindung kommerziell genutzt werden kann.
Da die Patentanmeldung i. d. R. vor dem Zulassungsverfahren erfolgt, um die Erfindung ausreichend zu schützen und um die Beanspruchbarkeit der Erfindung nicht zu gefährden, verkürzt die Dauer des Zulassungsverfahrens den Teil der Patentlaufzeit, der für die Kommerzialisierung der Erfindung genutzt werden kann. Damit wird die Anreizfunktion für Produkte, welche eine Zulassung bedürfen (Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel), aufgrund der verkürzten nutzbaren Patentlaufzeit geschmälert. Da die Zulassungsverfahren zeitintensiv sind, fünf bis zehn Jahre dauern können und der Patentschutz während dieser Zeit bereits läuft, ohne dass der Patentinhaber die Erfindung aufgrund der noch nicht vorhandenen Zulassung kommerziell nutzen kann, wird ein Ausgleich geschaffen: Der Patentinhaber kann ein Ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) beantragen (50). Da es um einen immaterialgüterrechtlichen Schutz geht, ist die zuständige Behörde das Institut für Geistiges eigentum (IGE) und nicht Swissmedic. Das ESZ verlängert den immaterialgüterrechtlichen Schutz für ein zugelassenes Produkt um bis zu fünf Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem der Patentschutz nach der maximalen Schutzdauer von 20 Jahren abgelaufen ist. Damit gleicht das ESZ teilweise den Zeitverlust aus, der sich für die Nutzung des Patents aufgrund des Zulassungsverfahrens ergeben hat. Das ESZ ist in Art. 140a PatG geregelt: Danach erteilt das IGE für Wirkstoffe und Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln auf Gesuch hin ein ESZ (Art. 140a Abs. 1 PatG). Dazu enthält die Vorschrift Legaldefinitionen für die Begriffe Wirkstoff und Wirkstoffzusammensetzung: Ein Wirkstoff ist ein zur Zusammensetzung eines Arzneimittels gehörender Stoff chemischen oder biologischen Ursprungs, der eine neue medizinische Wirkung auf den Organismus hat. Eine Wirkstoffzusammensetzung wird dagegen als eine Kombination aus mehreren Stoffen verstanden, die alle eine medizinische Wirkung auf den Organismus haben. Das Verfahren zur Erteilung eines ESZ bestimmt sich nach den Art. 140b ff. PatG.
Zusammenfassung
Sowohl die Regulierungen von Arzneimitteln als auch von Medizinprodukten sind komplex und durch eine Vielzahl von Rechtsvorschriften auf Gesetzes- und Verordnungsstufe geregelt. Das Zulassungsverfahren für Arzneimittel ist zeit- und kostenintensiv. Daher spielen Schutzrechte, sowohl der Erstanmelder- bzw. Unterlagenschutz auf der Grundlage des Heilmittelrechts als auch Patente und das ESZ im Rahmen des Immaterialgüterrechts eine wichtige Rolle als Innovationsanreiz für die weitere Forschung. Die Schnittstelle zwischen der Zulassung von Arzneimitteln nach dem HMG und dem Patentrecht, einschliesslich Unterlagenschutz und Ergänzendem Schutzzertifikat, ist komplex und vielschichtig. Der Rechtsrahmen wird darüber hinaus durch viele, ganz unterschiedliche Rechtsfragen überlagert, so z. B. Pflichten zur Offenlegung von Informationen trotz Unterlagenschutz, die Geltendmachung und Durchsetzung des Unterlagenschutzes, Schutzlücken des Unterlagenschutzes, z. B. aufgrund von Veröffentlichung von Daten im Rahmen von wissenschaftlichen Publikationen, Zusammenhang mit Offenlegungspflichten in anderen Jurisdiktionen, die Berechnung des Zeitpunkts für die Laufzeit des ESZ und Bestimmung des Gegenstandes bzw. Umfangs eines ESZ. Dies wird noch durch unterschiedliche Anforderungen an die Schutzrechte und verschiedene Schutzfristen im internationalen Kontext erschwert, da eine internationale Harmonisierung in diesen Bereichen nicht besteht. Dies sind nur einige Beispiele von Rechtsfragen, welche die Komplexität zweier hochregulierter und technologiebasierter Bereiche mit sich bringt. Die Zulassung von Arzneimitteln unter Berücksichtigung von Patentrechten, Unterlagenschutz und Ergänzendem Schutzzertifikat bedarf daher einer rechtlichen und strategischen Planung.
Um die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der Zulassung von Arzneimitteln nach Heilmittelrecht und dem Patentrecht, einschliesslich Unterlagenschutz und ESZ, anzugehen, sollten klare Richtlinien – auch auf internationaler Ebene – im Hinblick auf Datenveröffentlichungen unter Berücksichtigung des Unterlagenschutzes bestehen. Für das Versuchsprivileg sollten klare Rahmenbedingungen bestehen. Auf internationaler Ebene wären Harmonisierungen im Hinblick auf Schutzfristen und Standards sinnvoll, um die Rechtssicherheit zu erhöhen. Auch eine weitere Kooperation und Austausch der Zulassungsbehörden und Patentämter wäre hilfreich. Möglicherweise wären auch digitale Verwaltungssysteme zur effizienteren Handhabung von Zulassungs- und Patentanträgen sowie zur Überwachung der Einhaltung von Schutzrechten nützlich. Dies zeigt, dass die Regulierung in den dargestellten Bereichen dieses Beitrags nicht abgeschlossen sind, sondern sich vielmehr noch weiterentwickeln wird.
Professorin für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht
und Life Sciences Recht
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)
Dorfstrasse 24
FL-9495 Triesen
claudia.seitz@ufl.li
Die Autorin hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.
1. Für die nachfolgenden Ausführungen wird auf das folgende Buch verwiesen: Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023.
2. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 128-129.
3. Vgl. hierzu BAG, Bekämpfung von Heilmittelfälschungen, https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/heilmittelfaelschung-illegaler-handel.html.
4. Zur Problematik der Arzneimittelfälschungen und den daraus resultierenden Gesundheitsgefahren sowie Möglichkeiten der Prävention vgl. Europarat, Medicrime Konvention, Übereinkommen des Europarats über die Fälschung von Arzneimitteln und Medizinprodukten und über ähnliche die öffentliche Gesundheit gefährdende Straftaten, abgeschlossen in Moskau am 28. Oktober 2011, in Kraft seit 1. Februar 2019 (SR 0.812.41).
5. Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21).
6. Für einen Überblick über die jeweils aktuellen Rechtsgrundlagen zum Heilmittelrecht und dem dazugehörigen Ausführungsrecht siehe Swissmedic, Rechtsgrundlagen für Heilmittel in der Schweiz, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/legal/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-fuer-heilmittel-in-der-schweiz.html [besucht am 10.07.2024].
7. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 131-133.
8. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 132.
9. Bundesgesetz über die Krankenversicherung (Krankenversicherungsgesetz, KVG) vom 18. März 1994 (SR 832.10).
10. Zu den nachfolgenden Ausführungen siehe ausführlich Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 139-142.
11. Eggenberger Stöckli E, Kesselring F, Art. 4. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 10.
12. Eggenberger Stöckli E, Kesselring F, Art. 4. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 10; Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 141-142.
13. Medizinprodukteverordnung (MepV) vom 1. Juli 2020 (SR 812.213).
14. Eggenberger Stöckli E, Kesselring F, Art. 4. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 116.
15. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 141-144.
16. Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG) vom 20. Juni 2014 (SR 817.0).
17. BGE 138 IV 57.
18. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 144-145.
19. BGer, Urt. v. 13.5.2019, 2C_600/2018, E 6.2.
20. Verordnung über die Bewilligung im Arzneimittelbereich (Arnzneimittel-Bewilligungsverordnung, AMBV) vom 14. November 2018 (SR 812.212.1).
21. BGer, Urt. v. 8.10.2019, EB_984/2019, E. 2.3.
22. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 137.
23. Für einen Überblick über die Verordnungen von Swissmedic (sog. Institutsratsverordnungen), siehe Rechtsgrundlagen für Heilmittel in der Schweiz, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/legal/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-fuer-heilmittel-in-der-schweiz.html [besucht am 10.07.2024].
24. Eggimann S, Isler M, Wildi A, Art. 5. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 9.
25. Eggimann S, Isler M, Wildi A, Art. 5. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 3; Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 145.
26. Eggimann S, Isler M, Wildi A, Art. 5. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 3; Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 145.
27. Schott M, Albert E, Vor Art. 8-17. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 7.
28. Schott M, Albert E, Art. 9. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 32; Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 144.
29. Schott M, Albert E, Art. 9. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 33; Für weitere Hinweise zu den Formula-Arzneimitteln siehe Swissmedicines inspectorate, Herstellung und Inverkehrbringen von Formula-Arzneimitteln, 12.10.2023.
30. BGer, 15.03.2019, 2C_424/218, E.4.
31. Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln (Arzneimittel-Zulassungsverordnung, AMZV) vom 9. November 2001 (SR 812.212.22).
32. Schott M, Albert E, Art. 11. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 47; Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 144.
33. Schott M, Albert E, Art. 10. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 2.
34. Schott M, Albert E, Art. 11a. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 2; Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 151. Für weitere Informationen zum Unterlagenschutz vgl. Swissmedic, Fragen und Antworten zum Unterlagenschutz, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/services/documents/faq-unterlagenschutz.html [besucht am 10.07.2024].
35. BGer, Urt. v. 17. September 2008, 2C-318/2008, E. 5.2.1.
36. Schmid G, Uhlmann F, Art. 14. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 11.
37. Seitz C, Gesundheitsrecht: Repetitorium. Zürich: Orell Füssli Verlag, 2023. 151-152.
38. Swissmedic, Pharmacovigilance, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance.html [besucht am 10.07.2024].
39. Eichenberger Th, Art. 59. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 18.
40. Meier A, Vor, Kapitel 3. In: Eichenberger Th, Jaisli U, Richli P, editors. Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz. 2. Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2022, Rn. 2.
41. Swissmedic, Medizinprodukte, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte.html [besucht am 10.07.2024].
42. Swissmedic, Regulierung Medizinprodukte, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/regulierung-medizinprodukte.html [besucht am 10.07.2024].
43. Schweizer M, Zech H, Vor Art. 1. In: Schweizer M, Zech H, editors: Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz (PatG). Bern: Stämpfli Verlag, 2019, Rn. 1.
44. Vaterlaus St, Zenhäusern P, Schneider Y, Bothe D, Thrhal N, Riechmann C, Optimierungspotenzial des nationalen Schweizer Patentsystems. In: Eidgenössisches Insitut für Geistiges Eigentum. Bern. 2015, https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/publikationen_institut/Polynomics_Frontier_IGE_OptimierungPatentsystem_Schlussbericht_Gesamt_D_final.pdf [besucht am 10.07.2024], 21-22.
44. Schweizer M, Zech H, Vor Art. 1. In: Schweizer M, Zech H, editors: Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz (PatG). Bern: Stämpfli Verlag, 2019, Rn. 2.
46. Stamm H, Ohne Patente keine Pharma, Die Volkswirtschaft 2021, https://dievolkswirtschaft.ch/de/2021/11/ohne-patente-keine-pharma/ [besucht am 10.07.2024].
47. Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) vom 25. Juni 1954 (SR 232.14).
48. Schweizer M, Zech H, Vor Art. 1. In: Schweizer M, Zech H, editors: Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz (PatG). Bern: Stämpfli Verlag, 2019, Rn. 3.
49. Hess-Blumer A, Art. 9. In: Schweizer M, Zech H, editors: Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz (PatG). Bern: Stämpfli Verlag, 2019, Rn. 36.
50. Zum Ergänzenden Schutzzertifiikat für Arzneimittel siehe ausführlich IGE, Ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ): Verlängerung des Schutzes für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel nach Ablauf des Patentschutzes, https://www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/patente/nach-der-erteilung/ergaenzendes-schutzzertifikat [besucht am 10.07.2024].