- Sinnvolle Synkopen-Abklärung
Anhand mehrerer interaktiver Fallbeispiele zeigte Prof. Tobias Breidthardt, Chefarzt Innere Medizin am Luzerner Kantonsspital, am SGAIM-Herbstkongress, wie eine sinnvolle Abklärung von Synkopen erfolgen kann und in welchem Setting sie jeweils angezeigt ist (ambulant oder stationär).
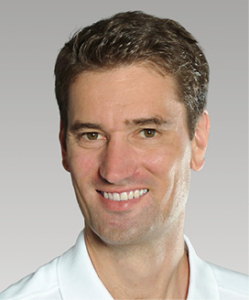
Eine Synkope ist definiert als ein vorübergehender Bewusstseinsverlust infolge einer zerebralen Minderdurchblutung. Sie beginnt abrupt, dauert nur kurz und endet mit einer spontanen, vollständigen Erholung. Synkopen sind häufig (rund 2 % aller Notfallvorstellungen), aber diagnostisch herausfordernd: Sie treten anfallsartig auf, die Erinnerung der Betroffenen ist meist eingeschränkt, und oft fehlen Augenzeugen. Zudem können sie potenziell gefährlich sein. Rund 20 % haben eine kardiovaskuläre Ursache, innerhalb von 30 Tagen versterben 0,8 % Prozent der Betroffenen, während 6,9 % ein schwerwiegendes Ereignis wie einen Myokardinfarkt, eine Arrhythmie, eine Dissektion oder eine Lungenembolie erleiden.
Fallbeispiel 1: 92-jähriger Patient
Ein 92-jähriger Patient verlor auf dem Weg ins Bad kurzzeitig das Bewusstsein. Nach dem Erwachen am Boden konnte er sich mühsam ins Bett zurückziehen und löste dort den Notfallalarm aus. Bei Eintreffen der Sanität zeigte sich eine erneute, wenige Sekunden dauernde Synkope im Liegen, ausgelöst durch einen Würgereflex. Die Vitalwerte waren unauffällig, der Blutdruck lag bei 168/76 mmHg, der Puls bei 48/min, die Sauerstoffsättigung bei 97 %.
Die initiale Untersuchung ergab eine bradykarde, aber rhythmische Herzaktion ohne pathologische Herzgeräusche, keine pulmonalen Auffälligkeiten, ein weiches Abdomen und stabile Laborwerte. Nach 24 Stunden Telemetrie zeigte sich ein Sinusrhythmus mit AV-Block I und physiologischer nächtlicher Bradykardie. Da keine weiteren Ereignisse auftraten, wurde der Patient mit der Diagnose einer vasovagalen (Reflex-)Synkope entlassen. Innerhalb der folgenden zwölf Monate traten keine Rezidive auf.
Fallbeispiel 2: 65-jähriger Patient
Ein 65-jähriger, bislang gesunder Mann erlitt während der morgendlichen Rasur im Stehen eine Synkope mit Sturz und Kopfanprall. Eine Vorwarnung bestand nicht. Bei einem Check-up war zuvor eine leichtgradige Mitralinsuffizienz mit gehäuften ventrikulären Extrasystolen aufgefallen, eine Medikation bestand nicht. Etwa zwei Stunden später kam es im Sitzen erneut zu einem Synkopenereignis mit Übelkeit und Unwohlsein, das in eine Reanimation mündete.
Auf der Intensivstation zeigte das Echokardiogramm eine leichte Mitralinsuffizienz bei normaler Pumpfunktion. Die Diagnose einer bradykardiebedingten Synkope wurde gestellt, und es erfolgte die Implantation eines DDD-Schrittmachers. Der Patient blieb danach stabil. Synkopen auf der Notfallstation sollten grundsätzlich unter EKG-Überwachung beurteilt werden.
Bei Erwachsenen über 40 Jahren liegt die Prävalenz kardialer Synkopen bei etwa 15 %. Die häufigsten Ursachen sind Bradykardie (7 %), Tachykardie (4 %), Aortenstenose (2 %) und Myokardinfarkt (2 %). Die 12-Monats-Gesamtmortalität beträgt rund 20 %; dieser Patient gehörte zur Niedrigrisikogruppe für schwerwiegende Folgeereignisse.
Fallbeispiel 3: 69-jährige Patientin
Eine 69-jährige Patientin berichtete über rezidivierende Synkopen mit einer Häufigkeit von vier- bis sechsmal jährlich. Echokardiografie, Langzeit-EKG und EEG zeigten wiederholt unauffällige Befunde. Aufgrund der Persistenz der Ereignisse wurde ein subkutaner Ereignisrekorder (Reveal Recorder) implantiert, der über mehrere Jahre kontinuierlich den Herzrhythmus überwacht.
Schliesslich konnte ein paroxysmaler AV-Block III mit fehlendem Ersatzrhythmus während 16 Sekunden dokumentiert werden. Nach Implantation eines DDD-Schrittmachers traten keine weiteren Synkopen auf. Interessant ist, dass Frauen häufiger vasovagale Synkopen aufweisen, während bei Männern kardiogene Ursachen überwiegen.
Fallbeispiel 4: 77-jährige Patientin
Eine 77-jährige Patientin erlitt während des Kochens plötzlich Übelkeit, Schwindel und Kaltschweissigkeit, legte sich selbstständig aufs Sofa und verlor dort das Bewusstsein. Nach kurzer Erholung kam es beim Aufstehen zu einem erneuten Kollaps. Ähnliche Episoden waren bereits vor acht Wochen aufgetreten.
Bei der Untersuchung zeigte sich die Patientin in reduziertem Allgemeinzustand, jedoch kreislaufstabil. Eine Hypoglykämie (BZ 2.7 mmol/l) führte nach Glukosegabe rasch zu einer Erholung. In der ergänzenden Anamnese berichtete sie über Heisshungerattacken, nächtliche Schweissausbrüche und zunehmende Lust auf Süsses. Die weiterführende Abklärung ergab ein Insulinom des Pankreas als Ursache der Bewusstseinsverluste.
Risikoeinschätzung und diagnostisches Vorgehen
Die Einschätzung des individuellen Risikos ist entscheidend für das weitere Vorgehen. Synkopen mit Warnsymptomen wie Schwindel, Übelkeit oder Schwitzen in typischen Situationen (z. B. längeres Stehen, Hitze, emotionale Belastung) sprechen meist für eine gutartige, reflexartige Ursache. Dagegen deuten Ereignisse, die im Liegen, unter Belastung oder ohne Prodrom auftreten, auf eine potenziell kardiale oder neurologische Genese hin.
Patientinnen und Patienten mit neu aufgetretenen Brustschmerzen, Dyspnoe, abnormem EKG, struktureller Herzerkrankung oder familiärer Vorgeschichte plötzlichen Herztodes gelten als Hochrisikogruppe und sollten stationär überwacht werden. Fälle mit unklarer oder mittlerer Risikokonstellation profitieren von einer Beobachtung oder einer Vorstellung in einer spezialisierten Synkopenambulanz. Bei eindeutig reflexartiger oder orthostatischer Synkope genügt in der Regel eine Aufklärung und ambulante Kontrolle.
Empfohlene Abklärungsschritte
Die Diagnostik beginnt mit einer sorgfältigen Anamnese, inklusive Beschreibung der Episode, möglicher Auslöser, Begleitsymptome und Medikamentenanamnese. Wenn möglich, sollten auch Augenzeugen befragt werden.
Darauf folgen eine klinische Untersuchung mit Blutdruckmessung im Liegen und Stehen sowie eine kardiopulmonale und neurologische Basisuntersuchung. Ein EKG gehört zur Routine; bei anhaltender Unsicherheit empfiehlt sich ein Langzeitmonitoring oder die Implantation eines Ereignisrekorders (ILR).
Laboruntersuchungen (Blutbild, Elektrolyte, Nierenfunktion) werden gezielt eingesetzt, wenn die klinische Situation darauf hinweist. Risikoscores bieten keinen Zusatznutzen gegenüber der ärztlichen Gesamtbeurteilung.
Differenzialdiagnosen
Nicht jeder kurzzeitige Bewusstseinsverlust ist eine Synkope. Zu den wichtigsten Differenzialdiagnosen gehören:
– Epileptische Anfälle
– Hypoglykämien
– Schwere Blutungen oder Anämien
– Lungenembolien
– Myokardinfarkt oder Aortendissektion
– Medikamentenassoziierte Nebenwirkungen
– Stürze ohne Bewusstseinsverlust
Diese müssen anamnestisch und klinisch ausgeschlossen werden.
Fazit
Eine strukturierte, risikobasierte Synkopen-Abklärung ermöglicht in den meisten Fällen eine sichere Zuordnung der Ursache. Hochrisikopatienten benötigen eine stationäre Überwachung, während bei reflexartigen oder orthostatischen Synkopen in der Regel eine ambulante Betreuung ausreicht. Entscheidend bleibt die klinische Beurteilung, nicht der Score.
riesen@medinfo-verlag.ch






