- Was nun mit unseren Krankenversicherungs-Prämien?
Allerdings wäre es ein Trugschluss, jetzt einfach so weiterzumachen wie bisher. Wenn die Politik – und die Ärzteschaft! – zeitnah keine Lösungen finden, wie die Prämienzahlenden entlastet werden, wird das Problem der (zu) hohen Prämienkosten mit immer extremeren Lösungsansätzen von immer radikaleren Gruppen angegangen werden. Es könnte so zu einer Schocktherapie kommen, die breiten Kreisen massiv schaden würde – Patientinnen, Patienten und Gesundheitsberufsleuten.
Es werden zwar homöopathische Vorschläge in die Diskussion geworfen wie vermehrter Generikagebrauch, die Einheitskasse oder die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Auch wenn die Ideen gut sind, die Kosten werden damit – wenn überhaupt – kaum spürbar gebremst.
Ein Ansatz, der wirklich die Gesundheitslandschaft ändern könnte, die monistische Finanzierung der Gesundheitsleistungen, d.h. die gleiche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen durch den Steuer- und Prämienzahler, wird ausgerechnet von den Pflegeverbänden bekämpft. Ob es da um das liebe Geld geht? Dies wird natürlich verneint. Es wird argumentiert, dass die durch die neue Finanzierung geförderte Ambulantisierung – wie sie in den meisten industrialisierten Ländern schon längst stattgefunden hat – durch die höhere Kadenz der Eingriffe eine vermehrte Belastung der Pflege zur Folge hätte. Dies mag so sein. Allerdings werden reguläre ambulante Eingriffe während normaler Arbeitszeiten an normalen Wochentagen mit Entlassung der Patientinnen und Patienten am selben Tag durchgeführt. Die Patientenaufenthalte in der Nacht und auch am Wochenende würden so signifikant sinken. Das bedeutete eine massive Entlastung der Pflege. Gerade solche Erleichterungen kämen den Wünschen der Gen Z nach einer besseren Work-Life-Balance entgegen, was den Pflegeberuf bei bereits guter Bezahlung klar attraktiver machen würde.
Und dann ist da noch der Elefant im Raum, über den kaum gesprochen wird: Es hat zu viele Spitäler in der Schweiz! Im internationalen Vergleich haben wir die höchste Spitaldichte. Natürlich, wenn der Prämienzahler und die Steuerzahlerin bereit sind, die zusätzlichen finanziellen Lasten zu schultern, kann jedes Dorf ein eigenes Spital haben. Allerdings würde das aufgrund der geringen Fallzahlen zu einer Abnahme der Behandlungsqualität führen. Darum führt nichts an weiteren Spitalschliessungsrunden vorbei. Es würden u.a. viele nicht ausgelastete und sehr kostspielige Vorhalteleistungen entfallen. Zudem würden viele Fachkräfte freigestellt, nach denen die Spitäler händeringend suchen. Spitalschliessungen können und sollten jedoch patientenfreundlich und sozialverträglich erfolgen, d.h. vorangekündigt über einen Zeitraum von 5, besser 10 Jahren. Das erlaubt den Akteuren, sich an die neue Situation anzupassen. Zudem würden die meisten Akutspitäler einem neuen Zweck in der Gesundheitslandschaft zugeführt, sodass der häufig befürchtete Abbau bisheriger Stellen zwar stattfindet, welche aber meist in neue zukunftssicherere Positionen umgewandelt werden.
Es ist höchste Zeit, dass die Ärzteschaft nicht nur Fundamentalopposition gegen wirklich wirksame Änderungen betreibt, sondern selbst wirksame (!) Lösungen entwickelt, die zu einer Stabilisierung der Gesundheits- und Prämienkosten führen. Ansonsten gilt möglicherweise auch für unseren Berufsstand: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
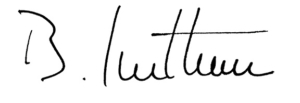
Prof. Dr. med. Bruno Imthurn, Zürich
Senior Consultant Kinderwunschzentrum
360° Zürich
bruno.imthurn@uzh.ch






