- Joint ESC-EACTS/STS-SSC/SSCS Guidelines
Der Jahreskongress 2025 der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie (SGK) fand gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie (SGHC) in Zürich statt. Partnergesellschaften waren Swiss Association for Nursing Science, Swiss Cardiovascular Therapists, Swiss Society of Emergence and Rescue Medicine, Swiss Society for Hypertension, Swiss Society of Pediatric Cardiology, Swiss Society of Perfusion. Im Zentrum standen aktuelle kardiovaskuläre Leitlinien und ihre klinische Umsetzung. Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerungen ausgewählter ESC-, EACTS- und STS-Guidelines zu Hypertonie, Vorhofflimmern, chronischem Koronarsyndrom, Aortensyndromen sowie peripheren Gefässerkrankungen vorgestellt.
Erhöhter Blutdruck und Hypertonie

Prof. Dr. John William McEvoy aus Galway, Irland, der Co-Vorsitzende der Guidelines Task Force, stellte zunächst die neuen ESC-Kategorien vor. Vereinfacht lauten sie für die Messung in der Praxis wie folgt:
Eine initiale Monotherapie wird auch für hypertensive Patienten mit moderater bis schwerer Gebrechlichkeit empfohlen.
• Nicht erhöht: < 120/70mmHg.
• Erhöht: 120–139/70–89mmHg.
• Hypertonie: ≥ 140/90mmHg.
Wann sollte eine medikamentöse Behandlung eingeleitet werden?
Eine medikamentöse Therapie wird bei einem Praxis-Blutdruck unter 120/70mmHg nicht empfohlen. Bei Werten zwischen 120 und 139mmHg bzw. 70 und 89mmHg hängt der Therapiebeginn von weiteren Risikofaktoren und der Anamnese ab. Bei Werten ≥ 140/70mmHg soll eine medikamentöse Therapie begonnen werden. In internationalen Erhebungen stieg die Rate erhöhter systolischer Blutdruckwerte (SBP) von 110 bis 115 und von 140mmHg zwischen 1990 und 2015 trotz einiger Unsicherheiten in den Schätzungen erheblich an, und auch die mit erhöhten SBP verbundenen DALYs und Todesfälle nahmen zu. Etwa 30 % der durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten behinderungsbereinigten Lebensjahre (DALYs) treten bei Personen mit einem systolischen Blutdruck zwischen ca. 120 und 140mmHg auf.
Die Behandlung der resistenten Hypertonie
Die neuen Empfehlungen zur medikamentösen Behandlung sehen bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Blutdruck und erhöhtem kardiovaskulärem Risiko eine initiale Monotherapie vor, wenn der systolische Blutdruck ≥ 130 mmHg beträgt. Auch bei über 85-jährigen hypertensiven Patientinnen und Patienten mit moderater bis schwerer Gebrechlichkeit oder orthostatischer Hypotonie wird eine initiale Monotherapie empfohlen.
Bei Patientinnen und Patienten mit Hypertonie sollte die Therapie mit einer niedrigen Dosis begonnen werden. Darauf folgt eine Verdopplung der Kombinationstherapie, anschliessend der Einsatz einer niedrig dosierten Tripelkombination und schliesslich eine schrittweise Dosiserhöhung.
Gemäss dem ALARA-Prinzip («As Low As Reasonably Achievable») soll das Blutdruckziel so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar gehalten werden – vorzugsweise < 140 mmHg –, wenn Werte zwischen 120–129 mmHg nicht toleriert werden oder in folgenden Situationen:
• Vorbehandelte Personen mit symptomatischer orthostatischer Hypotonie und/oder einem Alter ≥ 85 Jahre (Empfehlungsklasse IIa)
• Klinisch signifikante, moderate bis schwere Gebrechlichkeit in jedem Alter und/oder begrenzte prognostizierte Lebenserwartung (< 3 Jahre) (Klasse IIb)
Das Ziel für den systolischen Blutdruck liegt bei 120–129mmHg (Klasse I), das Ziel für den diastolischen Blutdruck bei 70–79mmHg (Klasse IIb). Eine ambulante Blutdruckmessung (ABPM) oder eine Selbstmessung zu Hause (HBPM) wird gegenüber der Praxis-Blutdruckmessung bevorzugt.
Liegt der Praxisblutdruck bei ≥ 140/90 mmHg trotz drei oder mehr blutdrucksenkender Medikamente in maximal tolerierter Dosierung – einschliesslich eines Diuretikums –, sollte eine Überweisung an ein Hypertoniezentrum erwogen werden (Klasse IIa). Dabei sollen eine sekundäre oder pseudo-resistente Hypertonie ausgeschlossen sowie die antihypertensive Medikation optimiert werden (idealerweise eine Dreifachkombination).
Bei einer echten behandlungsresistenten Hypertonie wird Spironolacton empfohlen. Falls dieses nicht vertragen wird, kann Eplerenon eingesetzt werden (Klasse IIa). Wenn Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten (MRA) unwirksam oder unverträglich sind, kann die Zugabe eines Betablockers erfolgen (sofern nicht bereits aus zwingender Indikation verschrieben). Bleibt die Hypertonie dennoch unkontrolliert, sollten intensivierte medikamentöse Optionen in Erwägung gezogen werden, wie Alphablocker, zentral wirkende Antihypertensiva sowie kaliumsparende Diuretika.
Ein multidisziplinärer Ansatz im Management von Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Blutdruck und Hypertonie wird empfohlen, einschliesslich einer angemessenen und sicheren Aufgabenverlagerung (Empfehlungsklasse I/A). Zudem kann eine renale Denervation in Betracht gezogen werden – unter Einbezug einer gemeinsamen Risiko-Nutzen-Abwägung und idealerweise in einem mittel- bis hochvolumigen Zentrum.
ESC 2024 Guidelines for Atrial Fibrillation

Über die Schlüsselelemente der ESC Guidelines 2024 für Vorhofflimmern sprach Prof. Dr. Isabelle C. Van Gelder aus Groningen.
Prinzipien des Betreuungsansatzes – das C.A.R.E.-Modell
Die ESC empfiehlt einen strukturierten Ansatz zur Behandlung von Vorhofflimmern, zusammengefasst im C.A.R.E.-Modell:
• C – Comorbidity: Management von Komorbiditäten und Risikofaktoren
• A – Avoid: Vermeidung thromboembolischer Ereignisse
• R – Reduce: Reduktion von Symptomen durch Frequenz- und Rhythmuskontrolle
• E – Evaluate: Kontinuierliche Evaluation und dynamische Neubewertung
Grundsatz: Risikofaktoren zuerst adressieren
Ein breites Spektrum an Komorbiditäten und Risikofaktoren steht im Zusammenhang mit dem Wiederauftreten und Fortschreiten von Vorhofflimmern. Der Umgang mit diesen ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg anderer Aspekte der Versorgung von Patienten mit Vorhofflimmern. Die Behandlung dieser Faktoren unterstützt:
• die Linderung von Symptomen durch Frequenz- und Rhythmuskontrolle,
• die Senkung des mit der Antikoagulation verbundenen Blutungsrisikos,
• die Reduktion unerwünschter Wirkungen.
Die Identifizierung und Behandlung dieser Komorbiditäten und Risikofaktoren ist ein zentraler Bestandteil einer wirksamen Behandlung von Vorhofflimmern. Dadurch verbessern sich die Ergebnisse für die Patienten und ein Wiederauftreten von Vorhofflimmern wird verhindert.
Ein integriertes Management von Vorhofflimmern umfasst die Identifikation und aktive Behandlung aller relevanten Komorbiditäten und Risikofaktoren (Empfehlungsklasse I). Zentrale Elemente dieses Ansatzes sind die Festlegung individueller Zielwerte sowie eine gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen medizinischem Fachpersonal und Patientin oder Patient. Dabei sollen realistische, erreichbare Ziele – beispielsweise im Hinblick auf Verhaltensänderungen – definiert werden, mit besonderem Fokus auf die wichtigsten beeinflussbaren Einflussfaktoren. Informationen sind dabei klar und strukturiert zu vermitteln, ohne die Betroffenen zu überfordern.
Bei einer Hypertonie wird eine Blutdruckbehandlung mit dem Ziel von 120–129mmHg/70–79mmHg bei den meisten Erwachsenen empfohlen (oder so niedrig wie angemessen erreichbar) (Klasse I).
ESC-Guidelines 2024: Chronisches Koronarsyndrom – Diagnostik, Therapie und neue Konzepte
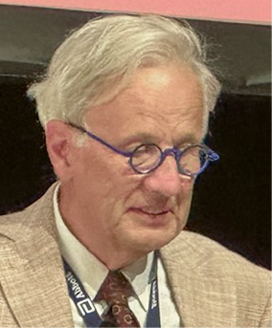
Prof. Dr. Christian Vrints aus Antwerpen präsentierte zentrale Neuerungen der ESC-Leitlinien zum chronischen Koronarsyndrom (CCS). Thematisiert wurden ein neues pathophysiologisches Konzept, eine aktualisierte Definition, ein stufenweiser diagnostischer Ansatz, ein überarbeiteter Diagnosealgorithmus sowie revidierte Empfehlungen zur medikamentösen Therapie und koronaren Revaskularisation.
Chronische Koronarsyndrome umfassen ein Spektrum klinischer Erscheinungsformen, die auf strukturelle und/oder funktionelle Veränderungen zurückzuführen sind.
Diese Veränderungen führen zu chronischen Erkrankungen der Herzkranzgefässe und/oder zu Störungen der Mikrozirkulation. Auslöser für Symptome können körperliche Belastung, psychischer Stress oder emotionale Reize sein. Das klinische Bild reicht von asymptomatischen Verläufen mit abnormalen funktionellen oder anatomischen Testergebnissen über Angina pectoris oder Angina-Äquivalente ohne (ANOCA/MINOCA) oder mit obstruktivem Koronarsyndrom bis hin zu stabilisierten Phasen nach akutem Koronarsyndrom (ACS), perkutaner Koronarintervention (PCI) oder koronarer Bypass-Operation (CABG). Auch Patienten mit linksventrikulärer Dysfunktion oder ischämischer Herzinsuffizienz gehören in dieses Spektrum.
Vierstufiger Management-Ansatz bei Verdacht auf CCS
Bei Personen mit Verdacht auf ein chronisches Koronarsyndrom soll die Abklärung in vier Schritten erfolgen.
• Schritt 1: Zunächst erfolgt eine klinische Erstuntersuchung. Wenn keine nicht-kardialen Ursachen der Symptome identifiziert werden, ist die zugrunde liegende Erkrankung gezielt zu behandeln.
• Schritt 2: Bei sehr niedriger klinischer Wahrscheinlichkeit für eine obstruktive KHK (≤ 5 %) kann auf weiterführende Tests zunächst verzichtet werden.
• Schritt 3: Der Fokus liegt auf der Sicherung der Diagnose sowie der besseren Risikoeinschätzung hinsichtlich zukünftiger kardiovaskulärer Ereignisse. Hierbei sind ANOCA/INOCA als mögliche Diagnosen zu berücksichtigen. Die Koronar-CT-Angiographie (CCTA) dient zur Detektion obstruktiver KHK und als Basis für eine gezielte Risikofaktormodifikation. Ergänzend sollen krankheitsmodifizierende medikamentöse Therapien sowie gegebenenfalls eine antithrombotische Behandlung eingeleitet werden.
• Schritt 4: Die therapeutischen Massnahmen zielen auf die Verbesserung der Prognose durch Lebensstiländerung und Kontrolle kardiovaskulärer Risikofaktoren. Dabei stehen eine krankheitsmodifizierende medikamentöse Therapie sowie nicht-medikamentöse Massnahmen im Vordergrund.
Ein neuer diagnostischer Algorithmus wurde ebenfalls vorgestellt. Bei Fehlen einer obstruktiven KHK ist die Behandlung entsprechend dem ANOCA-Konzept auszurichten. Eine differenzierte Beurteilung ist insbesondere bei Patientinnen mit multiplen kardiovaskulären Risikofaktoren, einer Anamnese von Präeklampsie, wiederholten Fehlgeburten oder vorzeitiger Menopause indiziert.
Antianginöse Therapie
Die Auswahl der Antianginosa wird an die Charakteristik des Patienten, Begleiterkrankungen, gleichzeitige Medikamente, Verträglichkeit der Behandlung und die zugrunde liegende Pathophysiologie der Angina angepasst, wobei auch die lokale Verfügbarkeit von Medikamenten und die Kosten berücksichtigt werden (I/C).
Empfehlungen zur antithrombotischen Therapie
Bei Patienten mit chronischem Koronarsyndrom und vorherigem Myokardinfarkt oder remote PCI wird Clopidogrel 75mg täglich als eine sichere und effektive Alternative zu Aspirin-Monotherapie empfohlen (I/A).
Bei Patienten mit chronischem Koronarsyndrom, die sich einem Stenting mit hohem thrombotischem Risiko unterziehen, kann Prasugrel oder Ticagrelor (zusätzlich zu Aspirin) anstatt Clopidogrel während des ersten Monats und bis zu 3–6 Monate in Betracht gezogen werden (IIb/C).
Bei Patienten mit chronischem Koronarsyndrom, oder stabilem akutem Koronarsyndrom, die sich einer PCI unterzogen haben, und initial mit auf Ticagrelor DAPT behandelt wurden, mit hohem ischämischem Risiko, aber ohne hohes Blutungsrisiko, kann Ticagrelor-Monotherapie (90mg b.i.d) als Alternative zur dualen oder andere Einzelantiplättchentherapie in Betracht gezogen werden (IIb/C).
Bei Patienten mit hohem Blutungsrisiko, aber ohne hohes Ischämierisiko, ist die Einstellung der DAPT 1–3 Monate nach PCI und die Fortsetzung mit Einzel-Antiplättchen-Therapie empfohlen (I/A).
Langzeit antithrombotische Therapie bei chronischem Koronarsyndrom und orale Antikoagulation
Bei Patienten mit CCS mit einer Langzeit-Indikation für orale Antikoagulation ist gegen Vorhofflimmern eine therapeutische Dosis von VKA allein oder vorzugsweise eines DOAC allein (ausser, wenn kontraindiziert) lebenslang empfohlen (I/B).
Bei Patienten mit einer Indikation für orale Antikoagulation, die sich einer PCI unterziehen, ist initial niedrigdosiertes Aspirin einmal täglich empfohlen (Ladungsdosis, wenn nicht auf Erhaltungsdosis) zusätzlich zu oraler Antikoagulation und Clopidogrel (I/C).
Bei Patienten, die für eine orale Antikoagulation wählbar sind, ist ein DOAK (ausser, wenn kontraindiziert) einem VKA vorzuziehen (I/A).
Zu wählen, nach sorgfältiger Evaluation, vorzugsweise durch das Herz Team:
– Bis 6 Monate bei Patienten ohne hohes ischämisches Risiko oder bis zu 12 Monate bei Patienten mit hohem ischämischem Risiko, gefolgt von oraler Antikoagulation allein, empfohlen (I/A).
Revaskularisation versus konservative Therapie
Im Hinblick auf die Entscheidung zwischen Revaskularisation und konservativ-medikamentöser Therapie betont die Leitlinie eine differenzierte Nutzen-Risiko-Abwägung. Bei Patient:innen mit chronischem Koronarsyndrom und eingeschränkter linksventrikulärer Funktion besteht ein erhöhtes Risiko für unerwünschte Ereignisse im Rahmen einer obstruktiven KHK. Wesentliche Faktoren für die Therapieentscheidung sind die Ausprägung der LV-Dysfunktion, bestehende Komorbiditäten, die Lebenserwartung, das individuelle Risiko-Nutzen-Verhältnis sowie die Patientenpräferenzen (Klasse I/C).
EACTS/STS-Leitlinien zur Diagnose und Behandlung akuter und chronischer Aortensyndrome
Wie die Aorta zum Organ wurde

Die Aorta als Organ – ihre anatomischen Strukturen, Klassifikationen, Scores und Definitionen, sowie die Diagnostik, Indikationsstellung, das Management und therapeutische Optionen – standen im Zentrum des Vortrags von Prof. Martin Czerny, Freiburg im Breisgau.
«Das Offensichtliche ist unmerklich, bis es wahrgenommen wird – Aorta 24. Organ des menschlichen Körpers» so der Referent. Die Guidelines empfehlen, die Aorta im Kontext eines Organs zu sehen, zu interpretieren und zu behandeln, wobei die Diagnose, Behandlung und Überwachung mit dieser Perspektive angegangen werden sollen (Klasse I/C). Die biologische Definition eines Organs ist «eine Sammlung von Geweben die strukturell eine funktionelle Einheit bilden, die für die Ausübung einer speziellen Funktion spezialisiert ist.»
Zentren, Teams, Wirkungen auf die Gesundheitsversorgung
In den Guidelines wird eine geteilte Entscheidungsfindung zur optimalen Behandlung von Aorta-Pathologien durch ein multidisziplinäres Team empfohlen (I/C). Bei Patienten mit multisegmentaler Aortaerkrankung ist eine Behandlung in Aortazentren, die offene und endovaskuläre Herz- und Gefässchirurgie vor Ort bieten, angezeigt (I/C). Der Transfer in ein Aortazentrum sollte für Patienten mit komplexen Aortapathologien in Betracht gezogen werden (IIa/B). Für endovaskuläre Aorta-Prozeduren ist ein hybrider Operatiossaal, einschliesslich eines integrierten Bildgebungssystems, empfohlen (I/C).
Chirurgische Empfehlungen für Aortenwurzel und aufsteigende Aorta
Die Indikationen zur operativen Versorgung richten sich differenziert nach Aneurysmalokalisation, Klappentyp (TAV oder BAV) und individuellen Risikokonstellationen:
• Bei Aneurysmen der Aortenwurzel oder des Rohrabschnitts bei trikuspidaler (TAV) oder bikuspidaler Aortenklappe (BAV) ist eine Operation ab einem Durchmesser von ≥ 55 mm empfohlen (Klasse I/B).
• Bei BAV-bedingter Aortopathie mit Wurzelphänotyp wird eine Operation bereits ab ≥ 50 mm empfohlen (Klasse I/B).
• Bei TAV-assoziierten Aneurysmen mit Wurzelphänotyp ist die chirurgische Behandlung ab ≥ 50 mm in einem Setting mit niedrigem chirurgischem Risiko zu erwägen (Klasse IIa/B).
• Bei aufsteigendem Phänotyp und niedrigem chirurgischem Risiko – unabhängig von TAV oder BAV – ist eine Operation ab > 52 mm in Betracht zu ziehen (Klasse IIa/C).
Für Patienten mit BAV-assoziierter Aortopathie und aufsteigendem Phänotyp sowie niedrigem chirurgischem Risiko sollte eine chirurgische Versorgung bereits ab 50 mm geprüft werden, wenn zusätzliche Risikofaktoren vorliegen: Alter < 50 Jahre, Körpergrösse < 169 cm, Aortenlänge > 11 cm, Wachstum > 3 mm/Jahr, positive Familienanamnese für Aortensyndrome, Aortakoarktation, refraktäre Hypertonie, gleichzeitige Herzklappenoperation oder auf Wunsch des Patienten im Rahmen einer gemeinsamen Entscheidung.
• Bei TAV-Patienten, die sich einer nicht-aortalen Herzklappenoperation unterziehen, sollte eine Mitbehandlung eines Aortawurzel- oder aufsteigenden Aneurysmas ab einem Durchmesser ≥ 50 mm erwogen werden (Klasse IIa/C).
• Bei Patienten mit aufsteigendem Aortenaneurysma, die sich einer Operation unterziehen, sollte ein gleichzeitiger Wurzelersatz bei ≥ 45 mm erwogen werden (Klasse IIa/C).
• Bei jungen Patienten mit familiärer Disposition für Typ-A-Dissektion oder bekannter hereditärer thorakaler Aortenerkrankung (HTAD), die sich einem aufsteigenden Ersatz unterziehen, kann ein niedrigerer Schwellenwert als 45 mm für den Wurzelersatz individuell erwogen werden (Klasse IIb/C).
Im Weiteren stellte der Referent Empfehlungen zur Kanülierung, zur bildgebenden Diagnostik, zur Indikationsstellung sowie zur Perfusion vor. Dabei sollte insbesondere berücksichtigt werden, die Aortenwurzel von Sinus zu Sinus zu vermessen, wobei der grösste gemessene Durchmesser als Referenzwert für klinische Entscheidungen herangezogen werden sollte.
Neben diesen Aspekten präsentierte er die Leitlinienempfehlungen zur Behandlung akuter Aortendissektionen vom Typ A, zum konzeptionellen Ansatz für das Management akuter Aortendissektionen vom Typ A, sowie zur Therapie von Dissektionen vom Typ B und non-A-non-B-Typen. Darüber hinaus wurden Empfehlungen für Erkrankungen des Aortenbogens, der absteigenden thorakalen Aorta, der infrarenalen Aorta und der ersten viszeralen Hauptäste, ebenso wie zur Überwachung von Aortapathien, thematisiert. Der Referent schloss mit folgenden Kernaussagen.
Kernaussagen der Leitlinien
Die Aorta ist das 24. Organ des menschlichen Körpers.
• Die Aortamedizin ist systemrelevant geworden und erfordert spezifische strukturelle Voraussetzungen im Gesundheitssystem.
• Eine vereinheitlichte Terminologie mit harmonisierten Klassifikationen, Scores und Definitionen ist entscheidend für eine gemeinsame Sprache – darunter TEM, GERAADA, Non-A/Non-B, Ishimaru-Zonen, Wurzelmorphologie, Endolecks und Kommerell.
• Ein internationaler Konsens zur Hypothermie-Klassifikation ermöglicht vergleichende Studien weltweit.
• Der natürliche Verlauf der Erkrankung ist heute deutlich besser verstanden und beeinflusst unter anderem Durchmesserindikationen und die klinische Risikobewertung (Linksverschiebung).
• Auch die Länge der Aorta spielt zunehmend eine Rolle im therapeutischen Entscheidungsprozess.
• Von entscheidender Bedeutung ist der Zugang zum gesamten therapeutischen Spektrum, inklusive aller chirurgischen und interventionellen Optionen, unter einem Dach.
• Gesellschaftsübergreifende Initiativen, insbesondere die Zusammenarbeit von ESC und EACTS, gelten als Schlüssel, um die Aortamedizin auf das nächste Niveau zu heben.
Periphere arterielle Verschlusskrankheit und Aortenerkrankungen

«Aorta und periphere Arterien sind integrale Bestandteile desselben arteriellen Systems. Störungen in einem Gefässbett wirken sich häufig auf andere aus und beruhen auf ähnlichen Risikofaktoren», stellte Prof. Dr. Lucia Mazzolai aus Lausanne fest.
Die Integration verschiedener Leitlinien bietet kohärente und standardisierte Empfehlungen für die Behandlung arterieller Erkrankungen als Ganzes. Dies ermöglicht eine koordinierte Versorgung, reduziert Fragmentierung und verbessert die Behandlungsergebnisse insgesamt.
Behandlungskonzepte und diagnostisches Vorgehen
Für die Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAD) wird ein umfassender Ansatz empfohlen, der die gesamte arterielle Durchblutung berücksichtigt (Klasse I/B). Patienten mit PAD haben ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse (MACE), zerebrovaskuläre Erkrankungen sowie Major Adverse Limb Events (MALE) der unteren Extremitäten.
Die frühe Diagnose ist entscheidend für bessere Ergebnisse. Bei Patienten ab 65 Jahren mit kardiovaskulären Risikofaktoren sollte ein Screening auf PAD mittels ABI (Ankle-Brachial-Index) oder TBI (Toe-Brachial-Index) erwogen werden (Klasse IIa/C). Auch bei über 65-jährigen ohne Risikofaktoren kann ein Screening in Betracht gezogen werden (Klasse IIa/B).
PAD bei Typ-2-Diabetes, medikamentöse und interventionelle Therapie
Herzinsuffizienz und PAD gehören zu den häufigsten Erstmanifestationen kardiovaskulärer Erkrankungen bei Typ-2-Diabetes. Die unterschiedlichen relativen Risiken innerhalb dieser Patientengruppe beeinflussen die klinische Risikobewertung und das Studiendesign massgeblich.
Die optimale medizinische Therapie bei PAD umfasst eine multimodale Strategie aus Pharmakotherapie, überwachten körperlichen Trainingsprogrammen und Lebensstilmodifikation. Eine Revaskularisation wird bei asymptomatischer PAD nicht empfohlen (Klasse III/C, neue Empfehlung). Bei symptomatischen Patienten sollte sie erst nach einer Phase optimaler medizinischer Therapie und Bewegung erfolgen und in einer multidisziplinären Fallbesprechung erwogen werden.
Antihypertensive Therapie bei PAD
Bei Patienten mit PAD und Hypertonie wird ein systolisches Ziel von 120–129 mmHg angestrebt – sofern verträglich (Klasse I/A). ACE-Hemmer oder AT1-Rezeptorblocker (ARB) sollten als Erstlinientherapie erwogen werden (Klasse IIa/B). Auch unabhängig vom Blutdruck können ACEi oder ARB bei PAD-Patienten in Betracht gezogen werden, wenn keine Kontraindikationen bestehen (Klasse IIb/B).
Lipidsenkende Therapie bei PAD
Eine lipidsenkende Therapie wird bei atherosklerotischer PAD empfohlen (Klasse I/A), mit dem Zielwert LDL-C < 1.4 mmol/l und einer Reduktion um > 50 % gegenüber dem Ausgangswert (Klasse I/A). Statine sind bei allen Patienten mit PAD indiziert (Klasse I/A). Wird das Therapieziel nicht erreicht, ist die Kombination von Statinen mit Ezetimib angezeigt (Klasse I/B). Reicht auch diese Kombination nicht aus, ist der Einsatz eines PCSK9-Hemmers zur Zielerreichung zu empfehlen (Klasse I/A).
Antithrombotische Therapie bei PAD
Zur Reduktion von MACE bei symptomatischer PAD wird die Gabe von Aspirin (75–160 mg/Tag) oder alternativ Clopidogrel (75 mg/Tag) empfohlen (Klasse I/A). Nach Revaskularisation der unteren Extremitäten kann bei Patienten mit niedrigem Blutungsrisiko eine Kombination aus Rivaroxaban (2.5 mg b.i.d.) und Aspirin (100 mg/Tag) in Betracht gezogen werden (Klasse IIa/A).
Zur Primärprävention bei Patienten mit PAD und Diabetes kann Aspirin (75–100 mg/Tag) erwogen werden, sofern keine Kontraindikationen vorliegen (Klasse IIb/A). Eine routinemässige antithrombotische Behandlung asymptomatischer PAD-Patienten ohne klinisch relevante atherosklerotische Erkrankung wird nicht empfohlen (Klasse III/B).
Antidiabetische Therapie bei PAD
Bei Patienten mit PAD wird eine enge glykämische Kontrolle mit einem HbA1c < 7 % zur Vermeidung mikrovaskulärer Komplikationen empfohlen (Klasse I/A). SGLT2-Hemmer mit nachgewiesenem kardiovaskulärem Nutzen sollen bei Typ-2-Diabetes und PAD eingesetzt werden – unabhängig von HbA1c-Ausgangswerten oder anderen Glukose-senkenden Medikamenten (Klasse I/A).
Bewegungstherapie nach dem FITT-Prinzip
Walking gilt als bevorzugte Trainingsform. Ist dies nicht möglich, sollten alternative Trainingsmethoden wie Krafttraining, Radfahren oder kombinierte Modalitäten erwogen werden. Das FITT-Prinzip (Frequenz, Intensität – bezogen auf Claudicatio-Schmerz, Trainingszeit, Trainingsform) dient als Grundlage. Empfohlen wird eine Trainingsfrequenz von mindestens dreimal wöchentlich bei einer Dauer von jeweils mindestens 30 Minuten über mindestens 12 Wochen (Klasse IIa/B).
Ein Training bis zu moderaten bis starken Claudicatio-Schmerzen kann die Gehfähigkeit verbessern, Verbesserungen sind aber auch bei geringerer Schmerzbelastung möglich (Klasse IIb/B). Bei guter Toleranz kann die Trainingsintensität im Abstand von 1–2 Wochen stufenweise gesteigert werden.
riesen@medinfo-verlag.ch






