- Daten-Sharing in der Medizin
Verantwortlich dürften hauptsächlich rigorose Datenschutzbestimmungen, aber auch Besitzansprüche an solchen Daten sein. Für seltene Krankheiten ist das eigentlich fatal. Die Frage stellt sich, ob das wirklich im Sinne von Betroffenen sein kann. Ich bezweifle das, und der einfache generelle Forschungskonsent, welcher an den meisten Schweizer Spitälern seit etwa 10 Jahren von den Patienten beim Erstkontakt in einer Klinik ausgefüllt wird, spricht eine klare Sprache: Die Patienten – mit wenigen Ausnahmen – sind bereit, ihre Daten zu teilen und am Fortschritt der Medizin teilzuhaben.
Was mit grossem Erfolg in der Welt der Viren gelungen ist, sollte in Zukunft doch auch mit menschlichen Daten möglich werden. Emma Hodcroft, eine britisch-amerikanische Molekularepidemiologin und Professorin in Basel, ist bekannt für ihre Arbeit im Bereich Virus-Phylogenetik und Open-Science-Initiativen. Sie hat Nextstrain, eine Open-Source-Plattform zur Echtzeit-Verfolgung von Krankheitserregern wie SARS-CoV-2, mitentwickelt und CoVariants.org, ein spezialisiertes Informationsportal zu SARS-CoV-2-Varianten, gegründet. Zudem ist sie Co-Initiatorin von Pathoplexus, einer globalen, offenen Datenbank für virale Pathogene, die mit voller Transparenz und weltweiter Zusammenarbeit hervorragend funktioniert.
In einer zunehmend digitalisierten Wissenschaftswelt ist das Teilen von Daten zu einem zentralen Thema geworden. Besonders in der Medizin ist der Austausch von Daten wünschenswert und theoretisch machbar – für die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, die Entwicklung neuer Therapien und die Verbesserung der Patientenversorgung. Und das alles in Echtzeit. Doch so groß die Chancen, so vielfältig die Hindernisse.
Das elektronische Patientendossier (EPD) ist in der Schweiz ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Doch der Durchbruch des EPD verläuft sehr schleppend – aus mehreren Gründen: Das EPD ist für Patienten freiwillig. Warum eigentlich? Für Leistungserbringer wie Hausärzte, Spitäler, Apotheken oder Versicherer ist der Anschluss nur teilweise verpflichtend. Und schlussendlich: Leistungserbringer können für ihre Patienten ein EPD nicht eröffnen, auch wenn sie es wollten. Dies führt zu einer sehr geringen Verbreitung bei Patienten und Ärzten. Das Gesundheitswesen ist kantonal organisiert, was zu unterschiedlichen technischen Standards, Zuständigkeiten und Zeitplänen führt. Anstelle eines nationalen Systems gibt es mehrere regionale Stammgemeinschaften, die jeweils ihre eigene Infrastruktur betreiben. Umständlichkeiten in der Bedienung und Schnittstellenprobleme dürften sich aber technisch rasch lösen lassen, denkt man. Bleibt eigentlich nur ein «Schubs» Richtung Bund. Der Bundesrat kündigt jedoch erst für 2030 eine umfassende EPD-Revision an, die u. a. eine Pflicht für Arztpraxen vorsieht – also mehr als ein Jahrzehnt nach dem ersten Konzept. Etwas politischer Druck hinsichtlich verpflichtender Vereinheitlichung täte hier gut («Top-down-Ansatz»). Und, einmal etabliert, könnte jeder Patient selber und freiwillig entscheiden, seine Daten zu teilen («Bottom-up-Ansatz»). Das EPD wäre prinzipiell hervorragend geeignet für ein sicheres, kontrolliertes und strukturiertes Datensharing – allerdings tritt der Nutzen erst ein, wenn eine kritische Masse an Patienten und Gesundheitsfachpersonen das EPD auch nutzt. Es liegt noch etwas Arbeit vor uns. Selbstverständlich sind meine Ausführungen vereinfacht und gehen nicht in die Tiefe – ganz dem Denkanstoss eines Editorials entsprechend.
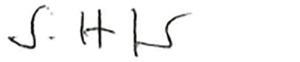
Universitätsspital Zürich
Institut für Pathologie und Molekularpathologie
Schmelzbergstrasse 12
8091 Zürich
silvia.hofer@usz.ch






