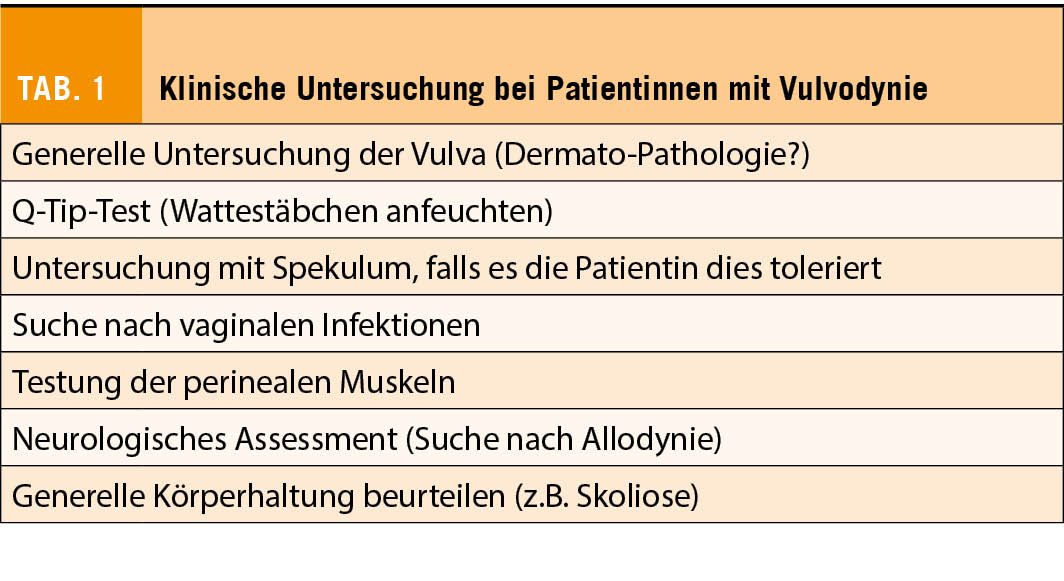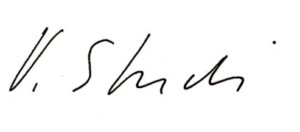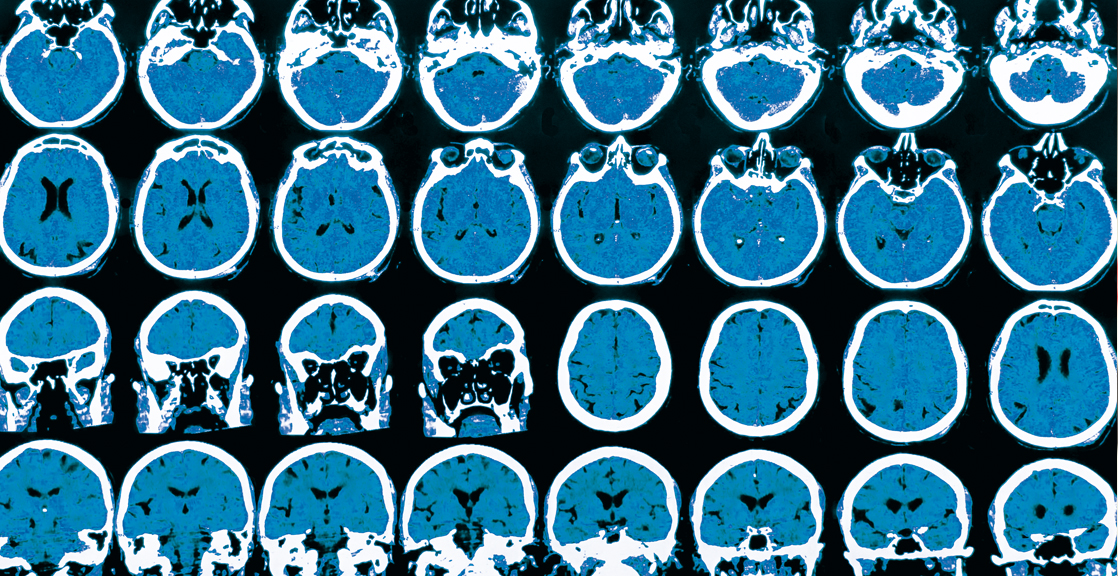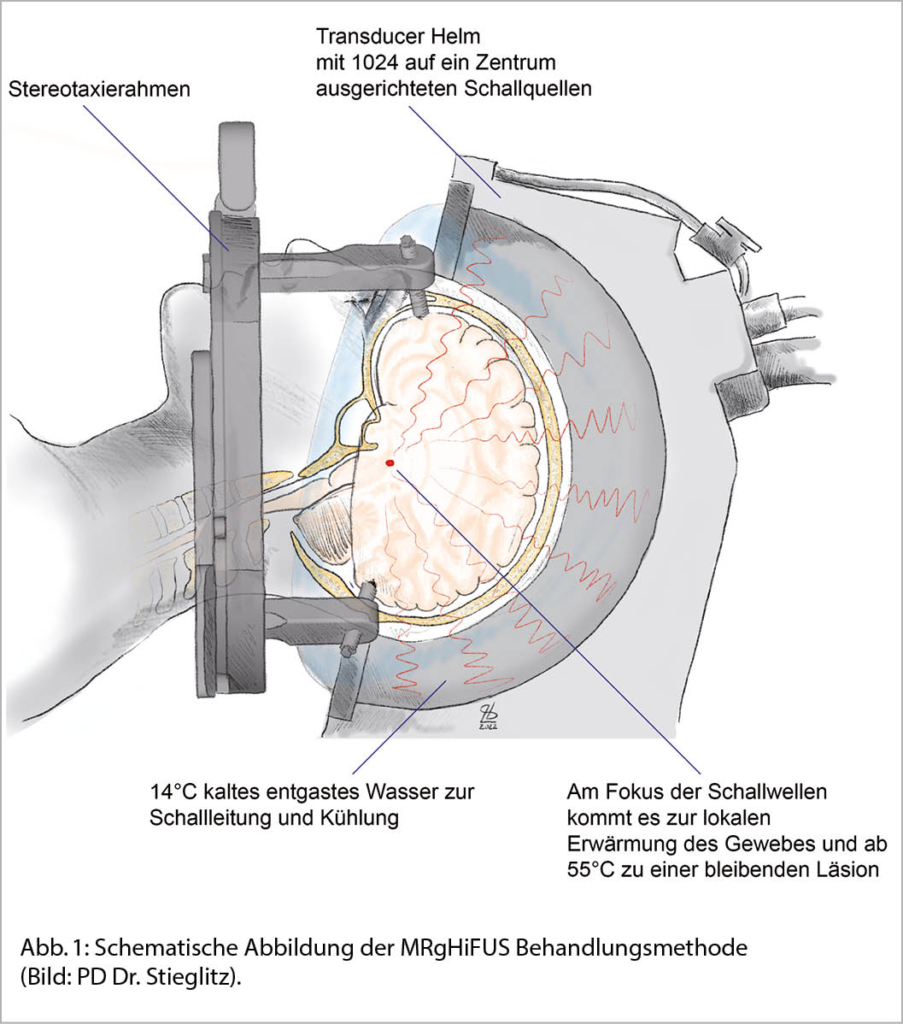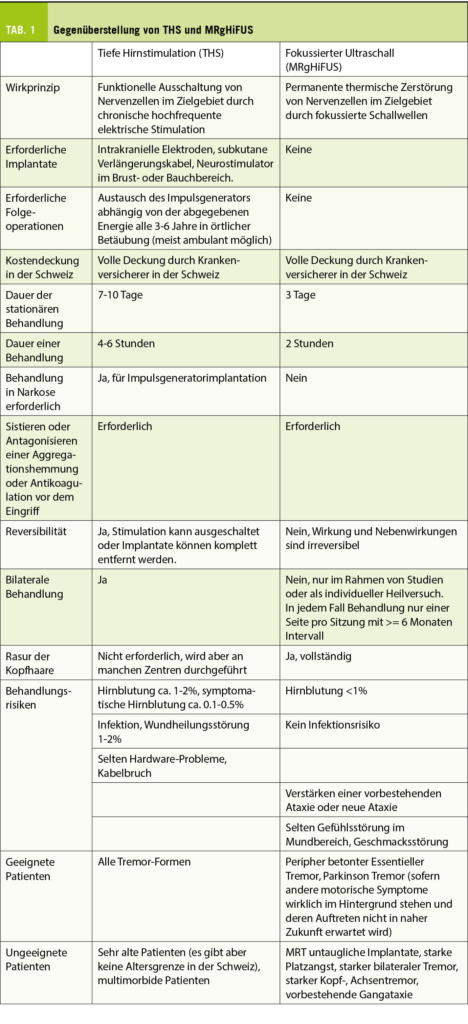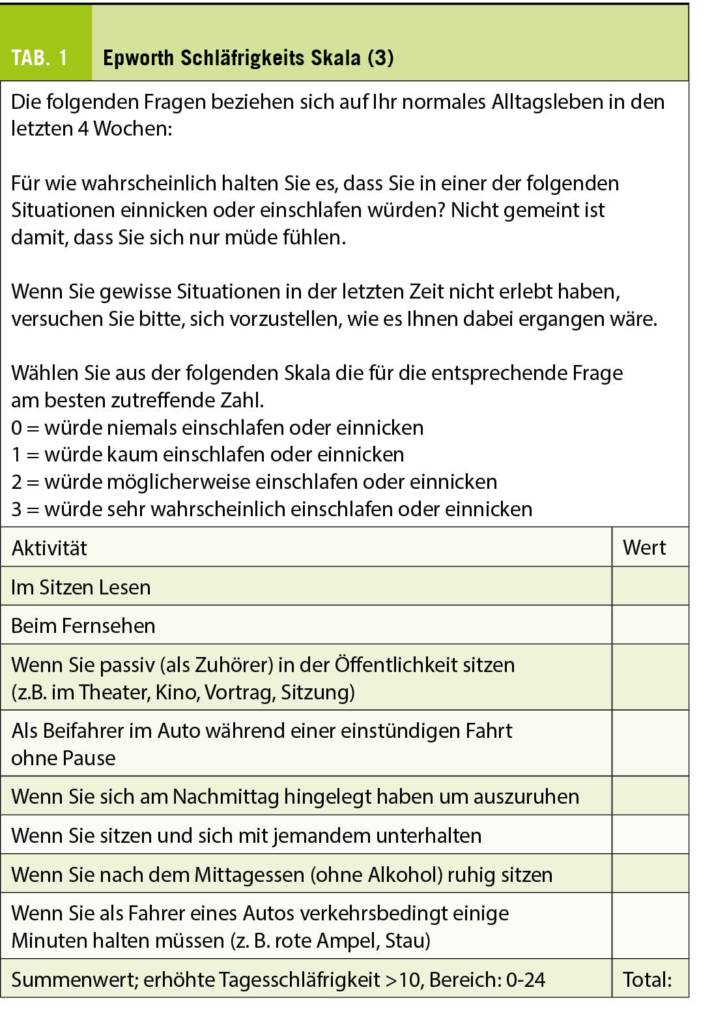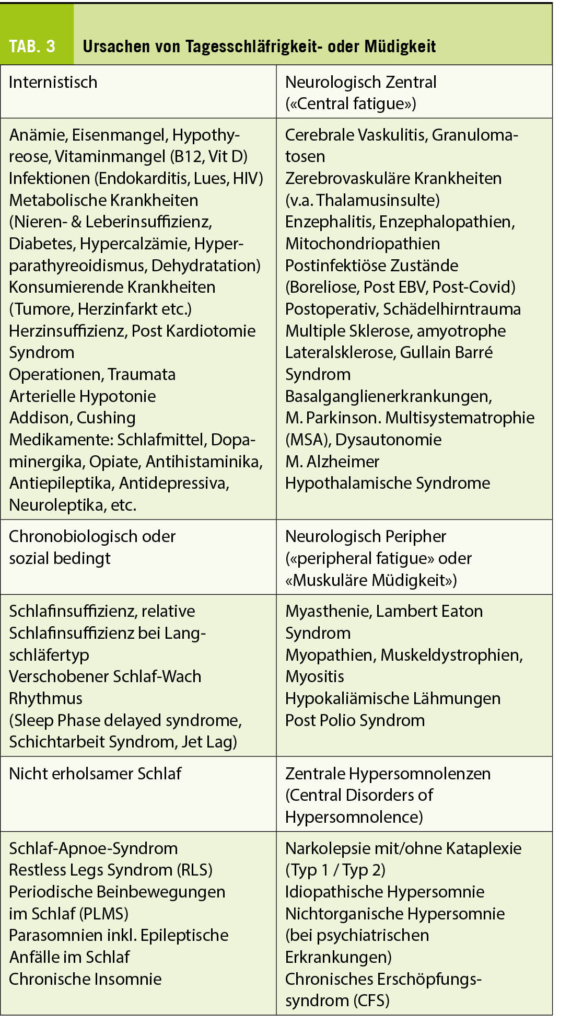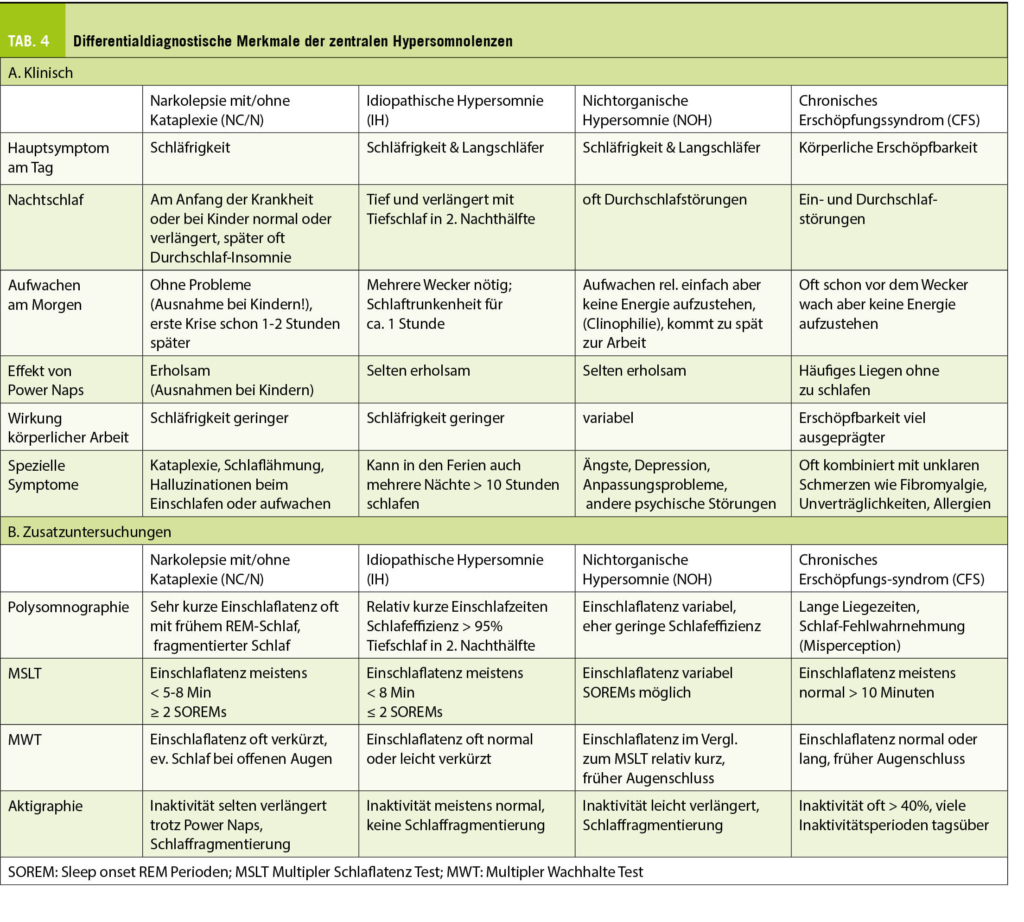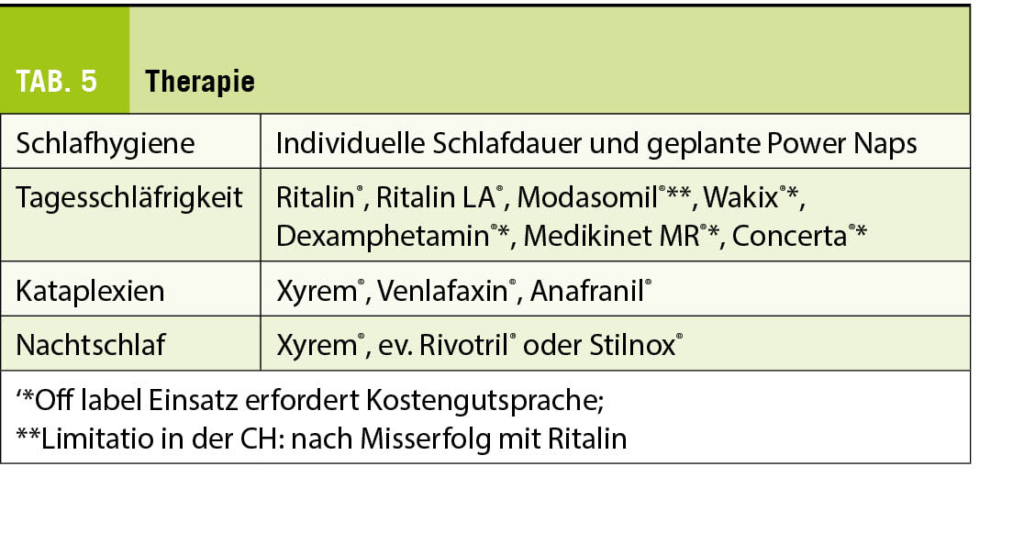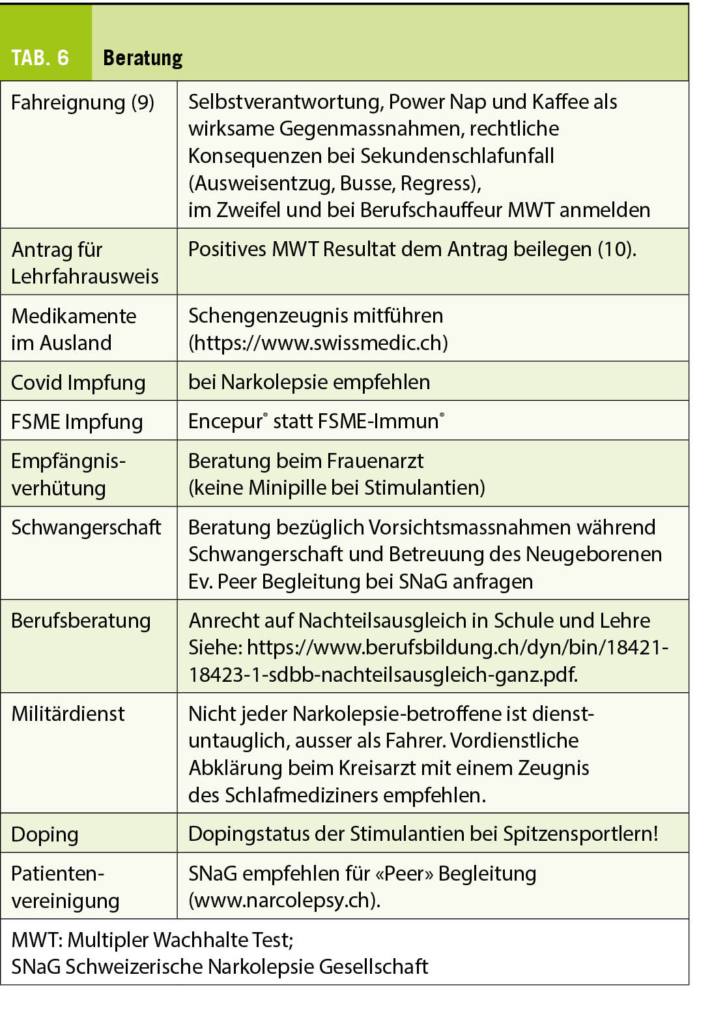Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, die Schwangere und deren Fötus vor Gefährdungen bei der Arbeit zu schützen. Eine Schwangere gilt grundsätzlich als arbeitsfähig, ausser sie ist krank. Hingegen darf sie nicht arbeiten, wenn das ungeborene Kind oder sie selbst durch ihre Arbeit gefährdet wird. Es ist Aufgabe der gynäkologisch betreuenden Ärztinnen und Ärzte zu beurteilen, wie der Gesundheitszustand der Schwangeren ist, ob Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz vorhanden und genügend wirksam sind. Die Ärztin oder der Arzt ist befugt, Anpassungen an die Arbeitsbedingungen zu verlangen oder ein Beschäftigungsverbot auszusprechen. Die Kontrolle der Arbeitsbedingungen vor Ort ist Aufgabe des kantonalen Arbeitsinspektorates.
Every employer is responsible for protecting pregnant women and her unborn from workplace dangers. A pregnant woman is typically deemed fit for work unless she is unwell, or her unborn child or her own safety is jeopardized by her job.
Gynaecologists are responsible for assessing the pregnant woman’s health and the effectiveness of workplace safety precautions. The doctor has the authority to demand changes to working conditions or to prohibit employment. The cantonal labour inspectorate is in charge of on-site examination of working conditions.
Key Words: Ability of pregnant women to work, protective measures at the place of work, control of working conditions
Hintergrund
Schwangere und Stillende werden als Arbeitnehmerinnen besonders geschützt. Für diesen Schutz ist grundsätzlich der Arbeitgeber verantwortlich, aber der gynäkologisch tätigen Ärztin bzw. dem gynäkologisch tätigen Arzt fallen besondere Aufgaben in der Kontrolle der der Wirksamkeit der Schutzmassnamen und Festlegung der Eignung zu.
Im Arbeitsgesetz (ArG) und dessen Verordnungen sind verschiedene Bestimmungen zum Schutz der Schwangeren und Stillenden festgelegt. Diese kann man grob in allgemeine Schutzmassnahmen und Schutzmassnamen, die abhängig sind von der Präsenz von sog. gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten (GOBA) einteilen. Die allgemeinen Schutzmassnahmen gelten unabhängig von den Bedingungen am Arbeitsplatz und sind in jedem Fall einzuhalten (z.B. max. 9h Arbeit pro Tag, keine angeordnete Überzeit, keine Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr 8 Wochen vor der Geburt). Zu den GOBA gehören das Bewegen schwerer Lasten von Hand, Bewegungen und Körperhaltungen, die zu vorzeitiger Ermüdung führen, Arbeiten, die mit Einwirkungen wie Stössen, Erschütterungen oder Vibrationen verbunden sind, Arbeiten bei Überdruck, z.B. in Druckkammern, beim Tauchen, Arbeiten bei Kälte, Hitze oder bei Nässe; Arbeiten unter Einwirkung schädlicher Strahlen oder Lärm; Arbeiten unter Einwirkung schädlicher Stoffe oder Mikroorganismen sowie Arbeiten in Arbeitszeitsystemen, die erfahrungsgemäss zu einer starken Belastung führen.
Liegen solche GOBA vor, muss der Arbeitgeber die Unbedenklichkeit der Arbeit beweisen. Gemäss Art. 2 Abs. 2 Mutterschutzverordnung darf eine Schwangere nur dann beschäftigt werden, wenn keine Gefährdung für Mutter und Kind aus der Arbeit im Betrieb oder Betriebsteil hervorgeht. Jeder Betrieb mit weiblichen Angestellten muss mit einer Gefährdungsermittlung überprüfen, ob gefährliche oder beschwerliche Arbeiten gemäss Mutterschutzverordnung vorliegen. Liegen solche Arbeiten vor, muss der Arbeitgeber eine Risikobeurteilung durch eine fachlich kompetente Person durchführen lassen. Führt eine schwangere oder stillende Frau dann gefährliche oder beschwerliche Arbeiten aus, muss der Arbeitgeber die Schutzmassnahmen gemäss Risikobeurteilung umsetzen. Gemäss Art. 18 Abs. 2 Mutterschutzverordnung sorgt der Arbeitgeber anschliessend dafür, dass der betreuenden Ärztin bzw. dem betreuenden Arzt diese Information zur Verfügung steht, damit eine umfassende Beurteilung der Arbeitsfähigkeit vorgenommen werden kann.
Als fachlich kompetente Personen zur Durchführung einer Risikobeurteilung gelten Arbeitsmedizinerinnen und –mediziner, Arbeitshygienikerinnen- und –hygieniker sowie weitere Spezialisten mit nachgewiesenen Kenntnissen und Erfahrungen. In der Regel gehören Gynäkologinnen und Gynäkologen nicht zu den fachlich kompetenten Personen.
Eignungsuntersuchung
Gemäss Mutterschutzverordnung (Art. 2) muss die zuständige Ärztin oder der zuständige Arzt, die oder der die Schwangere im Rahmen der Mutterschaft betreut, den Gesundheitszustand der schwangeren Frau oder der stillenden Mutter beurteilen. Der Arzt oder die Ärztin nimmt eine Eignungsuntersuchung an der schwangeren Frau oder der stillenden Mutter vor. Sie oder er berücksichtigt bei der Beurteilung:
- die Anamnese und den Status der Arbeitnehmerin;
- bei anamnestisch vorhandener Exposition gegenüber GOBA (zum Beispiel Giftstoffe, Strahlung, Mikroorganismen, Schicht- und Nachtarbeit, Akkordarbeit, sauerstoffarme Atmosphäre, Passivrauchen): Das Ergebnis der vom Betrieb durch eine fachlich kompetente Person durchgeführten Risikobeurteilung;
- allenfalls weitere Informationen, die sie oder er aufgrund einer Rücksprache mit dem Verfasser oder der Verfasserin der Risikobeurteilung oder dem Arbeitgeber erhalten hat.
Entscheid
Gemäss Art. 3 Mutterschutzverordnung entscheidet die betreuende Ärztin bzw. der betreuende Arzt anschliessend, ob eine Beschäftigung vorbehaltslos, unter bestimmten Voraussetzungen oder nicht mehr möglich ist. Gemäss Mutterschutzverordnung darf eine schwangere Frau oder stillende Mutter im von einer Gefahr betroffenen Betrieb oder Betriebsteil nicht beschäftigt werden, wenn:
- keine oder eine ungenügende Risikobeurteilung vorgenommen wurde;
- die nach der Risikobeurteilung erforderlichen Schutzmassnahmen nicht umgesetzt oder nicht eingehalten werden;
- die nach der Risikobeurteilung getroffenen Schutzmassnahmen nicht genügend wirksam sind, oder andere Hinweise auf eine Gefährdung bestehen (z.B. Passivrauchen).
Ein Beschäftigungsverbot durch die betreuende Ärztin oder den betreuenden Arzt beinhaltet in der Regel einen der vier oben genannten Gründe und eine Frist, wie lange es für diesen Betrieb oder Betriebsteil gültig ist.
Kann eine Schwangere oder Stillende nicht ohne Gefährdung beschäftigt werden, und kann der Arbeitgeber ihr nicht eine gleichwertige Ersatzarbeit anbieten, darf sie nicht weiterarbeiten und hat weiterhin Anspruch auf 80% ihres Lohnes gemäss Art. 35 ArG. Gemäss Art. 59 ArG ist der Arbeitgeber strafbar, wenn er den Vorschriften des Sonderschutzes von weiblichen Arbeitnehmerinnen vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt.
Vorlage für ein «ärztliches Zeugnis»
Werden die Schutzmassnahmen nicht genügend umgesetzt oder eingehalten, kann die Schwangere oder die Ärztin oder der Arzt das kantonale Arbeitsinspektorat beiziehen, um die Situation am Arbeitsplatz klären zu lassen. Bis zur Klärung soll ein temporäres Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Der Arbeitgeber muss zusätzliche Kosten der medizinischen Untersuchung und der Beratung tragen, soweit nicht ein Versicherer der Arbeitnehmerin dafür aufkommt.
Das Beschäftigungsverbot bei gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten ist vom Arbeitsunfähigkeitszeugnis bei Krankheit klar zu unterscheiden. Diese Unterscheidung hat Auswirkungen auf die Lohnfortzahlung. Bei einem Beschäftigungsverbot muss der Arbeitgeber weiterhin den Lohn in der Höhe von 80% entrichten (Art. 35 ArG), im Krankheitsfall besteht ebenfalls eine Lohnfortzahlungspflicht, die durch eine allenfalls vorhandene Krankentaggeldversicherung gedeckt wird.
Der Arzt oder die Ärztin trägt die Verantwortung, die Situation richtig einzuschätzen und bei gegebenen Voraussetzungen ein Beschäftigungsverbot auszusprechen. Aus Beweisgründen ist das Beschäftigungsverbot in der Krankengeschichte zu dokumentieren.
Gefälligkeitszeugnisse sind standesrechtlich unzulässig und können zu einer strafrechtlichen Verurteilung führen (Art. 34 FMH-Standesordnung bzw. Art. 318 Strafgesetzbuch).
Die Kommunikation zwischen Arzt oder Ärztin und Arbeitgeber untersteht dem medizinischen Berufsgeheimnis. Für arbeitsmedizinische Fragen hat die FMH einen Anhang 4 zur Standesordnung FMH erlassen.
Was tun, wenn …?
In fast allen Fällen, wo eine Unsicherheit über den korrekten Schutz von Schwangeren oder Stillenden vorliegt, gilt das Vorsorgeprinzip. Die betreuende Ärztin bzw. der betreuende Arzt stellt ein Beschäftigungsverbot aus, bis die Schutzmassnahmen umgesetzt und wirksam sind. Sollten hier Unklarheiten oder Konflikte auftreten, ist das kantonale Arbeitsinspektorat möglichst schnell einzuschalten. Es ist die dafür zuständige Behörde.
- Es ist nicht die Aufgabe der betreuenden Ärztin bzw. des betreuenden Arztes:
- die Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz sicherzustellen (dafür ist der Arbeitgeber zuständig. Im Zweifelsfall ist ein Beschäftigungsverbot auszusprechen);
- die Risiken am Arbeitsplatz zu beurteilen, eine Risikobeurteilung zu erstellen oder Schutzmassnahmen für diese Risiken festzulegen (dafür ist der Arbeitgeber bzw. eine fachlich kompetente Person zuständig);
- Sonderwünsche des Arbeitgebers, der Arbeitnehmerin oder deren Familie zu befolgen
- die Rolle des kantonalen Arbeitsinspektorats oder der Richterin bzw. des Richters zu übernehmen.
Informationsmaterial
Unter www.seco.admin.ch/mutterschutz, Rubrik «Fachspezialisten» findet man:
- Broschüre «Leitfaden für gynäkologisch tätige Ärztinnen und Ärzte» mit allen Informationen im Detail;
- Checkliste «Mutterschutz am Arbeitsplatz»;
- Übersichtstafel für Mutterschutz und Schutzmassnahmen;
- Vorlage für ein ärztliches Zeugnis für schwangere Frauen und stillende Mütter für den Entscheid bzw. Beschäftigungsverbot.
Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG
Staatssekretariat für Wirtschaft
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Staatssekretariat für Wirtschaft
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.