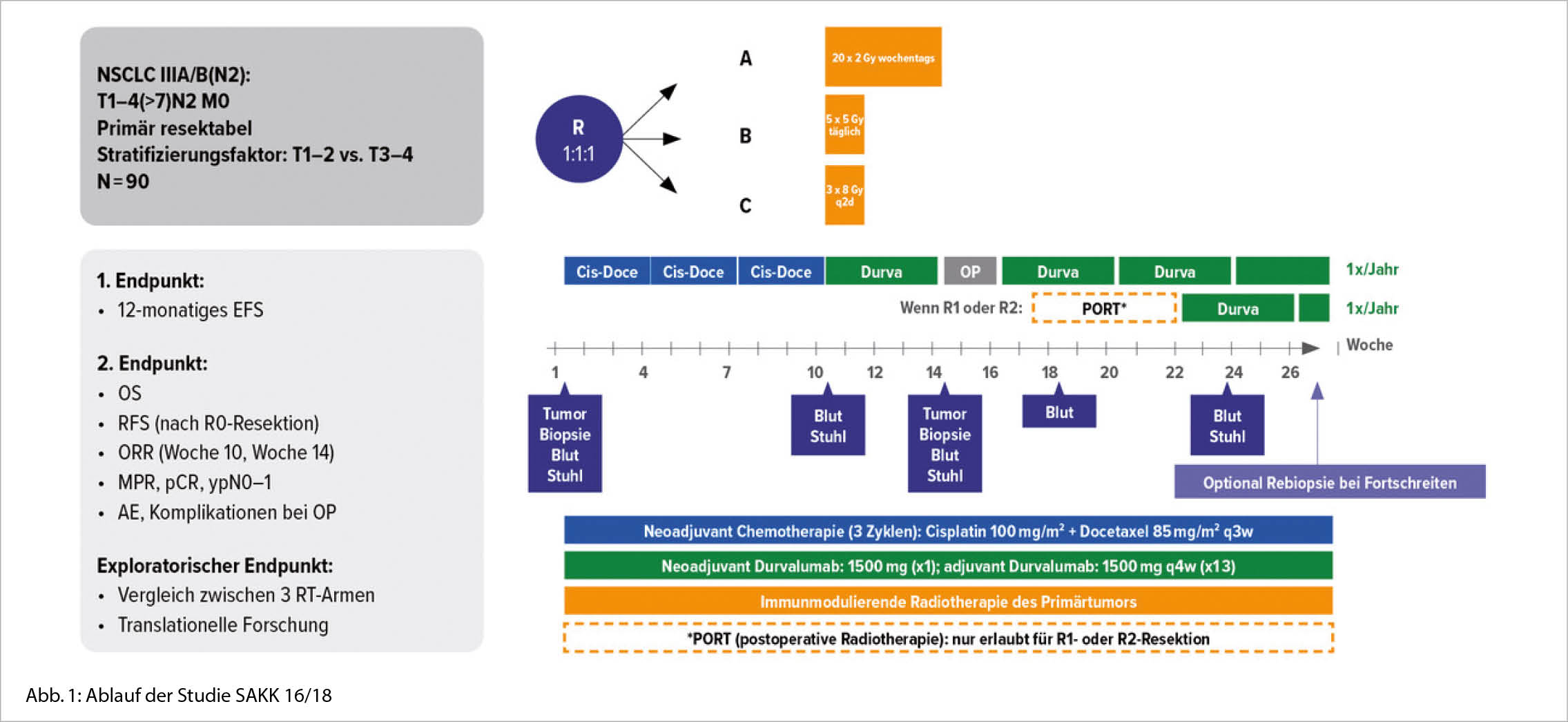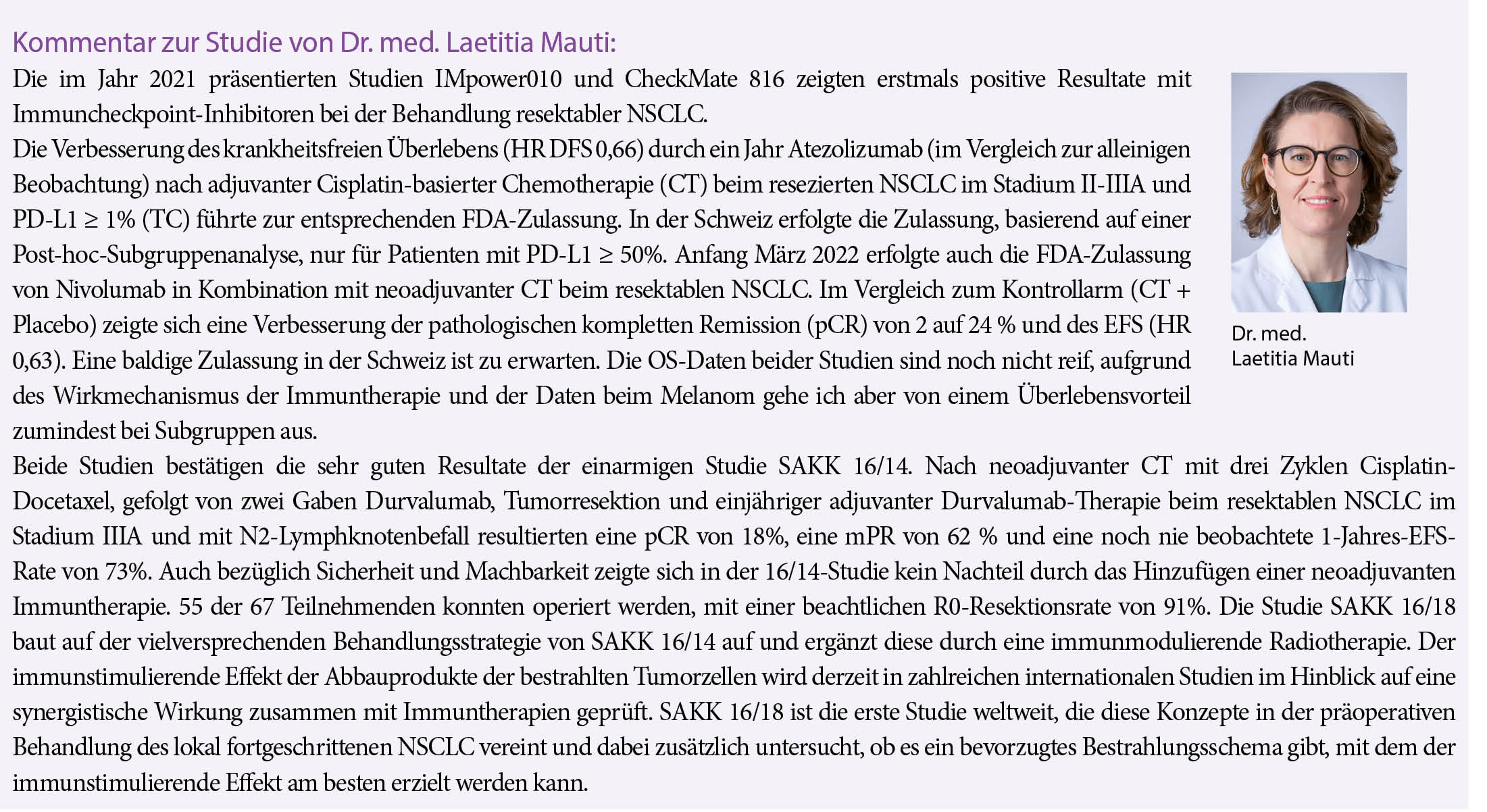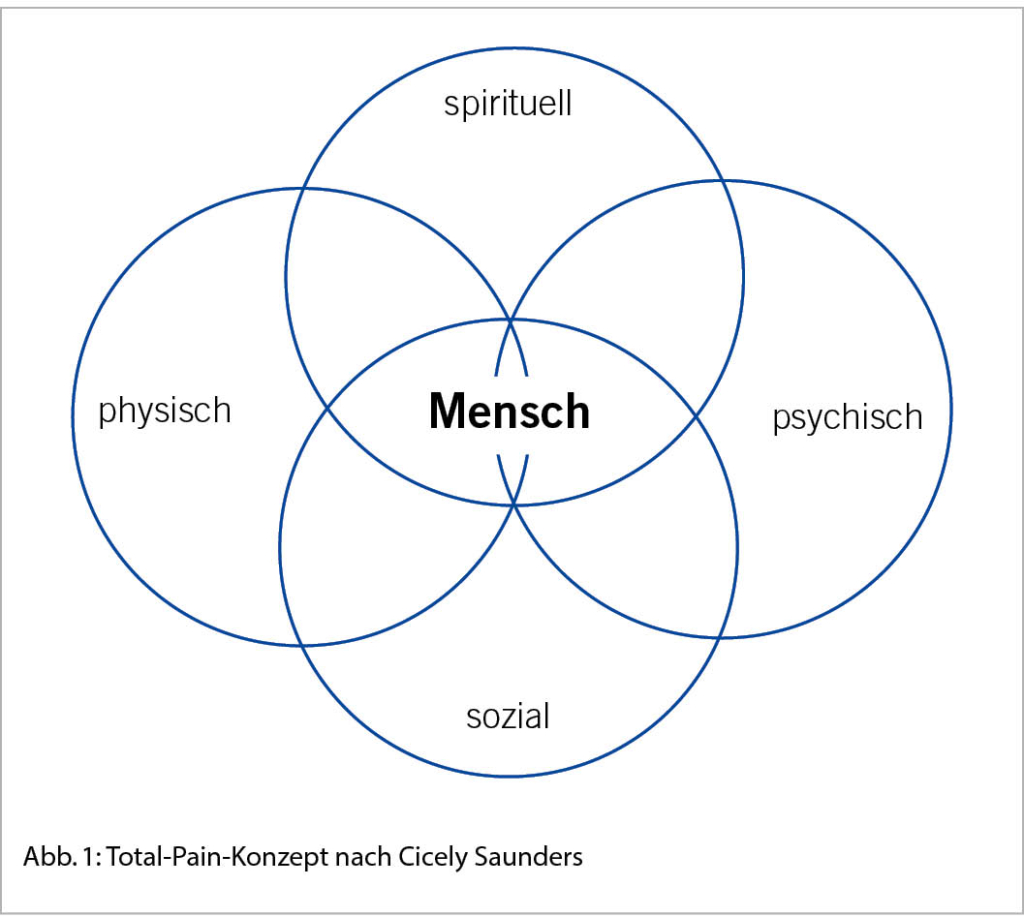Im TARGIT-A Trial wurden zwischen 2000 und 2012 3451 Patientinnen im Alter von >= 45 Jahren mit invasivem duktalen Mammakarzinom, unifokal und <3.5 cm (MRI nicht verlangt), die eine brusterhaltende Behandlung erhielten, aufgenommen (1). Die Randomisation erfolgte zunächst in einem «prepathology stratum» vor der Operation 1:1 zwischen einer intraoperativen Bestrahlung des Tumorbettes (IORT) im Rahmen der primären Chirurgie oder einer Ganzbrustbestrahlung (GBRT) wenige Wochen im Anschluss an die Tumorexzision (nach «needle biopsy», «prepathology stratum», n=2298).
Die IORT erfolgt mit 50 kV Röntgenstrahlung von einer punktförmigen Miniaturquelle, angebracht im Zentrum eines kugelförmigen Applikators. Verschrieben wurden 20 Gy an der Oberfläche des Applikators, die in 1 cm auf etwa 5-6 Gy abfallen. Die über dem Exzisionsbereich liegende Haut wird dabei weggehalten (bei hautnah gelegenen Tumoren wurde diese reseziert), die tiefer liegenden bzw. benachbarten Gewebe erhalten wegen des steilen Abfalls der Weichstrahlung sehr geringe Dosen. Bei Brustwand-nahe gelegenem Tumor, bzw. dünner Thoraxwand wurde ein mit Tungsten imprägnierter Gummilappen zwischen Exzisions- bzw. Zielbereich und m. pectoralis gelegt. Falls die histologische Untersuchung des Resektats nach IORT vorweg definierte Risikobefunde ergab, bei denen eine GBRT Standard ist, wurde diese bei etwa 21% postoperativ durchgeführt. Die Randomisation erfolgte vor der Operation. Zu den Risikobefunden zählten immer invasives lobuläres Karzinom, R1 Resektion auch bei Nachexzision im Rahmen des Ersteingriffes, extensives DCIS. Zusätzlich konnten die beteiligten 33 Zentren aus 11 Ländern weitere Risikobefunde (z.B. G3, Lymphknotenbefall, Lymphgefässinvasion) vorweg definieren, die dann für die ganze Studie beibehalten werden mussten (… «eligibility was not confined to low-risk patients: grade 3 cancer, involved nodes or higher risk receptor status, did not exclude. Therefore, a large number of patients in each category of higher risk were included, allowing meaningful subgroup analysis»).
Auf Vorschlag etlicher Zentren wurde 2004-2012 ein zweites Stratum mit 1153 Patientinnen separat im Anschluss an die primäre Chirurgie randomisiert zwischen einer IORT oder einer GBRT («post-pathology stratum»). Für die IORT war ein zweiter chirurgischer Eingriff erforderlich, einige Wochen nach der Erstoperation mit Tumorexzision.
Das ausgewertete Primärresultat war die absolute Differenz an Lokalrezidiven (invasives oder in situ Karzinom in der erhaltenen Brust), für die 2.5% nach 5 Jahren (ab dem Zeitpunkt der Rando-misation) als Obergrenze der Nicht-Inferiorität festgesetzt wurde. Bei allen Diskussionen und Entscheidungen für dieses Protokoll waren immer auch VertreterInnen von PatientInnenverbänden wie auch Überlebende mit Brustkebsanamnese beteiligt. Weitere Resultate umfassten Komplikationen und Mortalität – dabei wurde u.a. eine formale Analyse bezüglich kardiovaskulärer Todesfälle und Zweittumoren verlangt. Für eine Analyse verschiedener Untergruppen wurde eine Cox-Multivariatanalyse (MVA) durchgeführt. Auf Grund der seinerzeitigen Kenntnisse wurde unter den vorgeplanten Untergruppenanalysen besonders der Status des Progesteronrezeptors als Prädiktor des Rezidivrisikos untersucht.
«The follow-up of the TARGIT-A trial was long, a complete follow up at a prespecified level of 95% was achieved at mid 2019» (2). Rezidivraten in der behandelten Brust nach 5 Jahren im «prepatho-logy stratum» (intention to treat): IORT: 2.23%, GBRT: 1.02%, Differenz 1.21% (95%CI 0.33-2.09). Im Langzeitverlauf (Median 8.6 J., Maximum 18.9 J., Interquartilenbereich 7.0-10.6) ohne statistisch signifikanten Unterschied für das Überleben ohne Lokalrezidiv (HR 1.13, 95% CI 0.91 to 1.41, P=0.28, wenn nur die invasiven Lokalrezidive gezählt werden, ein HR von 1.04 (0.83-1.14, p=0.83.14 95%CI), p=0.27, desgleichen auch für das Überleben ohne Fernmetastasen (HR 0.88, 95% CI 0.69 to 1.12, P=0.30), Gesamtüberleben (HR 0.82, 0.63 to 1.05, P=0.13), und brustkrebs-spezifisches Überleben (HR 1.12, 0.78-1.60, P=0.54).
Die Mortalität durch nicht-brustkrebsspezifische Ursachen war in der Gruppe mit IORT des «prepathology stratum» signifikant geringer (HR 0.59, 95% CI 0.40-0.86, p=0.005). In der Gruppe mit IORT des «prepathology stratum» war die brustkrebsspezifische Mortalität auch in den Untergruppen mit oder ohne supplementäre GBRT signifikant geringer als nach GBRT (die auch deutlich häufiger einen boost erhielten (ca. 40% vs 21% in der IORT-Gruppe)).
Die Kurven der kumulativen Lokalrezidivraten zeigten nach 10-12 Jahren nach IORT einen absoluten Unterschied von etwa 3-4% zugunsten der GBRT, unter Berücksichtigung der alleinigen invasi-ven Lokalrezidivraten war der Unterschied zugunsten der GBRT geringer, das Überleben ohne Mastektomie war nicht signifikant verschieden (HR 0.96, 95% CI 0.78 to 1.19, P=0.74).
Auch in den verschiedenen analysierten Untergruppen zeigte die MVA nicht signifikante Unterschiede der IORT vs GBRT.
Somit war IORT, appliziert während der Erstoperation nach klinischer Diagnostik (physikalischer Untersuchungsbefund, meist konventionelle Mammographie und meist «needle biopsy») plus supplementäre GBRT (bei etwa 20%) der GBRT nach der Erstoperation nicht unterlegen. (1,2,8)
Ungeklärt scheint uns die Differenz dieser Langzeitdaten bezüglich der Lokalrezidive zu den Abschätzungen von MC Ward et al (3), die unter Verwendung der publizierten Daten der IORT Autoren eine signifikant höhere Rezidivrate berechneten («Our analysis estimated that the risk of local failure at 10 years in the TARGIT-A pre-pathology cohort is approximately 1.7% with WBRT (95% CI 0%-4.3%) and 5.5% in the pragmatic risk-adapted TARGIT strategy (95% CI, 2.9%-8.0%). A weighted average estimate suggests that the risk of local failure in low-risk women treated with TARGIT alone is approximately 6.6% at 10 years (95% CI, 3.3%-10.0%), with an estimated difference of 4.9% (95% CI, 0.6%-9.2%) compared with EBRT»).
Untersucht wurde ferner das Lokalrezidiv als Risikoindikator für Fernmetstasen und die Mortalität (brustkrebsbedingte Mortalität , ebenso die Gesamtmortalität, um Fehlklassifikation der Todesursa-che zu berücksichtigen): ein Lokalrezidiv im Arm mit GBRT war mit einer höheren Rate an Fernmetastasen, wie auch brustkrebsbedingter wie Gesamtmortalität verbunden (p für Interaktion: 0.008, HR 0.003-0.02), nicht aber bei der Gruppe mit IORT oder IORT plus GBRT: die Anzahl Todesfälle über die gesamte Beobachtungszeit bei denen mit Lokalrezidiven innert 5 Jahren war: 3/24 (13%) in der (IORT-Gruppe), 7/11 (63%) in der GBRT-Gruppe. Als mögliche Erklärung könnte nach den Autoren u.a. vermutet werden, dass die Mehrheit dieser Lokalrezidive nach TARGIT-IORT neue Primärtumoren mit besserer Prognose sind als Lokalrezidive nach GBRT, während solche neuen Primärtumoren von der GBRT verhindert würden. Dafür würde auch der höhere Anteil an DCIS bei den Lokalrezidiven nach IORT im Unterschied zur GBRT (12:32 IORT vs. 1:19 verglichen mit GBRT).
Auch fand sich eine signifikante Reduktion der nicht-brustkrebsbedingten Mortalität nach IORT (45 versus 74 Fälle nach GBRT) (HR: 0.59, p= 0.005). Diese Ergebnisse in den Publikationen bis 2016 wurden auch in den neueren Analysen (Publikationen von 2020/2021 (2,8)) bestätigt. Für die Gruppe mit «lower risk» (</=2 cm, G3, ER negativ) war das Gesamtüberleben nach IORT 4.2% höher als nach GBRT (91.7% vs 87.3%, HR 0.65, 95%CI 0.44-0.96, p=0.0308). Die Anzahl nicht-brustkrebsbedingter Todesfälle war in der IORT-Gruppe 45/1140 (6/241 bei jenen mit zusätzlicher EBRT, 39/899 nach IORT allein und 74/1158 nach EBRT). 79% dieses Unterschiedes war durch kardiovaskuläre oder pulmonale Ursachen und Zweittumoren bedingt. Auf Grund dieser Daten ist der Unterschied durch die GBRT (mit dem Risiko einer höheren kardialen Belastung) allein nicht erklärbar. Bei Unterteilung G1/2 vs G3 fand sich ein Unterschied nur bei G1/2, bei G3 etwa gleiche Mortalität (ca. 20% der Gesamtgruppe mit G3).
Zahlen für n at risk nach 10 Jahren sind relativ klein für die Gruppe IORT plus supplementäre GBRT (ca. 33% der Anfangszahl; Fig.1 in (8), ca. etwas über 70 Patientinnen mit IORT plus supplementäre GBRT nach 10 Jahren – wenn man dann noch halbiert nach bestrahlter Thoraxseite wegen kardialer Belastung der seinerzeit angewendeten RT-Techniken, werden für uns die Zahlen etwas zu klein für eine konklusive Aussage über fehlenden Einfluss einer Kardiotoxizität durch GBRT.
TARGIT-A «postpathology stratum»: (10)
Die Lokalrezidivrate nach 5 Jahren («complete follow up») im Arm mit IORT lag bei 23/581 (3.96%), nach GBRT bei 6/52 (1.05%), die Differenz 2.9% mit einem oberen Wert des 90% CI bei 4.4%, überstieg damit die Obergrenze des später strenger festgelegten non-inferiority Kriteriums.
Kaplan Meier Schätzung 12 Jahre:
- Lokalrezidivfreies Überleben: IORT 75.3% (70.72-79.72), GBRT 78.38% (72.32-83.27) p=0.052
- Mastektomiefreies Überleben: IORT 77.80% (72.57-82.16), GBRT 80.44% (75.16-84.71) p=0.38
- Fernmetastasenfreies Überleben: IORT 81.98 (76.91-86.04), GBRT 82.18% (76.44-86.65) p=0.98
- Gesamtüberleben: IORT 83.13 (78.11-87.10), GBRT 84.72 (79.52-88.70) p=0.80
- Brustkrebsbedingte Mortalität: IORT 4.39% (2.77-6.93), GBRT 4.63% (2.52-8.43) p=0.5
- Mortalität durch andere Ursachen: IORT 13.05% (9.35-18.05) GBRT 11.17% (7.78-15.88) p=0.89
Konsequenzen für die Praxis?– Offene Fragen:
Vorteile der IORT: dass bei einem Teil der Patientinnen mit Brustkrebs die lokale Behandlung mit einem einzigen Eingriff durchgeführt werden kann, mit den heutigen Möglichkeiten der Diagnostik kann die Indikation für eine solche Behandlung so gut gestellt werden, dass eine zusätzliche GBRT mit oder ohne Lymphabflusswege bei etwa 20% erforderlich ist. Die in der Studie beobachtete 4-5% höhere Gesamtüberlebensrate (in der Gruppe mit G1/2) ist auf Grund der Zahlen noch zu wenig gesichert. In der TARGIT-B Studie wird der intraoperative boost bei der Primäroperation mit dem perkutan applizierten boost einige Zeit postoperativ verglichen, wobei alle Patientinnen eine GBRT erhalten (NCT01792726, (9). In dieses Protokoll werden auch Patientinnen <45 Jahren aufgenommen. Im Informationsblatt wird auch auf die oben aufgeführte Möglichkeit einer unmittelbaren Einwirkung der IORT auf die Mikroumgebung des Tumors und die Wundvorgänge eingegangen: «A mathematical model of TARGIT developed recently (funded by Cancer Research UK) suggests that it could be superior to conventional radiotherapy. Translational research has found that TARGIT impairs the surgical-trauma-stimulated proliferation and invasiveness of breast cancer cells. This effect of radiotherapy may act synergistically with its tumoricidal effect yielding a superior result». Die Möglichkeit immunologischer Effekte wie der unmittelbaren (5,6, 11-15) Effekte auf die Region der Exzisionswunde (z.B. reaktive Effekte des Organismus zur Wundheilung, die auch noch vorhandene Tumorstammzellen zur Vermehrung stimulieren können), sind interessante Forschungsthemen. Hierfür ist nach diesen Daten die in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Exzision applizierte Bestrahlung erforderlich, bei der auch die darüberliegende Haut besser geschont werden kann, als mittels perkutaner Bestrahlung kurz vor der Operation möglich ist. Zur weiteren Analyse der IORT sind deshalb weitere Studien aktiv (11-15). Auch die etwas höhere Rate an Rezidiven in der Brust beim «postpathology stratum» könnte dafür sprechen, dass die o.g. Effekte einer zeitlich eng mit der Exzision verbundenen lokalen Bestrahlung auf das Wundbett und Mikroumgebung des Tumors von Bedeutung ist. Nachteil ist, dass ein zusätzliches Gerät für die IORT erforderlich ist, das an vielen Orten verfügbar sein müsste. Ausserdem machen auch andere Faktoren logistisch die Organisation der notwendigen dosimetrischen und radioonkologischen Expertise (personell und materiell) zusammen mit dem operativen System anspruchsvoll. Falls der beobachtete Effekt auf das Gesamtüberleben nicht gesichert werden kann, scheint uns bei der derzeitigen Technik der IORT des Brustkrebses eine perkutane RT (GBRT oder partial) mit etwa 5 Sitzungen effizienter – bei mindestens gleich guten Resultaten. Gleichzeitig sind weitere Differenzierungen der molekularen Charakterisierung des Brustkrebses schnell im Anstieg, auch in der langen Laufdauer der referierten Studie hat die Systemtherapie an Effektivität auch in der lokoregionalen Tumorkontrolle zugenommen – alles Faktoren, die die zusätzlich zu den laufenden Studien der präoperativen perkutanen Bestrahlung und ihrem Einsatz im Rahmen der neoadjuvanten Systembehandlung Indikation, Dosierung, Fraktionierung beeinflussen werden. Überflüssig zu sagen, dass eine Ausnützung der raschen Erkenntnisfortschritte und interessanter Thesen neben Überlegungen zum administrativen Aufwand geeigneter Untersuchungen mehr «MitarbeiterInnen», auch in ausserakademischen Institutionen und Produktion auswertbarer und verfügbarer Daten unverzichtbar macht – zentrale Eigenschaft einer Wissensgesellschaft.
Prof. Dr. med. Christoph Glanzmann
Prof. Dr. med. Gabriela Studer
1. Vaidya JS et al: An international randomised controlled trial to compare TARGeted
intraopera-tive radioTherapy (TARGIT) with conventional postoperative radiotherapy after breast-conserving surgery for women with early-stage breasr cancer (the TARGIT-A) trial. Health Technol Assess 2016, 20 (73)
2. Vaidya JS et al: Long-Term survival and local control outcomes from single dose targeted in-traoperative radiotherapy during lumpectomy (TARGIT-IORT) for early breast cancer. TARGIT-A randomised clinical trial. Brit Med J 2020, 370, m2836
3. Ward MC et al.: An estimate of local failure in the TARGIT-A trial of Pre-pathology intraopera-tive radiation therapy for early breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2022, Jan 19, S0360-3016 (online ahead of print)
4. Corradini S et al: Preoperative radiotherapy: a paradigm shift in the treatment of breast cancer. A review of literature. Crit Rev Oncol Hematol 2019, 141, 102-111
5. Ho AY et al: Critical Review: Optimizing radiation therapy to boost systemic immune responses in breast cancer: a critical Review for radiation oncologists. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020, 42(4) 227-241
6. JH Newman et al: Uncloaking breast tumor neoantigens with radiation. Trends in Immunol 2021, 42(4) 22
7. Bosma SCJ et al: Five-Year results of the preoperative accelerated partial breast irradiation (PAPBI) trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020 106(5), 958-967
8. Vaidya JS et al: New clinical and biological insights from the international
TARGIT-A random-ised trial of targeted intraoperative radiotherapy during
lumpectomy for breast cancer. Brit J Cancer 2021, 125, 380-389
9. Clinical Trials gov Identifier NCT01792726, a comparison of intra-operative radiotherapy boost with external beam radiotherapy boost in early breast cancer (TARGIT-B)
10. Vaidya JS et al: Effect of delayed intraoperative radiotherapy versus whole breast radiotherapy on local recurrence and survival. Long term results from the
TARGIT-A randomized clinical trial in early breast cancer. JAMA Oncol 2020, 6(7), e200249
11. GS Sarria et al: dosimetric comparison of upfront boosting with stereotactic radiosurgery versus intraoperative radiotherapy for glioblastoma.Front Oncol doi: 10.2389/fonc.2021.759873, 28.10.2021
12. D Scafa et al: Dosimetric comparison of intraoperative radiotherapy and radiosurgery for liver metastsases. Front Oncol. Doi: 103389/fonc. 767468, 02.12.2021
13. CP Cifarelli et al: Intraoperative radiotherapy in brain malignancies and outcomes in primary and metastatic brain tumors. Front. Oncol. Doi: 10.3389/fonc. 2022. 768168,11.11. 2021
14. Yan-Ling Wu et al: outcome of cenhtrally located hepatocellular carcinomas
treated by radical resection combined with intraoperative electron radiotherapy (IOERT). Front.Oncol. doi:10.3389 11.02. 2022
15. G Sarria et al: Long-term outcomes of an international ccoperative study of
intraoperative radio-therapy upfront boost with low energy x-rays in breast
cancer. Front. Onc. doi: 10.3389/fonc.2022. 850351, 11.02. 2022