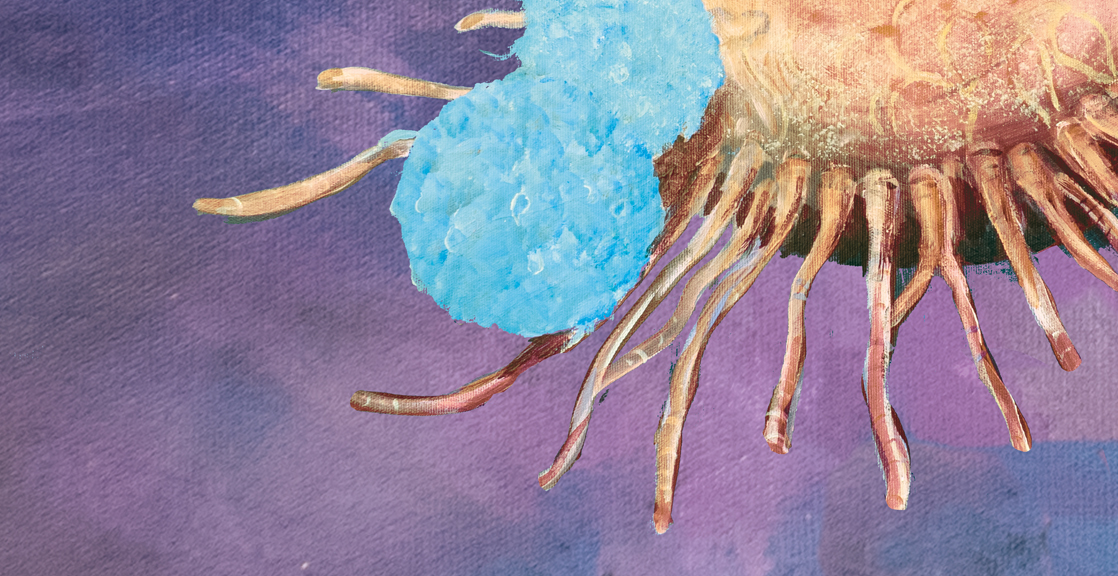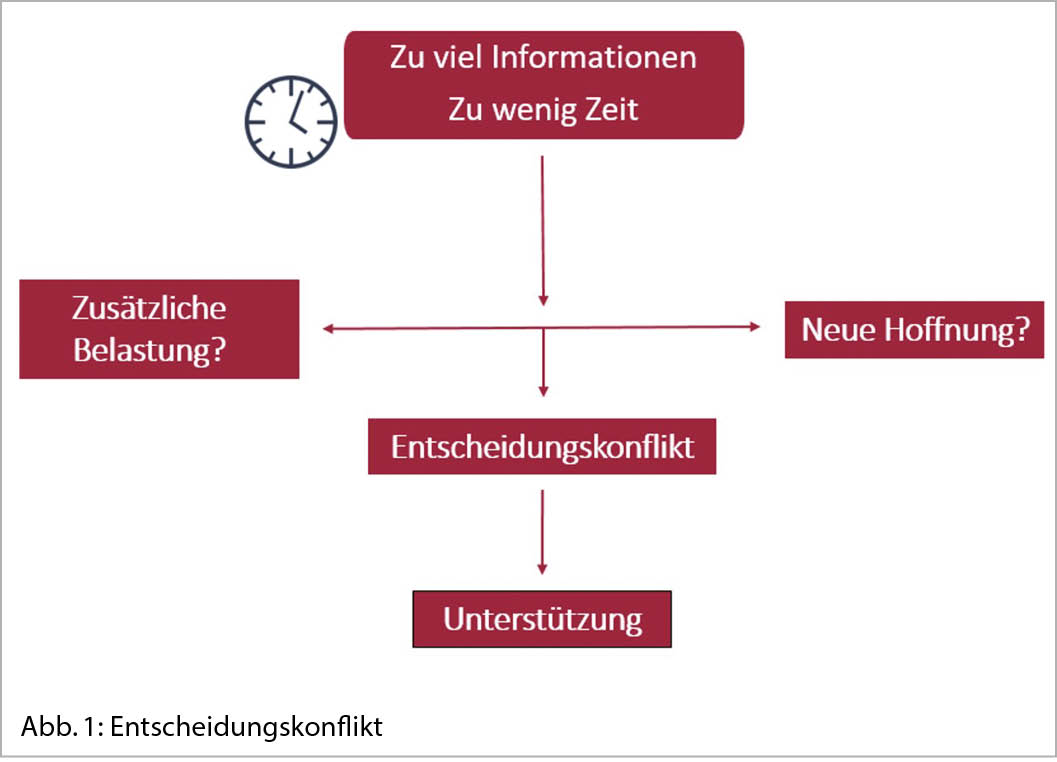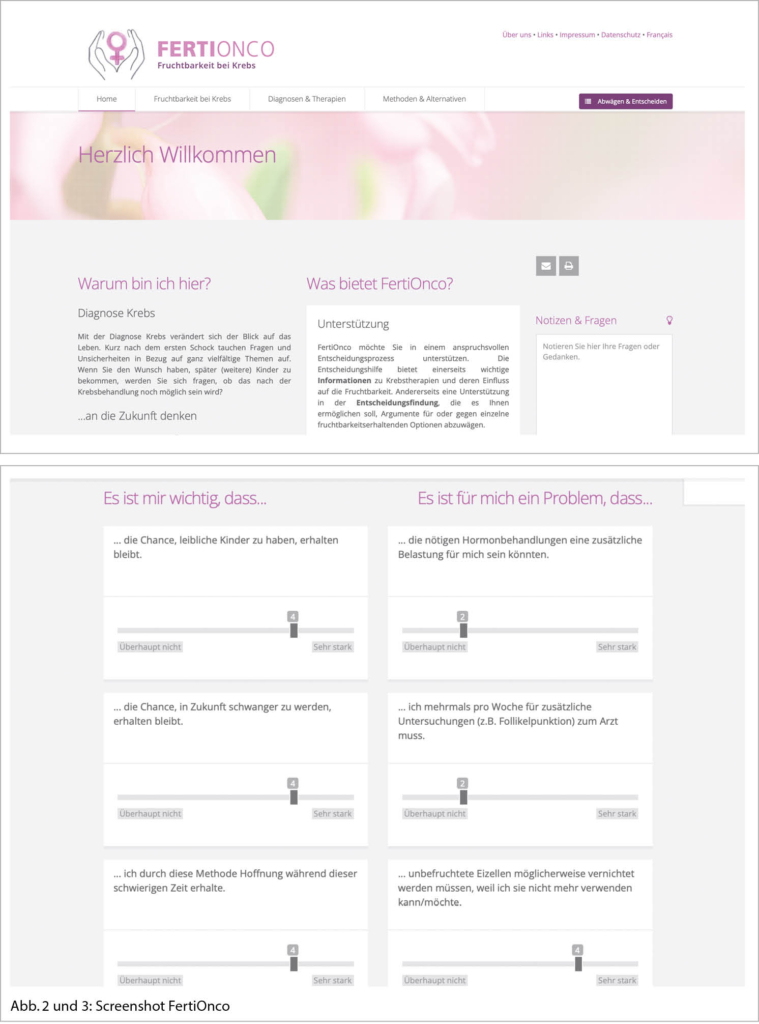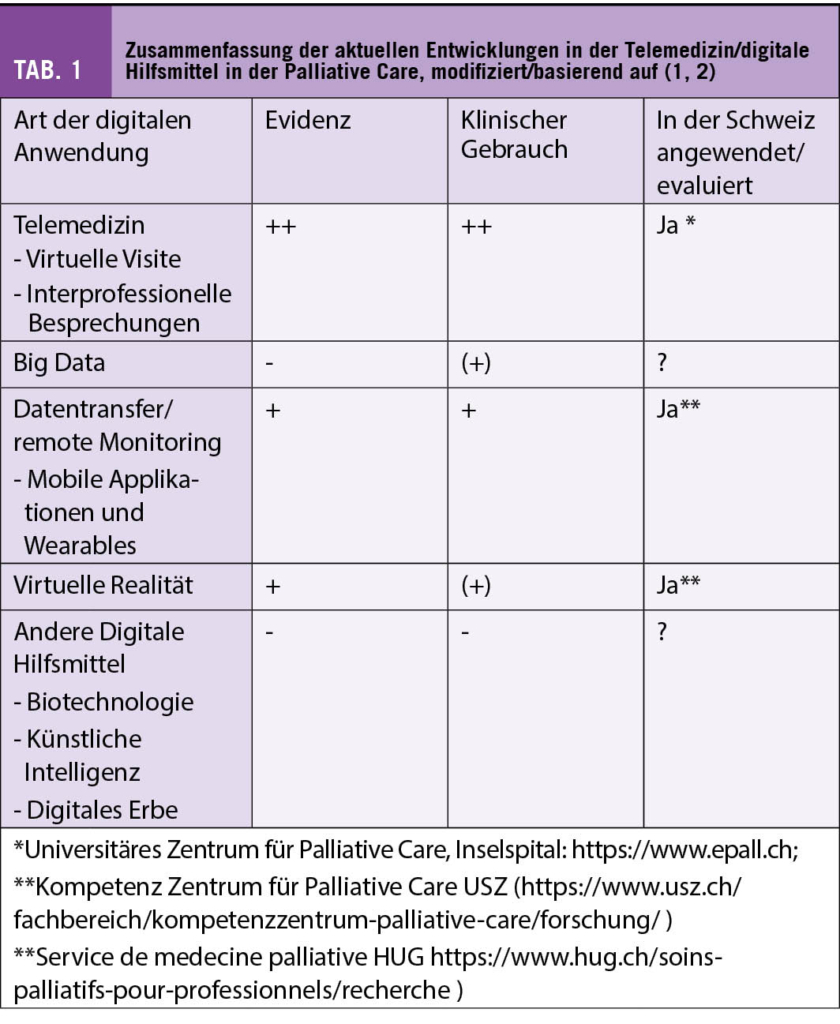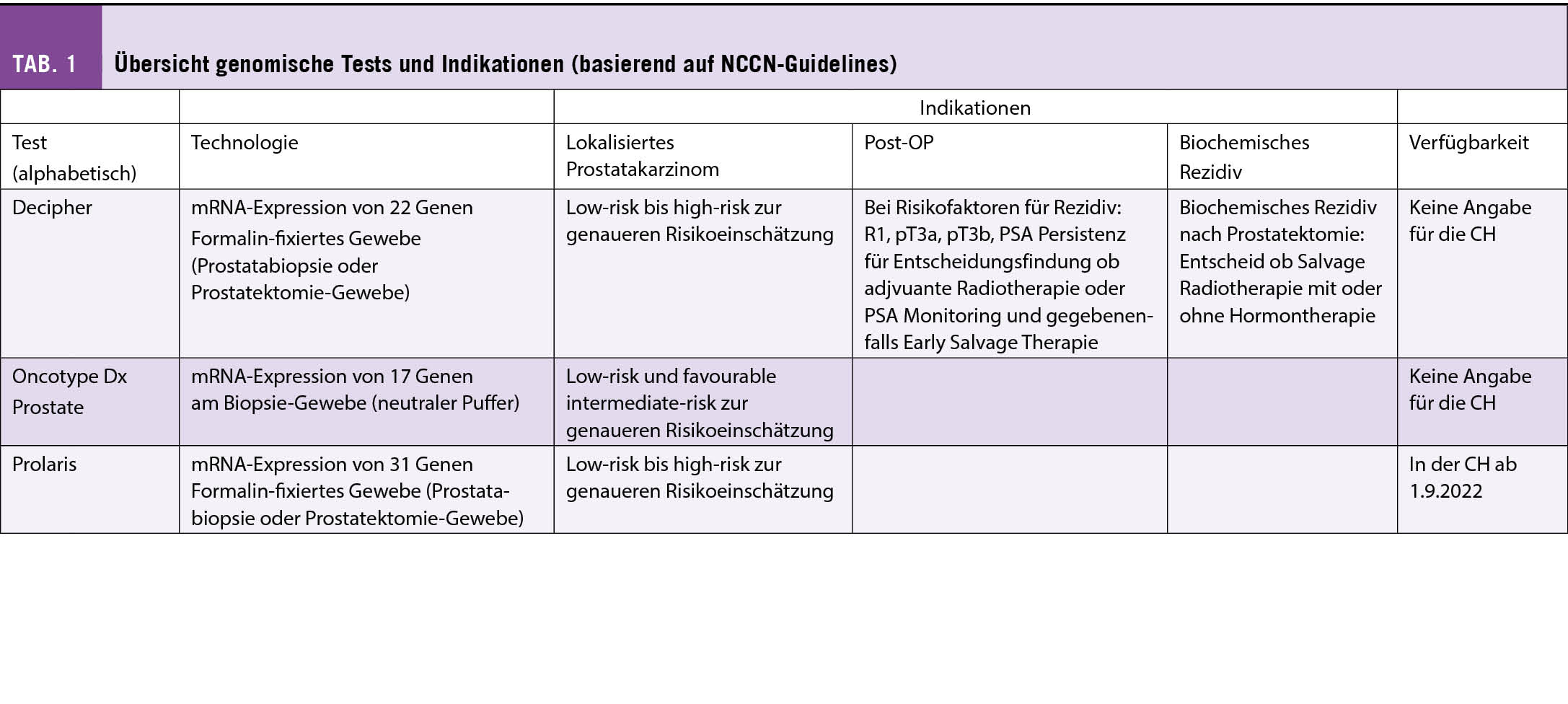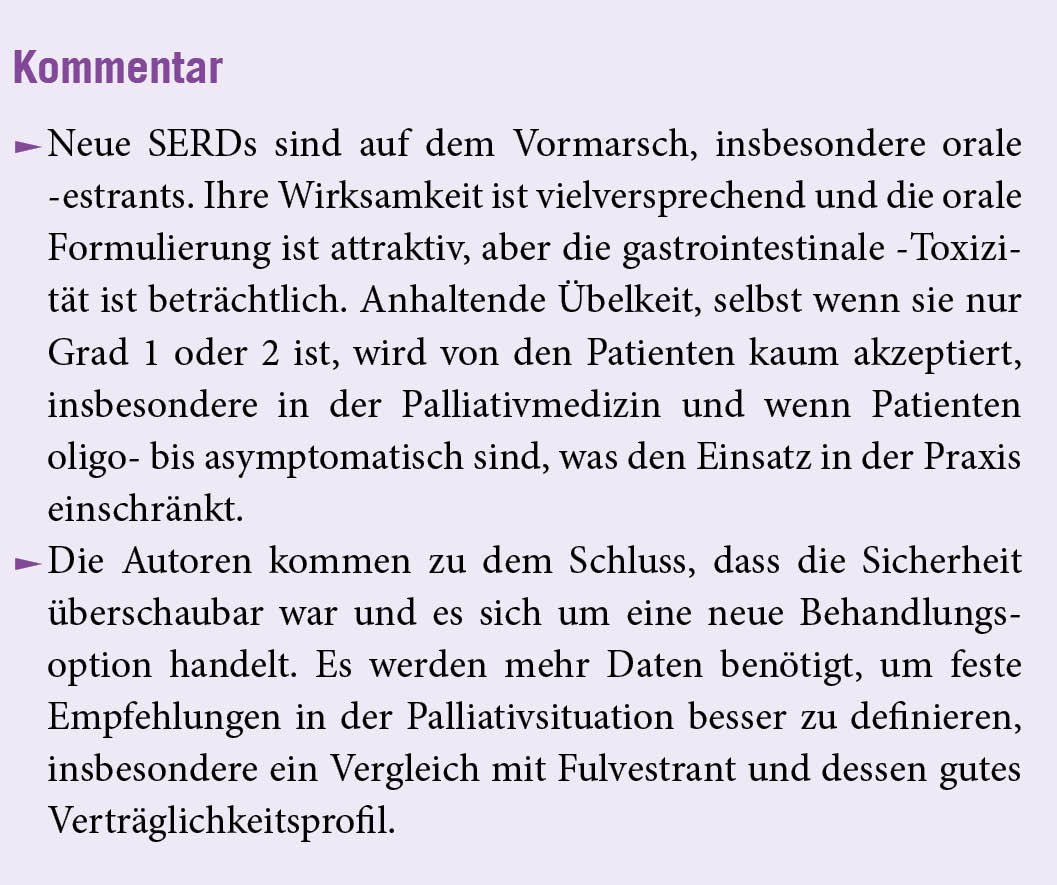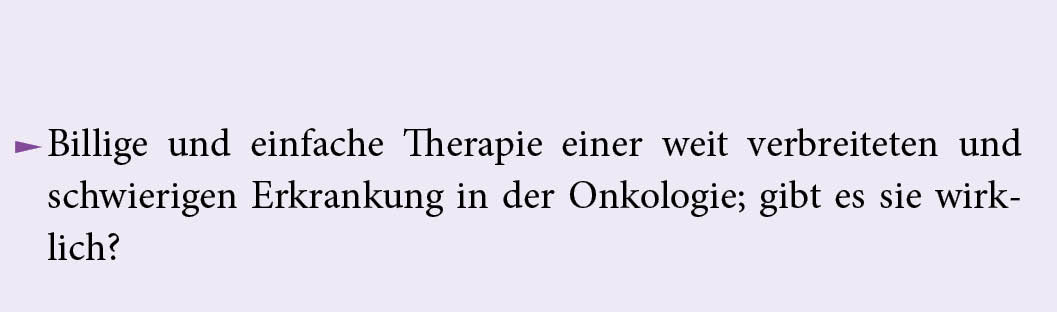European Center for Pharmaceutical Medicine (ECPM)
Das ECPM Institut gehört zur Medizinischen Fakultät der Universität Basel und wurde 1991 als erste postgraduale universitäre Ausbildung in ganzheitlicher Pharmazeutischen Medizin eröffnet. Das ECPM hat sich europaweit als führende universitäre post-graduale Bildungsstätte entwickelt.
Das Institut verfügt über eine Ausbildungsplattform auf hohem Niveau, die den Austausch mit hochkarätigen Experten aus Behörde, Industrie, und Universitäten auf neutralem Grund ermöglicht. Mit Partnerinstituten in Washington und Peking stellt das ECPM die Bedürfnisse der global organisierten Pharmaindustrie sicher. Für die Zulassung zum Studiengang ist ein Hochschulabschluss und eine berufliche Einbindung im Gesundheitswesen und der Arzneimittelentwicklung erforderlich.
Mit bisher 2127 Absolventen hat das ECPM mit Abstand weltweit die höchste Anzahl post-gradualer Studenten auf diesem Gebiet ausgebildet. Zusätzlich leistet es den Theorieteil zum Facharzttitel FMH in Pharmazeutischer Medizin. Daneben hat sich das ECPM zu einem führenden Forschungsinstitut für Gesundheitsökonomie entwickelt. Es verfasst zudem Gutachten für das BAG und die Industrie und beschäftigt sich mit Grundlagenforschung. Für seine Verdienste in der universitären Lehre und Forschung wurde das ECPM bereits 2012 und 2018 von der PharmaTrain Federation, dem internationalen Netzwerk für die Ausbildung auf diesem Gebiet, mit dem Prädikat «Center of Excellence» ausgezeichnet.
Plädoyer für eine starke biomedizinische Forschung und innovative pharmazeutische Medizin
Die Moderne Medizin stellt eine faszinierende Herausforderung dar. Sie befasst sich mit dem wissenschaftlichen Verständnis von Krankheiten , der Translation dieser Erkenntnisse in Evidenz-basierte Behandlungen bis zur Pflege des individuellen Patienten, so Dr. med. Dieter Scholer, Basel, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der medizinischen Forschung und der pharmazeutischen Medizin, der nach dem Medizinstudium in Basel und der Weiterbildung in Genf und einem Forschungsaufenthalt in San Francisco verschiedene Führungspositionen bei Ciba und Novartis innehatte und beim Aufbau des Start-up Unternehmens Speedel AG beteiligt war.
Dr. Scholer war lange Zeit Mitglied der Schweiz Akademie der medizinischen Wissenschaften und Mitglied des Universitätsrats der Universität Basel.
Die Voraussetzungen für eine qualitativ hochstehende Medizin sind einerseits wissenschaftlicher, medizinischer und technischer Fortschritt, der zu neuen Behandlungen und Präventionsstrategien führt und eine hohe Lebensqualität und Lebenserwartung ermöglicht. Andrerseits braucht es einen soziopolitischen Konsens für die Zuweisung von Mitteln für das Gesundheitswesen, womit ein kosteneffektives Gesundheitssystem ermöglicht wird. Die Determinanten der Qualität der Medizin sind die Ausbildung von Ärzten, Pflegepersonal und weiteren Dienstleistungserbringern im Gesundheitswesen, die Infrastruktur (Spitäler, Ambulatorien und Privatpraxen), das Gesundheitswesen selbst (öffentliche Mittel, Versicherungen, Beitrag der Patienten), und der Zufluss von biomedizinischer Innovation. Erfolgsfaktoren für Innnovation, Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg sind hochwertige Forschung und Entwicklung, offene transdisziplinäre Interaktionen, wettbewerbsfähige Human- und Finanzressourcen. Die Synergie zwischen experimenteller und klinischer Forschung öffnet den Weg zu besseren Behandlungen. Von ausserordentlicher Bedeutung ist das Zusammenspiel zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung, die zu neuen Zielen für die Entdeckung von Medikamenten und von Geräten führt.
Der menschliche Faktor und engagierte Führung
Ein multidisziplinärer Dialog und eine produktive Zusammenarbeit werden von Wissenschaftlern, Klinikern und Managern erleichtert, die in ihrer eigenen Biografie verschiedene Disziplinen durchlaufen haben, z.B. experimentelle Forschung, Grundlagenforschung, Arzneimittelentdeckung, klinische Forschung und klinische Medizin. Vorbilder in diesem Bereich waren für den Referenten Izzy Edelman (San Francisco), Alex F. Müller, Robert Veyrat, Michel Vallotton (Genève), Alfred Pletscher, Max M Burger, Werner Stauffacher, Peter Meier-Abt, und Fritz R. Bühler (Basel). Prof. Fritz R. Bühler spielte eine herausragende Rolle in Bezug auf das ECPM. Er hatte vor 30 Jahren die Vision, die intellektuellen und verwaltungstechnischen Fähigkeiten und die Ausdauer, um das ECPM als Schlüsselinstitution zu etablieren, die sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln in der Lehre konzentriert, aufzubauen.
Registrationen und ethische Gesichtspunkte
Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat die folgenden Überlegungen in Bezug auf den Kontext der klinischen Forschung und der Medikamentenentwicklung herausgegeben: Wissenschaftliche Integrität, keine Interessenkonflikte, Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Industrie: Eine korrekte Zusammenarbeit ist unerlässlich zur Sicherung des medizinischen Fortschritts und der wirtschaftlichen Prosperität der Schweiz. Die Unabhängigkeit des Wissenschaftlers und alle wissenschaftlichen und ethischen Anforderungen müssen strikt beachtet werden.
Life Sciences Cluster Basel
Nach dem Motto «von der Wissenschaft für die Wissenschaft» trägt die Handelskammer beider Basel den Life Sciences Cluster Basel zusammen mit führenden Unternehmen, Spitälern, Hochschulen und nationalen Branchenverbänden. Der Cluster umfasst die innovative Grundlagenforschung, die angewandte Forschung & Entwicklung, sowie ihre Umwandlung in Produkte, Dienstleistungen und Arzneimittel. Der Referent machte dafür ein Beispiel: die Entwicklung des innovativen Krebsmedikaments Glivec für die Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie, eine Entwicklung aus der Grundlagenforschung über spezifische Kinasen am Friedrich Miescher Institut und das Projekt der Entwicklung von Kinasen-Medikamenten bei Novartis.
Die zentralen Erfolgsfaktoren des Life Sciences Cluster Basel sind die stimulierende Ko-Existenz zwischen erstklassiger Grundlagenforschung an den Universitäten, den Fachhochschulen, leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, Start-ups, und Global Playern und Science Transfer Machines. Die Synergie zwischen privatem und öffentlichem Sektor und dem Nutzen von gut funktionierenden regionalen, nationalen, tri-nationalen und internationalen Netzwerken.
Das ECPM ist in die aufregende Welt der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung und Überlegungen zur pharmazeutischen Medizin eingebettet. Es verfügt über eine etablierte Plattform für Unterricht, Austausch relevanter Pharma- und Medizin-Information, sowie kritischen Reflexionen. Der Referent wünschte dem ECPM eine ebenso erfolgreiche Zukunft wie es die Vergangenheit war.
Pharmazeutische Innovation ausserhalb der Akademie
Ich hatte gute Lehrer (Prof Kurt Wüthrich, Nobelpreis 2002, Sir Gregory Winter, Nobelpreis 2018) und gute Studenten (Professor an der ETU Zürich, ERC Advanced Grant , CoFounder von Philogen, einige meiner Studenten haben erfolgreiche Firmen gegründet (z.B. Bicycle Therapeutics, Covagen…), stellte Prof. Dr. Dario Neri, Philogen, Siena, fest. Der Referent ist Mitbegründer des schweizerisch-italienischen Biotechnologieunternehmens Philogen, das 1966 mit der Mission gegründet wurde, die Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen zu innovieren. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, bioaktive Wirkstoffe mithilfe von Antikörperm oder kleinen organischen Liganden an den Ort der Erkrankung zu liefern, wodurch ihre therapeutische Aktivität erhöht und normales Gewebe geschont wird. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Siena und besitzt eine Tochtergesellschaft namens Philochem in Otelfingen bei Zürich. Prof. Neri präsentierte zwei Beispiele aus der Forschung von Philogen, eine Antikörper-Zytokin-Fusion im klinischen Stadium (Antikörper-basierte Verabreichung von Tumor-Nekrose-Faktor). Das Konjugat wurde an Patienten mit Glioblastom erfolgreich getestet. Das zweite Beispiel war OncoFAP, ein niedermolekularer Radiotracer mit ultrahoher Affinität zum Fibroblasten-Aktivierungsprotein (FAP). Er eignet sich für den nicht-invasiven Nachweis einer Vielzahl von metastasierenden soliden Tumoren.
Randomisierte klinische Studien: Erforschung von Synergien
Einen Einblick in die Denkart, die in Toronto herrschte und wie Synergien genutzt werden können, gab Prof. Dr. med. Peter Jüni, Toronto. Als Beispiel präsentierte er Daten zur RECOVERY Studie. RECOVERY hat uns Dexamethason und Tocilizumab während der Pandemie gebracht. RECOVERY ist eine internationale klinische Studie, die Behandlungen identifizieren soll, die bei Patienten, die wegen vermuteter oder bestätigter COVID-19 hospitalisiert wurden. Die Studie umfasste 47697 randomisierte Teilnehmer aus 198 Zentren. Untersucht wurde, ob die folgenden Medikamente den Tod bei Patienten mit COVID-19 verhindern: Lopinavir-Ritonavir, Dexamethason, Hydroxychloroquin, Azithromycin. Die Idee war eine 5:1 Randomisierung. Anstelle einer Studie, die A mit B vergleicht und einer Studie, die A mit C vergleicht etc., wurde ein gemeinsamer Placebovergleich gewählt. Synergie Nummer 1: e verwende eine gemeinsame Placebogruppe, was wir eine Plattform-Studie nennen. Die Teilnehmer der Studie hatten so nur eine 20%ige Chance in der Kontrollgruppe zu landen. 80% erhielten ein aktives Medikament. Das Design von RECOVERY wird künftig nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein, so der Referent. Primärer Endpunkt ist die Gesamtmortalität, sekundäre Endpunkte Hospitalisierungsdauer, Notwendigkeit für Beatmung, Notwendigkeit für Nierenersatztherapie. Die RECOVERY-Studie brachte den ersten Durchbruch gegen das Coronavirus durch die Entdeckung, dass Dexamethason die Todesfälle durch COVID-19 um bis zu einem Drittel reduzierte. Es demystifizierte aber auch Hydroxychloroquin und zeigte, dass Lopinavir, Ritonavir und die weiteren Medikamente keinen Nutzen brachten. Die Studie brauchte von der ersten Idee bis zur Randomisierung des ersten Patienten nur 13 Tage. Ein wesentliches Thema war Zentralisierung, d.h. ein koordiniertes Vorgehen, koordinierter, kollaborativer Ansatz, eine einzelne Regulierungsbehörde, eine einzige Ethikkommission deckt das ganze Land ab. Ein gemeinsamer Vertrag und Priorisierung der Ressourcen, klinische Studien konzipiert als Teil der klinischen Versorgung.
In Bezug auf die Grundsätze von Good Clinical Practice (GCP) sind die Aufgaben zur Durchführung einer Studie die gleichen, wie sie täglich in der Klinik vorkommen. Es braucht also keine zusätzliche Ausbildung in GCP. Der «Informed Consent» sollte eine zweiseitige einfache Information und ein einseitiges Formular umfassen. RECOVERY nutzte ein einfaches Randomisierungskonzept und einen einfachen Follow-up. In 36 Tagen wurden in RECOVERY 7300 Patienten randomisiert. Wir müssen einfach und pragmatisch werden, Synergien nutzen und alles Überflüssige weglassen.
Fazit
Vermeidung von Verwechslungen bei der Verwendung von Erkenntnissen aus der realen Welt durch randomisierte Patienten oder Gruppen
Grosse, einfache Plattformen und innovative Einwilligungsdesigns verwenden
Bayes’sche Ansätze zur Berücksichtigung vorhandener historischer Daten in Betracht ziehen
Berücksichtigung von Cross-Over- und Stepped-Wedges-Designs bei der Verwendung von Cluster-Designs.
Forschung mit Datenbanken – warum ist dies für die pharmazeutische Industrie wichtig?
Über die Verknüpfung von Daten aus randomisierten Studien mit Daten aus Real World Studien (RWD) berichtete Prof. Dr. med. Sebastian Schneeweiss, Harvard Medical School, Boston. Daten aus der realen Welt können nützlich für ein effizientes Design von randomisierten kontrollierten Studien sein: Wichtige RCT Bereicherungsstrategien können durch Real World Evidence (RWE) unterstützt werden. Praktische Bereicherung durch Reduktion des Grundrauschens, prognostische Bereicherung durch Erhöhung der Ereignisrate, prädiktive Bereicherung durch Optimierung des Nutzen/Risiko-Verhältnisses. Kombination von RCT Daten mit RWD mittel Tokenisierung. Verbesserung der Langzeitbeobachtung von RCTs, Untersuchung von Ausfällen, Übertragung der Ergebnisse von RCTs in die klinische Praxis. Verbesserung von RWE-Studien: Validierung der RWD. Messqualität Bewertung des Erfolgs der Confounding-Kontrolle, Anstreben von inkrementellen Indikationen mit RWE. RWE zur Validierung wiederverwendeter Medikamente. Der Referent erinnerte an Daten für Indomethacin bei COVID-9.
Von Real World Daten zu Real World Evidence
Prof Schneeweiss präsentierte den Duplicate Trial, einer Nachahmung von randomisierten klinischen Studien mit nicht randomisierten Real World Studien. Die Resultate zeigten, dass die Übereinstimmung zwischen RCT- und RWE-Ergebnissen variiert, je nachdem, welcher Übereinstimmungsmassstab verwendet wird. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Auswahl aktiver Vergleichstherapien mit ähnlichen Indikationen und Anwendungsmustern die Validität von RWE erhöht. Selbst im Zusammenhang mit aktiven Vergleichstherapien ist die Übereinstimmung zwischen RCT- und RWE-Ergebnissen nicht garantiert, was zum Teil daran liegt, dass die Studien nicht exakt nachgebildet werden. Um zu verstehen, wie oft und in welchen Zusammenhängen RWE-Ergebnisse mit RCTs übereinstimmen, sind weitere Studiennachbildungen erforderlich., merkten die Autoren der Studie an.
Wie können die Möglichkeiten, die «Real-World-Evidence» bieten kann, am besten genutzt werden?
Drei hochwertige Fälle mit hohem Wert für die translationale Wissenschaft:
1. externe Kontrollarme
2. Zulassungserweiterung, ergänzende Indikation, Kombinationstherapie
3. Anreicherung von Studien und Verknüpfung von Daten aus Studien und der realen Welt
Wesentliche Entwicklungen sind Verbesserung der Qualität von Sekundärdaten und stets die Prinzipien des Kausalschlusses im Design und in der Analyse befolgen (hier ist das Denken des Target Trial gefragt).
Die Rolle junger Firmen in der pharmazeutischen Innovation
Die derzeitigen pharmazeutischen Topfirmen und ihre Gründungsjahre sind GSK 1715, Sanofi 1718, Takeda 1781, Pfizer 1849, Novartis 1857, Bristol-Myers Squibb 1858, Bayer 1863, Eli Lilly 1876, Johnson & Johnson 1886, Abbvie 1888, Merck & Co 1891, Roche 1896, AstraZeneca 1913, CSL 1916, Novo Nordisk 1923, stellte Dr. Chandra P. Leo, HBM Partners AG Zug fest. Als junge Firmen bezeichnete er Amgen 1980, Gilead Sciences 1987, Regeneron 1988, Vertex 1989, Moderna 2010. Übernahmen von Firmen waren Genzyme von Sanofi 1981, Shire von Takeda 1988, Celgene von Bristol Myers-Squibb 1986, Actelion von Johnson & Johnson 1997, Genenetech von Roche 1978, Medimmune von AstraZeneca 1989, Immunex von Amgen 1981, Onyx von Amgen 1992, Pharmasset 1988 von Gilead Sciences, Kite von Gilead Sciences 2009 und Immunomedics von Gilead Sciences 1982.
Junge Firmen brauchen Finanzierung. Der Referent zeigte auf, dass von der Gründung bis zum ersten selbst vermarkteten Medikament durchschnittlich 10 Jahre vergehen. Risikokapital hat Hunderte von Biotech Firmen hervorgebracht. Aufstrebende Biopharma-Unternehmen sind in 72 % der Medikamenten-Pipeline involviert. Ihr Anteil nimmt stetig zu. Sie machen 42 % der bei der FDA eingereichten Produkte und 56% der weltweiten Markteinführungen von Medikamenten in den letzten 10 Jahren aus. Zwei Drittel der FDA Zulassungen stammen von kleinen Firmen. Pharmaunternehmen erhalten Zugang zu externen Innovationen durch Fusionen und Übernahmen.
Wodurch zeichnen sich Junge Unternehmen aus? Nähe zu akademischen Institutionen? Zugang zu Risikokapital? Geschwindigkeit und Agilität? Teamkultur? Risikotoleranz? Finanzielle Anreize? Fokus auf spezifische Ziele? Neue Modalitäten/Plattformen? Spezifische Indikationen? Als Beispiel für neue Ziele nannte der Referent die PARP Inhibitoren, welche 2005 als Mechanismus zur Behandlung von nBRCA-mutiertem Brustkrebs vorgeschlagen wurden. Dies führte dazu, dass eine Reihe von Bioctech Unternehmen sich auf die Entdeckung und Entwicklung von PARP Inhibitoren konzentrierten. Als Beispiel für den Fokus auf Modalitäten/Plattformen nannte der Referent Alnylam und die RNA Interferenz. Alnylam wurde 2002 gegründet und im Jahre 2018 wurde das erste auf RNA-Interferenz basierende Medikament von der FDA zugelassen. Seither wurden vier zusätzliche RNAi-Medikamente von der FDA zugelassen, die alle ursprünglich von Alnylam entwickelt worden sind.
Fazit
In den letzten 50 Jahren hat das Aufkommen von Risikokapital eine wachsende Zahl junger Unternehmen im Biopharma-Sektor angekurbelt. Heute sind diese jungen Unternehmen für die Mehrheit aller klinischen Arzneimittelentwicklungsprogramme und Zulassungen neuer Medikamente verantwortlich. Junge Unternehmen haben oft einen starken Fokus, z. B. auf neuartige Modalitäten oder Plattformen, was es ihnen ermöglicht, die etablierten Pharmaunternehmen zu überholen. Zell- und Gentherapien sind aktuelle Beispiele für neuartige Modalitäten, auf die etablierte Pharmaunternehmen später durch Lizenzvergabe und Fusionen zugreifen.
riesen@medinfo-verlag.ch