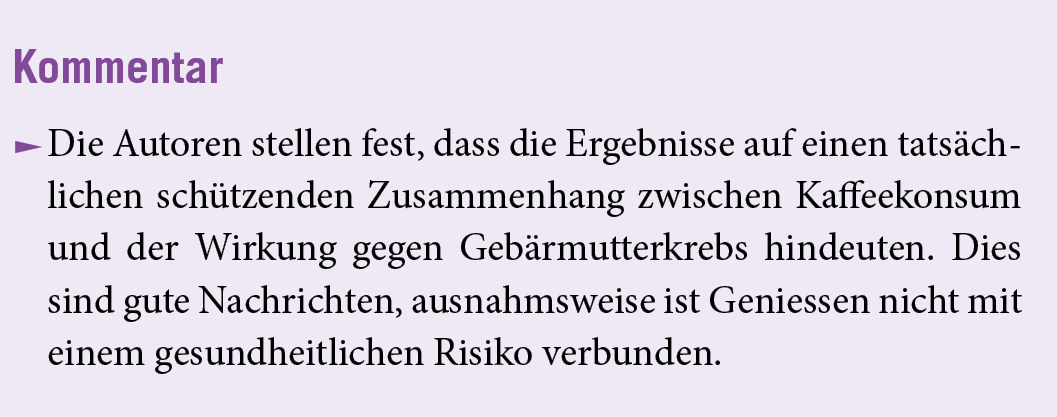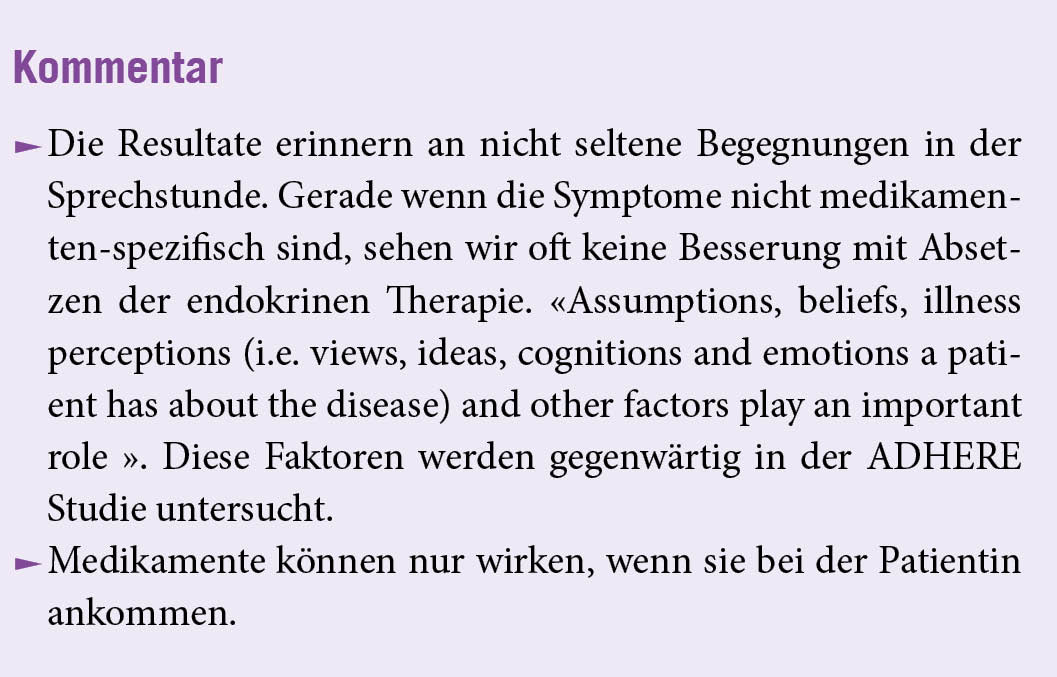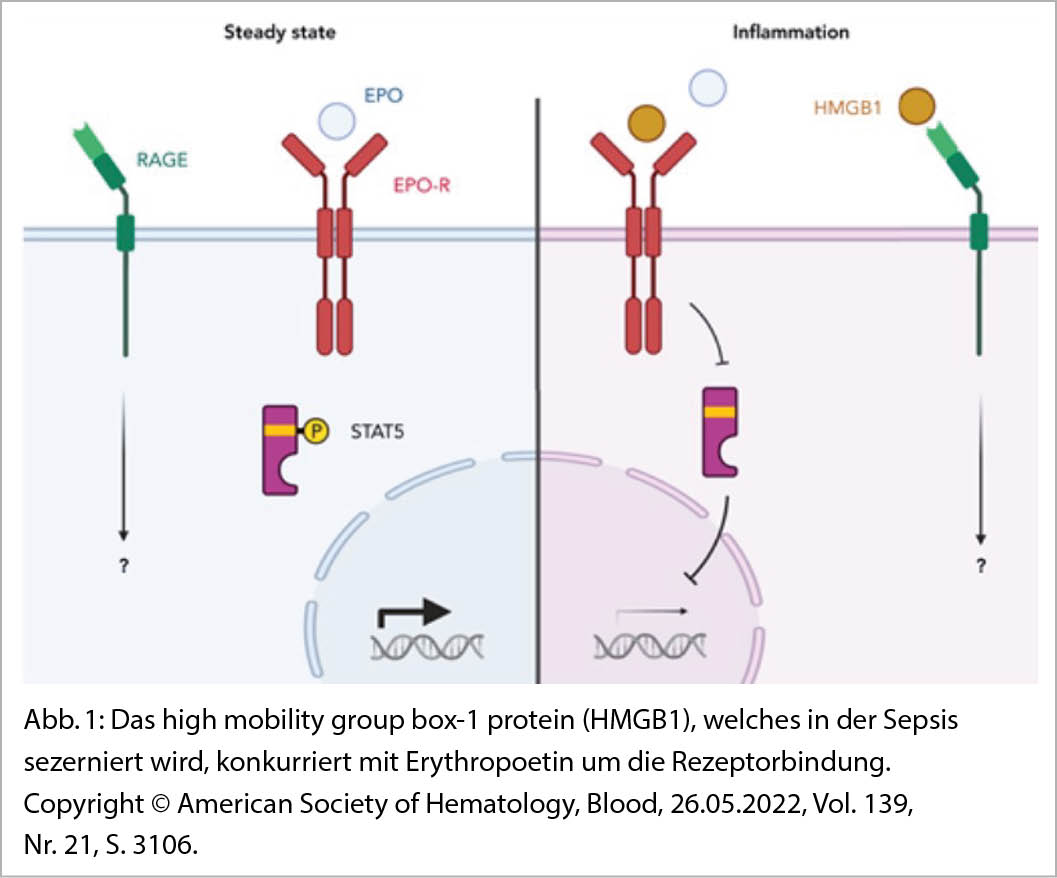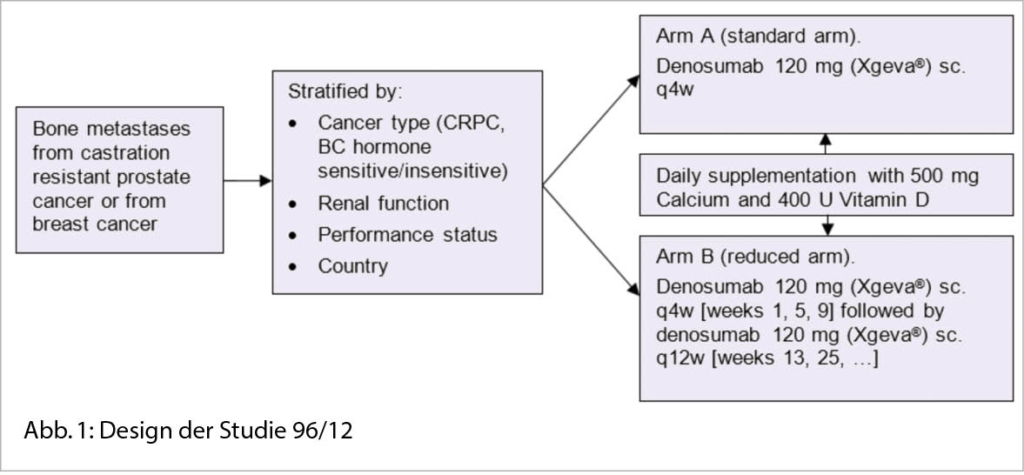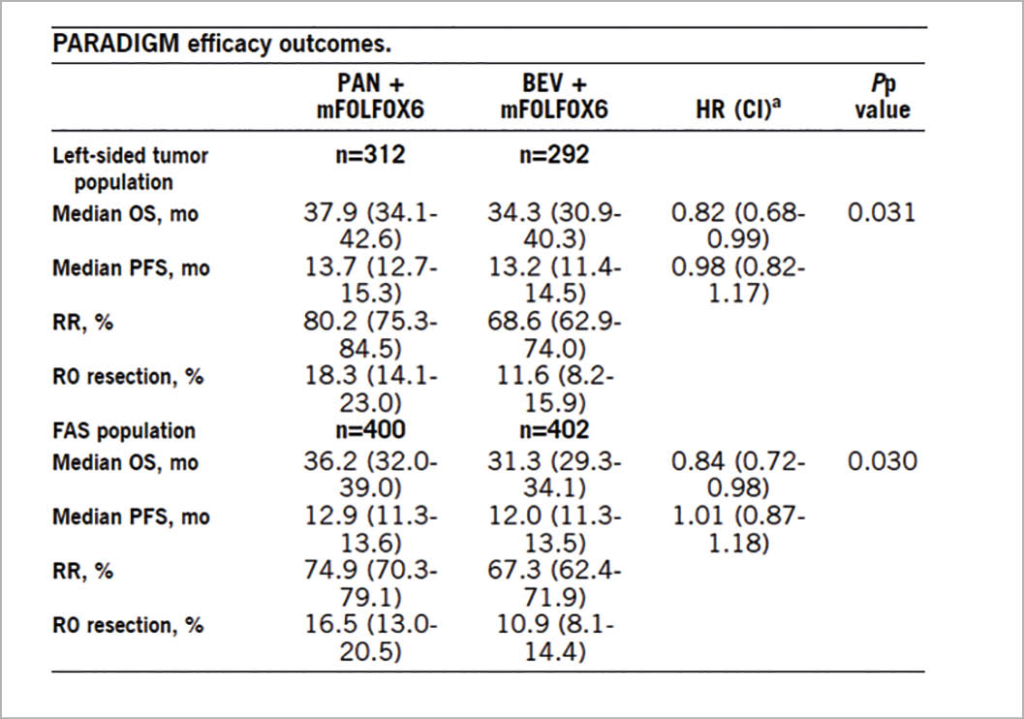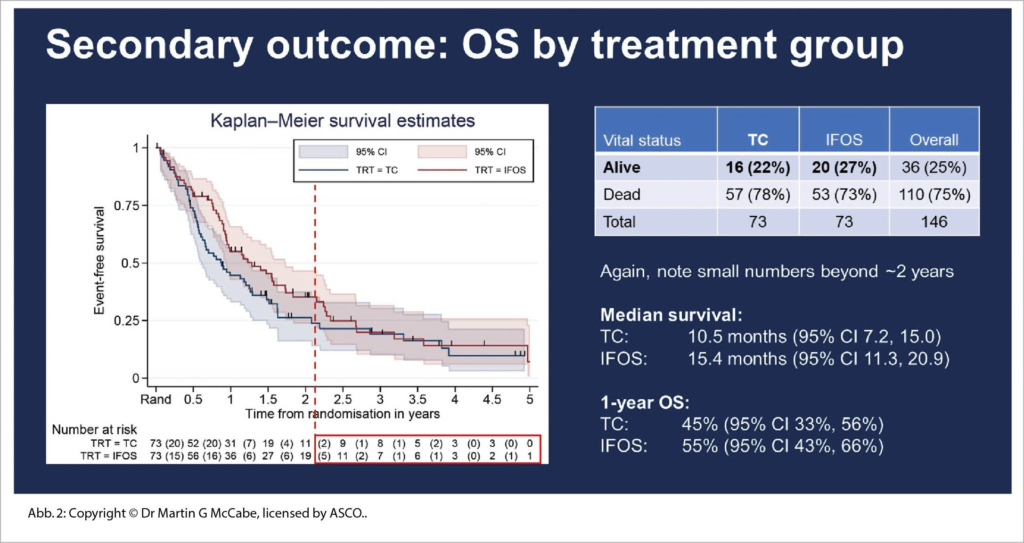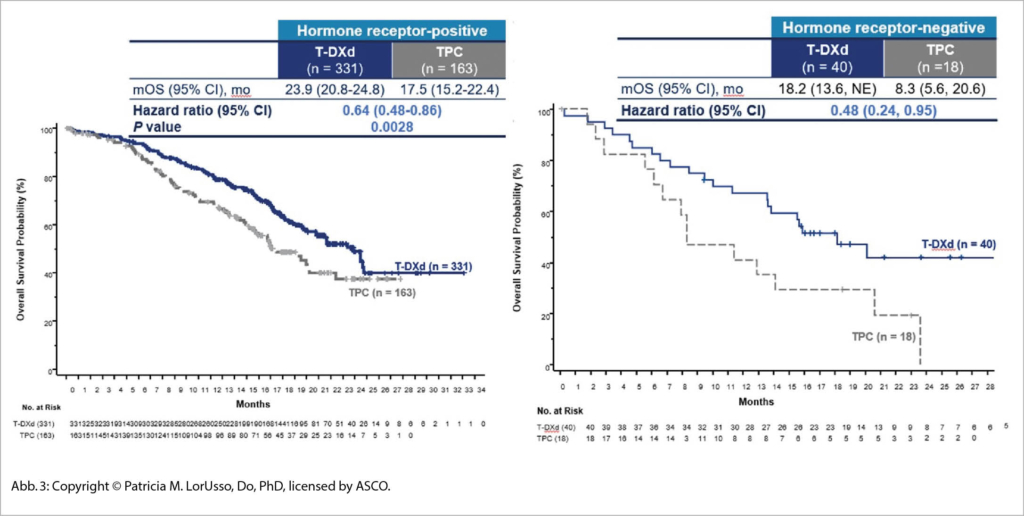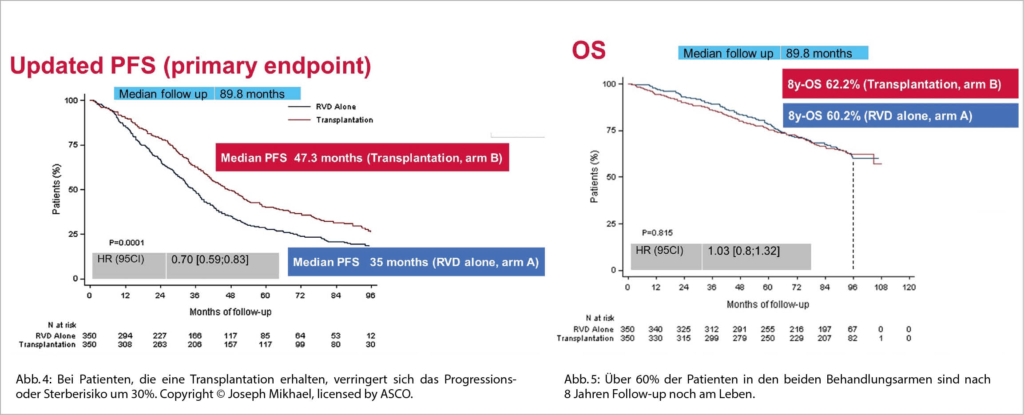Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Endometriumkrebs.
Eine Meta-Analyse.
Quelle: Gao Y et al. Association between coffee drinking and endometrial cancer risk: A meta-analysis. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2022; doi:10.1111/jog.15139J.
Das Endometriumkarzinom ist mit einer Inzidenz von 12,9 pro 100’000 Frauen und einer Sterblichkeitsrate von 2,4 pro 100’000 eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen weltweit. In Entwicklungsländern ist es mit einer Inzidenz von 5,9 pro 100’000 Frauen und einer Sterblichkeitsrate von 1,7 pro 100’000 ebenfalls die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung (1). Zu den Risikofaktoren für Endometriumkarzinom gehören eine langfristige Exposition gegenüber überschüssigem Östrogen, Fettleibigkeit, Nulliparität, Diabetes mellitus und Bluthochdruck (2) während zu den Schutzfaktoren körperliche Aktivität, Aspirineinnahme und bestimmte Ernährungsgewohnheiten gehören (3). Mehrere Beobachtungsstudien haben den Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und dem Risiko von Endometriumkrebs untersucht. Zwei frühere Metaanalysen zeigten eine inverse Assoziation mit Kaffeekonsum pro Tag im Vergleich zu keinem oder geringem Kaffeekonsum (4, 5). Diese Meta-Analysen untersuchten jedoch nicht die Auswirkungen verschiedener Kaffeesorten oder verschiedener Personen auf Endometriumkrebs.
Eine kürzlich publizierte systematische Meta-Analyse aus allen verfügbaren Daten kombiniert aus Fall-Kontroll- und Kohortenstudien verglich die Auswirkungen verschiedener Kaffeesorten auf Endometriumkrebs, wobei es keine Einschränkungen hinsichtlich der Studienpopulation gab (6).
Dazu wurden die Datenbanken MEDLINE und EMBASE bis Juli 2018 durchsucht. Die gepoolten relativen Risiken (RRs) mit 95% Konfidenzintervallen (CIs) wurden mithilfe eines Modells mit zufälligen Effekten berechnet.
Ergebnisse
Insgesamt wurden 24 Studien (12 Fall-Kontroll- und 12 Kohortenstudien) zum Kaffeekonsum mit 9833 Fällen von EC und 699’234 Probanden in die Meta-Analyse einbezogen. Der gepoolte RR-Wert für Endometriumkrebs für die höchste gegenüber der niedrigsten Kategorie des Kaffeekonsums betrug 0,71 (95% CI: 0,65-0,77; I2 = 14%, p für Heterogenität = 0,26). Nach Studiendesign lagen die gepoolten RRs bei 0,68 (95% CI: 0,56-0,83) für Fall-Kontroll-Studien und 0,70 (95% CI: 0,63-0,77) für Kohortenstudien. Für die verschiedenen Regionen lagen die gepoolten RRs bei 0,74 (95 % KI: 0,62-0,88) in Europa, 0,71 (95 % KI: 0,64-0,79) in den Vereinigten Staaten/Kanada und 0,40 (95 % KI: 0,28-0,57) in Japan. Eine zusätzliche Untergruppenanalyse zeigte einen stärkeren inversen Zusammenhang bei Kaffeetrinkern (RR 0,66, 95% CI: 0,52-0,83), Personen mit einem höheren Body-Mass-Index (BMI) (RR 0. 65, 95% KI: 0,54-0,79), Nie-Raucher (RR 0,68, 95 % KI: 0,56-0,84), ehemalige Raucher (RR 0,56, 95 % KI: 0,45-0,70) und Personen, die nie eine Hormonersatztherapie (HRT) verwendeten (RR 0,88, 95 % KI: 0,79-0,98). Der Konsum von gefiltertem oder gekochtem Kaffee zeigte keinen signifikanten Zusammenhang.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse zeigen, dass ein hoher Kaffeekonsum das Risiko von Endometriumkrebs senken könnte. Die Ergebnisse könnten auf einen tatsächlichen Schutzzusammenhang zwischen Kaffeekonsum und der Wirkung gegen Endometriumkrebs hindeuten. Insgesamt zeigte koffeinhaltiger Kaffee einen besseren Schutz als koffeinfreier Kaffee. Unterschiedliche Zubereitungsmethoden von Kaffee zeigten keine signifikanten Auswirkungen. Ausserdem wurde bei Kaffeetrinkerinnen mit einem hohen BMI, die jemals geraucht haben und nie eine Hormonersatztherapie angewendet haben, ein signifikanterer umgekehrter Zusammenhang festgestellt als bei Personen mit einem niedrigen BMI, die nie geraucht haben und nie eine Hormonersatztherapie angewendet haben. In der aktuellen Meta-Analyse wurde keine signifikante Heterogenität der Studien festgestellt.
Literatur:
1. Jemal A, et al.. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2011; 61(2): 69– 90.
2. Renehan AG, et al. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet 2008 ; 371 :569-78
3. Neill AS et al. Aspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, paracetamol and risk of endometrial cancer: a case-control study, systematic review and meta-analysis. Int J Cancer. 2013; 132(5): 1146– 55.
4. Bravi F, et al. Coffee drinking and endometrial cancer risk: a metaanalysis of observational studies. Am J Obstet Gynecol. 2009; 200(2): 130– 5.
5. Je Y, Giovannucci E. Coffee consumption and risk of endometrial cancer: findings from a large up-to-date meta-analysis. Int J Cancer. 2012; 131(7): 1700– 10.
6. Gao Y et al. Association between coffee drinking and endometrial cancer risk: A meta-analysis. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2022; doi:10.1111/jog.15139J.
Absetzen der adjuvanten endokrinen Therapie und Auswirkungen auf Lebensqualität und Funktionszustand bei älteren Patientinnen mit Brustkrebs
Quelle: A.A. Lemij et al. Discontinuation of adjuvant endocrine therapy and impact on quality of life and functional status in older patients with breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment 2022;193: 567–577
Brustkrebs ist die am häufigsten diagnostizierte Malignität bei Frauen, wobei mehr als 30% aller Patientinnen zum Zeitpunkt der Diagnose über 70 Jahre alt sind (1). Die adjuvante endokrine Therapie ist aufgrund ihrer positiven Wirkung auf die Rezidivraten und das Brustkrebs-spezifische Überleben ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung bei Patientinnen mit Hochrisikohormonrezeptor-positivem Brustkrebs (2, 3). Während die Zahl der Patientinnen über 75 Jahre, die eine endokrine Therapie erhalten, zwischen den Jahren 2000 und 2017 gestiegen ist, hat sich ihre relative Überlebensrate nicht verbessert (4). Dieser Mangel an Überlebensgewinn könnte auf eine begrenzte Wirkung der adjuvanten endokrinen Therapie auf Brustkrebs im Frühstadium mit niedrigem Risiko bei älteren Patientinnen zurückzuführen sein (4, 5). Ein weiterer Grund könnte der höhere Einfluss konkurrierender Todesursachen bei älteren Patientinnen sein (5).
Das Ziel einer kürzlich publizierten Studie (6) war es, geriatrische Prädiktoren für das Absetzen der adjuvanten endokrinen Therapie innerhalb der ersten 2 Jahre nach Beginn der Behandlung zu untersuchen und den Zusammenhang zwischen vorzeitigem Absetzen und funktionellem Status und Lebensqualität zu untersuchen.
Die Autoren schlossen insgesamt 258 Patientinnen im Alter von 70 Jahren und älter mit Brustkrebs im Stadium I–III, die eine adjuvante endokrine Therapie erhielten, in die Studie ein. Der primäre Endpunkt war das Absetzen der endokrinen Therapie innerhalb von 2 Jahren. Risikofaktoren für ein Absetzen wurden mit univariaten logistischen Regressionsmodellen bewertet. Lineare gemischte Modelle wurden verwendet, um den Lebensqualitäts- und Funktionsstatus im Laufe der Zeit zu bewerten.
Ergebnisse
36% der in die Studie eingeschlossenen Patientinnen brachen die Therapie innerhalb von 2 Jahren nach Beginn der Behandlung ab. Es wurden keine geriatrischen prädiktiven Faktoren für das Absetzen der Behandlung gefunden. Das Tumorstadium war umgekehrt mit einem frühen Absetzen verbunden. Patientinnen, die die Therapie abbrachen, hatten eine schlechtere Brustkrebs-spezifische Lebensqualität (b = − 4,37; 95% CI − 7,96 bis − 0,78; p = 0,017) über die ersten 2 Jahre, insbesondere auf der Subskala der Zukunftsperspektive (b = − 11,10; 95% CI − 18,80 bis − 3,40; p = 0,005). Diese erholte sich nach dem Absetzen nicht. Das Absetzen der Behandlung ging nicht mit einer funktionellen Verbesserung einher.
Schlussfolgerung
Ein grosser Teil der älteren Patientinnen bricht die adjuvante endokrine Behandlung innerhalb von 2 Jahren nach Beginn der Behandlung ab, aber geriatrische Merkmale sind nicht prädiktiv für ein frühes Absetzen der Behandlung. Das Absetzen der adjuvanten endokrinen Therapie wirkte sich nicht positiv auf die Lebensqualität und den funktionellen Status aus, Dies weist darauf hin, dass die beobachtete, schlechtere Lebensqualität in dieser Gruppe wahrscheinlich nicht durch Nebenwirkungen der endokrinen Therapie verursacht wird.
Literatur:
1. DeSantis CE, Ma J, Gaudet MM, Newman LA, Miller KD, Goding Sauer A et al (2019) Brustkrebsstatistik, 2019. CA 69(6):438–451
2. Biganzoli L, Battisti NML, Wildiers H, McCartney A, Colloca G, Kunkler IH et al (2021) Aktualisierte Empfehlungen zur Behandlung älterer Patientinnen mit Brustkrebs: ein gemeinsames Papier der European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) und der International Society of Geriatric Oncology (SIOG). Lancet Oncol https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(20)30741-5
3. Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group (2015) Aromatase-Inhibitoren versus Tamoxifen bei Brustkrebs im Frühstadium: Meta-Analyse der randomisierten Studien auf Patientenebene. Lanzette 386(10001):1341–1352
4. de Glas N, Bastiaannet E, de Boer A, Siesling S, Liefers GJ, Portielje J (2019) Verbessertes Überleben älterer Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs aufgrund einer Zunahme systemischer Behandlungen: eine bevölkerungsbasierte Studie. Brustkrebs Res Behandlung 178 (1): 141-149
5. Christiansen P, Bjerre K, Ejlertsen B, Jensen M-B, Rasmussen BB, Lænkholm A-V et al (2011) Mortality rates among early-stage hormone receptor-positive breast cancer patients: a population-based cohort study in Denmark. JNCI 103(18):1363–1372
6. Lemij AA et al. Absetzen der adjuvanten endokrinen Therapie und Auswirkungen auf Lebensqualität und Funktionszustand bei älteren Patientinnen mit Brustkrebs. Breast Cancer Research and Treatment 2022; 193:567–577.
Brustzentrum, Kantonsspital St. Gallen
Rorschacher Strasse 95
9007 St.Gallen