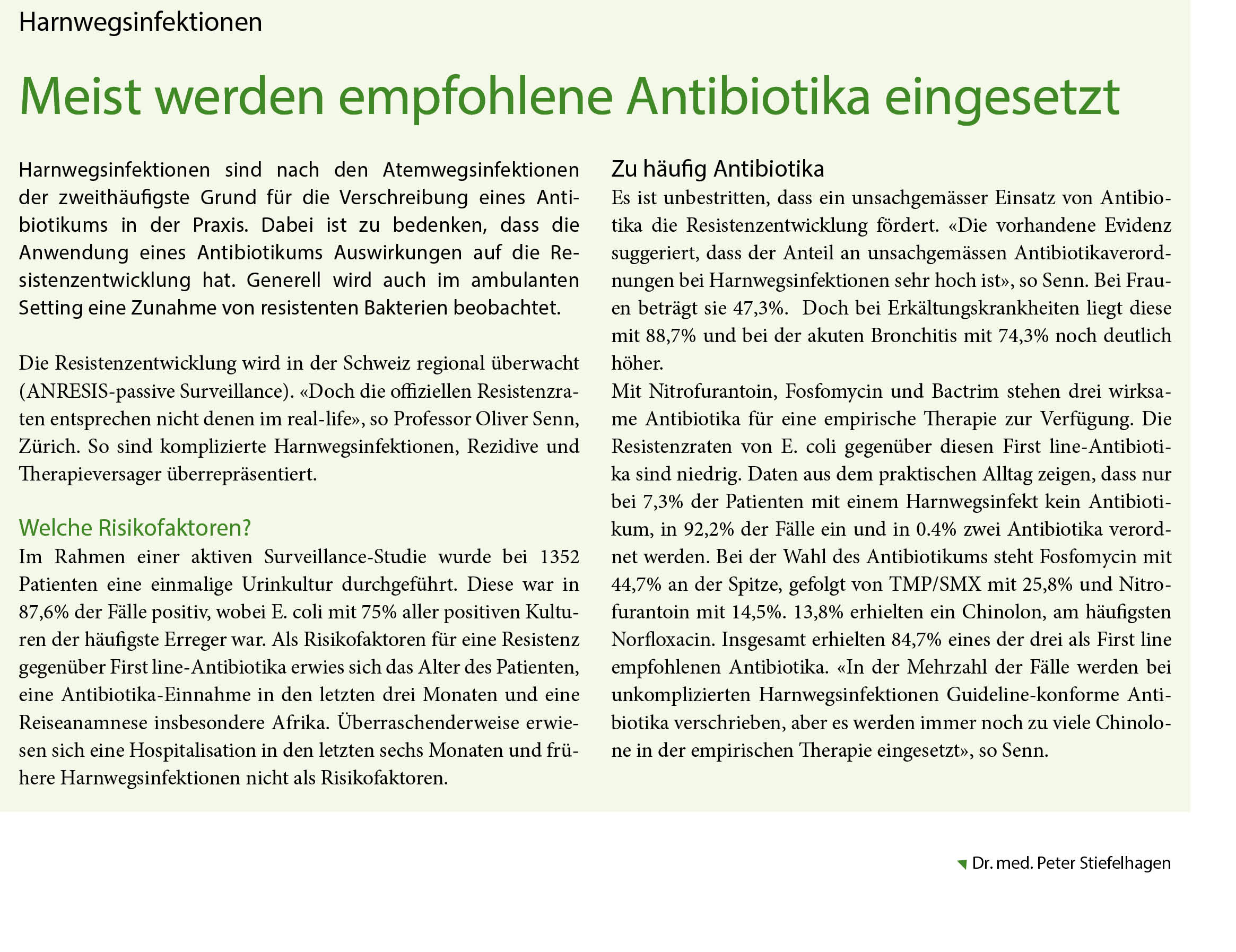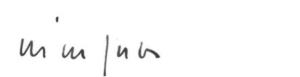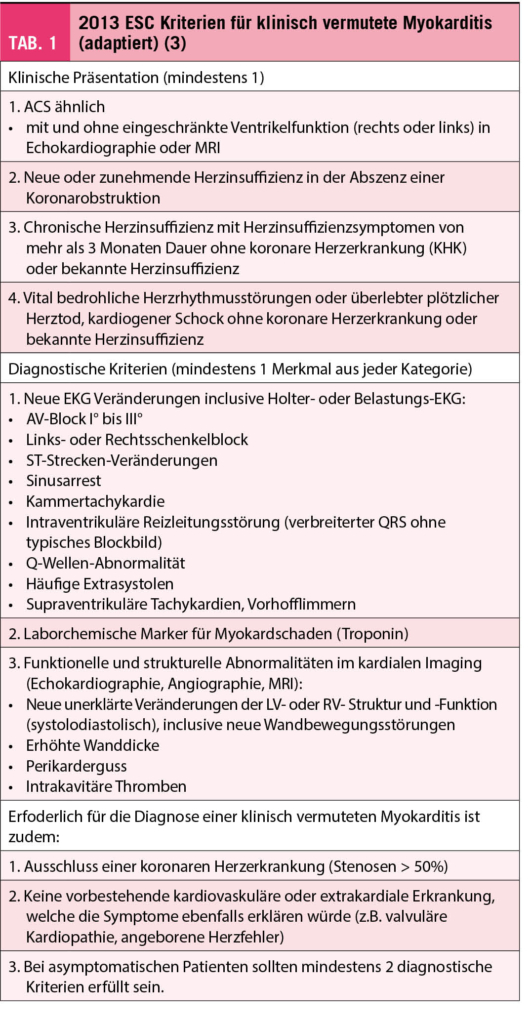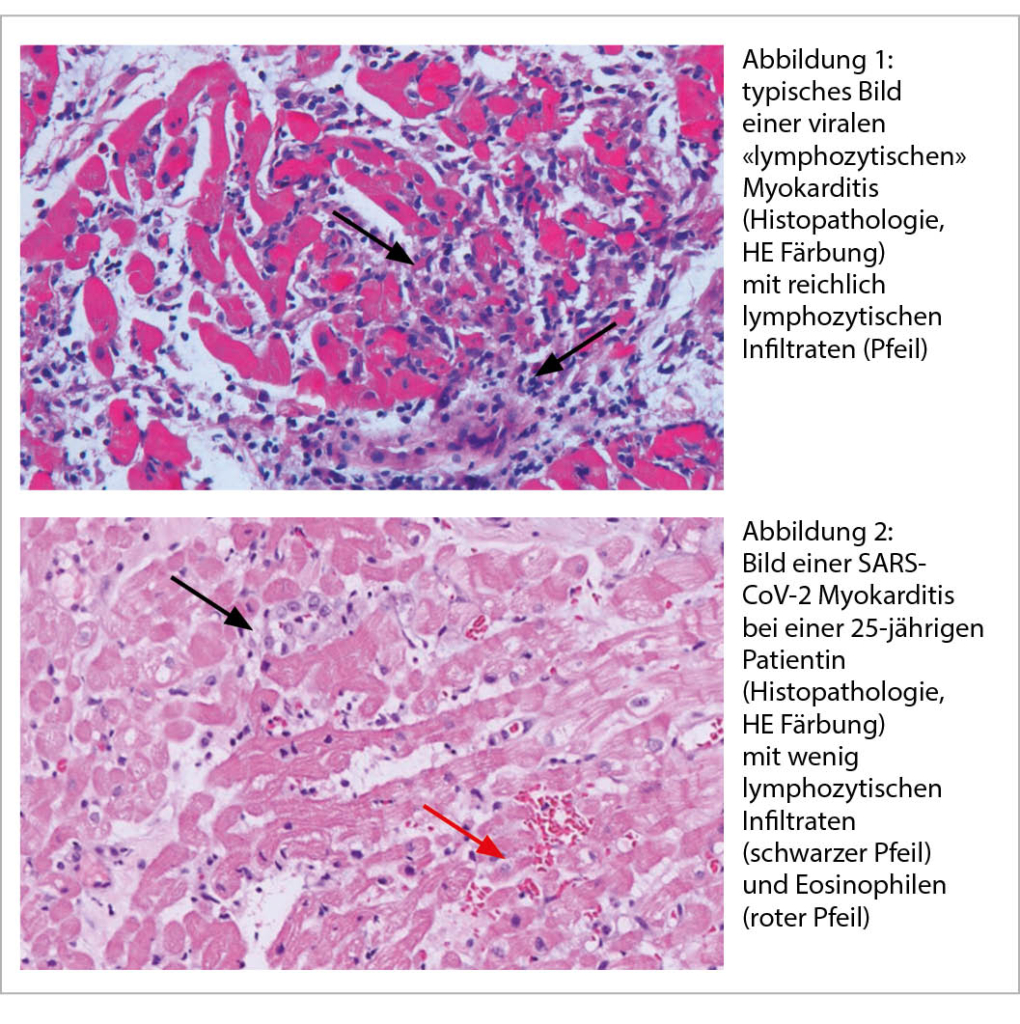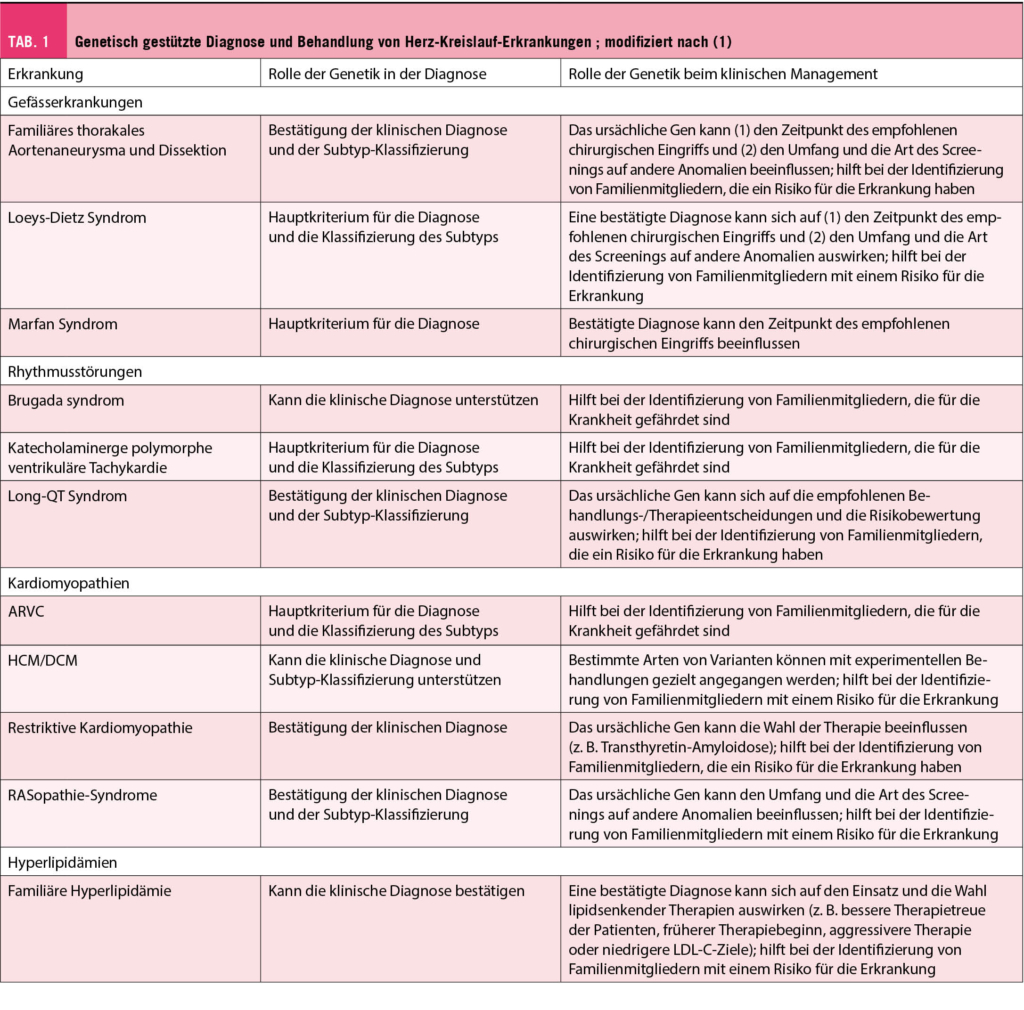Eine Reihe von systemischen Erkrankungen und verschiedene Hauterkrankungen gehen mit Juckreiz einher. Die Gabe eines Antihistaminikums ist nur sinnvoll, wenn Mastzellen sprich Histamin für den Juckreiz verantwortlich sind. Dies ist bei der atopischen Dermatitis nicht der Fall.
Das Spektrum der Erkrankungen, die mit einem Juckreiz einhergehen, ist breit. Grundsätzlich unterscheidet man dermatologische und systemische Ursachen. Zu letzteren gehören der Diabetes mellitus, die chronische Niereninsuffizienz, hämatologische Neoplasien wie die Polycythaemia vera, Paraneoplasien, cholestatische Lebererkrankungen und Neuropathien. Von dermatologischer Seite gilt es zu unterscheiden, ob sich der Pruritus auf primär unveränderter oder primär veränderter Haut also bei einer Dermatose entwickelt. «Doch sekundäre Kratzläsionen können vorherrschen, so dass eine genaue Zuordnung zu einer der beiden Gruppen nicht möglich ist», so Professor Thomas M. Kündig, Zürich. Auch gebe es Patienten, bei denen mehr als eine Ursache (multifaktorieller Pruritus) vorliege oder keine Ursache zu finden sei (Pruritus sine materia).
Die häufigsten dermatologischen Erkrankungen, die mit Juckreiz einhergehen, sind die atopische Dermatitis, die Psoriasis, die chronische Urtikaria und das Exsikkationsekzem. «Gerade Patienten mit einer Psoriasis leiden nicht selten über einen sehr quälenden Juckreiz, der ihre Lebensqualität stärker beeinträchtigt als die Psoriasis-Arthritis», so Kündig.
Atopische Dermatitis: Dupilumab ist ein innovativer Therapieansatz
Die atopische Dermatitis ist die häufigste chronisch-entzündliche Hauterkrankung. Bei ca. 30% der Patienten besteht eine moderate oder schwere Form. Der stärkste Risikofaktor ist eine positive Familienanamnese, d.h. die Heritabiliät ist mit 80% aussergewöhnlich hoch. Die entscheidenden pathophysiologischen Faktoren sind eine epidermale Barrierestörung und eine Immundysregulation. So findet sich eine verminderte Expression epidermaler Barriereproteine, die als Zell-Zell-Verbindungsproteine fungieren. Die verminderte Expression solcher Strukturproteine kann durch Filaggrin-Mutationen verursacht sein. Solche Filaggrin-Mutationen verursachen eine Ichthyosis vulgaris, die wiederum das Risiko für eine atopische Dermatitis erhöht. Aber auch eine veränderte Komposition der epidermalen Ceramide spielt eine Rolle. Folge der epidermalen Barrierestörung ist eine Veränderung des Hautmikrobioms, wobei vor allem die Komposition der Staphylokokken verändert ist. Staphylokokken sind zwar nicht die Ursache der atopischen Dermatitis, aber wesentliche Trigger.
Bei der kutanen Immundysregulation kommt den T-Zellen eine zentrale Bedeutung zu. So finden sich Zeichen einer Typ-2-Entzündung schon in der nicht-läsionalen Haut und diese Entzündung nimmt in den Läsionen deutlich zu. Bei Patienten mit einer atopischen Dermatitis sind aber auch die Spiegel der proinflammatorischer Marker im Serum erhöht als Hinweis auf eine systemische Entzündung.
Mit dem voll humanen monoklonalen Antikörper Dupilumab (Dupixent®) steht ein neuer, erstmals zielgerichteter Therapieansatz zur Verfügung. Er richtet sich gegen die alpha-Kette des Interleukin-4 und -13 und blockiert somit die Wirkung dieser beiden Zytokine am Rezeptor. Die Substanz wird alle 2 Wochen in einer Dosierung von 300 mg appliziert. Die EDF-Guidelines 2018 empfehlen Dupilumab bei Patienten mit einem moderaten oder schweren atopischen Ekzem, bei denen eine topische Behandlung nicht ausreichend und eine andere Systemtherapie nicht angezeigt ist. Ein Drittel wird unter einer Monotherapie beschwerdefrei, bei den übrigen sollte die topische Therapie mit einem Steroid oder einem Calcineurin-Inhibitor fortgeführt werden Der maximale Effekt auf die Effloreszenzen wird bereits nach einem Monat erreicht, beim Juckreiz dauere es etwas länger. «Die Gabe eines Antihistaminikum ist bei der atopischen Dermatitis nicht wirksam, da bei der Pathogenese das Histamin keine Bedeutung hat», so Kündig.
Chronische Urticaria: Immer Antihistaminikum der 2. Generation
Unter einer Urtikaria versteht man ein induziertes oder spontanes Auftreten von Quaddeln und /oder Angioödemen. Während Quaddeln durch eine zentrale Schwellung der oberen und mittleren Dermis und einem Erythem charakterisiert sind, Juckreiz bzw. Brennen hervorrufen und innerhalb von 24 Stunden verschwinden, ist das Angioödem, bei dem die Dermis und die Subkutis anschwellen, schmerzhaft und kann bis 72 Stunden anhalten. Eine Urtikaria kann, muss aber nicht Ausdruck einer Allergie sein, wobei Medikamente und Nahrungsmittel am häufigsten sind. Seltener ist die durch physikalische Reize (Reiben, Kälte, Druck, Wärme, Licht, Vibration) induzierbare Urtikaria und die aquagene bzw. die Kontakt-Urtikaria.
Gibt es keinen Auslöser, so spricht man von einer spontanen Urtikaria. Hält diese länger als 6 Wochen an, so lautet die Diagnose «chronische spontane Urtikaria». Diese Erkrankung, die nichts mit einer Allergie zu tun hat, tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf, wobei die Lebenszeitprävalenz bei ca. 2% liegt. Bei 60% der Patienten manifestiert sie sich nur in Quaddeln, bei 33% in Quaddeln und Angioödemen und bei 6 % nur in Angioödemen. Die Quaddeln können über viele Jahre immer wieder auftreten, begleiten den Patienten aber nicht ein Leben lang. Primär gilt es, das Krankheitsbild differentialdiagnostisch von anderen ähnlichen Erkrankungen wie Mastozytose, Vaskulitis, hereditäres Angioödem etc. abzugrenzen.
Die Mastzellen sind die Schlüsselzellen bei der Pathogenese der urtikariellen Reaktion. Sie können durch exogene Allergene aber auch durch Autoantigene aktiviert werden, man spricht von einer autoimmunen bzw. autoallergischen Urtikaria. Aber auch chronische Infekte vor allem im Zahn-, Hals-Nasen-Ohren-Bereich oder im Magen-Darm-Trakt wie Helicobacter pylori können eine chronische spontane Urtikaria auslösen. Dasselbe gilt für die nicht allergische Intoleranz gegenüber Konservierungs- und Farbstoffen in Lebensmitteln oder Medikamenten wie NSAR. In ca. 80% der Fälle gelingt es trotz intensiver Bemühungen nicht, die eigentliche Ursache zu finden. Es ist jedoch sinnvoll, verdächtige Medikamente wie Schmerzmittel abzusetzen und andere Trigger wie Stress zu vermeiden.
Die chronische spontane Urtikaria ist keine Befindlichkeitsstörung. Vielmehr ist die Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Betroffene klagen nicht nur über quälenden Juckreiz sondern auch über Schlaf-und Konzentrationsstörungen, Stigmatisierung und Einschränkung der sozialen Beziehungen. Da keine kausale Therapie zur Verfügung steht, bleibt nur die symptomatische Behandlung. Basistherapie sind Anthistaminika. Wegen der sedierenden Nebenwirkung sollten heute aber nur solche der 2. Generation (Desloratidin, Loratidin, Cetirizin, Levocetirizin, Fexofenadin, Ebastin, Rupatadin ) eingesetzt werden. Dies gilt auch für Schwangere und Kinder. Wenn nach 2 Wochen mit der Standarddosierung keine Besserung erreicht wird, sollte die Dosierung bis auf das 4-fache erhöht werden. Antihistaminika der 1. Generation sollten heute, so Kündig, nicht mehr verordnet werden, und zwar wegen der sedierenden Nebenwirkung. Diese führt nämlich nicht zu einer Verbesserung der Schlafqualität sondern sogar zu einer Verschlechterung, da die für die Erholung wichtigen REM-Phasen unterdrückt werden. Für therapierefraktäre Fälle steht ein monoklonaler Antikörper gegen IgE, nämlich Omalizumab, zur Verfügung, der bereits seit vielen Jahren bei therapierefraktärem Asthma bronchiale erfolgreich eingesetzt wird. Alternativ kann auch ein Therapieversuch mit Montelukast oder Cyclosporin A erfolgen. Eine Dauertherapie mit Steroiden ist dagegen nicht sinnvoll.
Bei Patienten mit starkem Juckreiz ohne Ursache empfiehlt sich die Gabe eines Antikonvulsivums wie Gabapentin oder Pregabalin und/oder eines Antidepressivums. Als topische Therapeutika stehen das in verschiedenen Paprika-Arten vorkommende Alkaloid Capsaicin und das Lokalanästhetikum Polidocanol zur Verfügung.