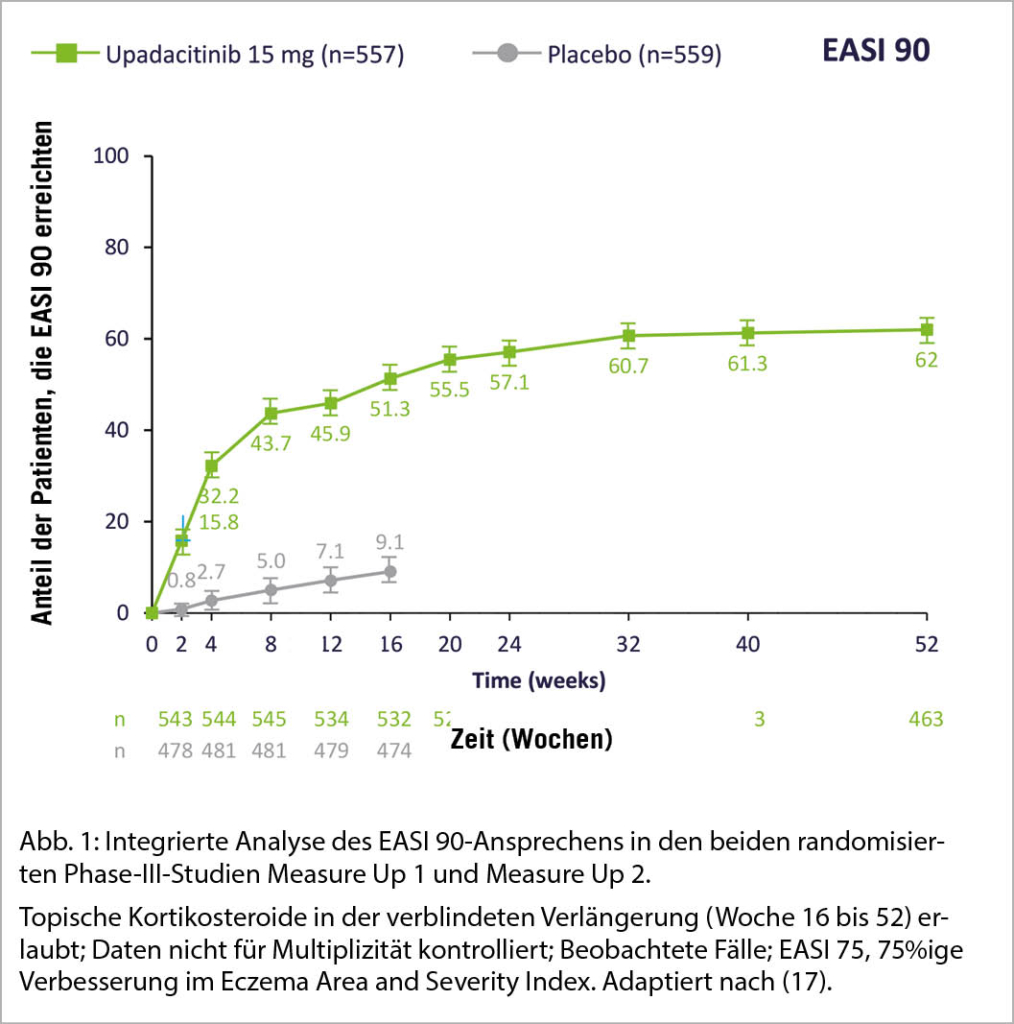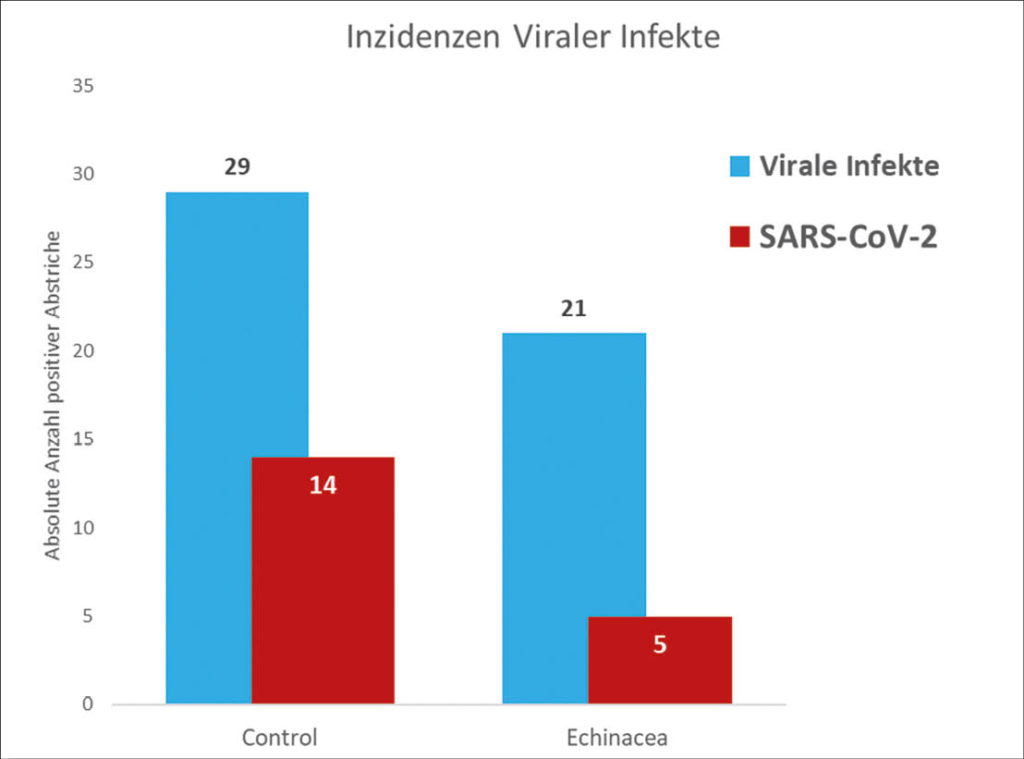Ein Vitamin-D-Mangel ist mit einem erhöhten Sturzrisiko verbunden und betrifft bis zu 70% der älteren Menschen jenseits des 60. Lebensjahres (1, 2). Die Metaanalysen randomisierter, kontrollierter Studien zur Vitamin-D-Supplementierung sind jedoch divergent aufgrund unterschiedlicher Dosierungen, Verabreichungsformen und Funktionszustände.
In STURDY, einer pragmatischen randomisierten Studie (adaptiver 2-stufiger Bayesianischer Ansatz), die in einer ambulanten Population in Maryland (USA) durchgeführt wurde, verglichen die Untersucher die Wirkung von 4 Dosen einer Vitamin-D-Supplementierung (200 IE/d, 1000 IE/d, 2000 IE/d und 4000 IE/d) auf ein kombiniertes primäres Outcome von erstem Sturz oder Tod während einer zweijährigen Nachbeobachtungszeit. Die Patienten (N = 688; Durchschnittsalter 77.2 ± 5.4 Jahre) hatten einen Serumspiegel von Vitamin D zwischen 10 und 29 µg/L (25 bis 72.5 nmol/L) und ein hohes Sturzrisiko (definiert als ≥ 2 Stürze oder ≥ 1 Sturz mit Fraktur oder die Notwendigkeit einer dringenden Konsultation in den letzten 12 Monaten, Angst vor Stürzen, Gleichgewichtsstörungen oder Verwendung von Hilfsmitteln). Ausschlusskriterien waren: 1. neurokognitive Störungen (MMSE < 24), Hyperkalzämie d.h., Harnwegssteine in der Anamnese oder eine übliche Vitamin-D-Supplementierung >1000 IE/d oder Calcium-Supplementierung >1200mg/d.
In der ersten Phase erwies sich die Vitamin-D-Supplementierung von 1000 IE/d als die erfolgreichste, mit einer Outcome-Rate von 72.1 (95% CI: 53.7 – 96.9) pro 100 Personenjahre (PJ), gegenüber 108.0 PJ bzw. 99.4 PJ in den Gruppen mit 2000 und 4000 IE/d. Darüber hinaus wurde die Randomisierung in diese beiden Arme nicht abgeschlossen. Die beiden anderen Arme wurden frühzeitig gestoppt, da eine Zwischenanalyse eine höhere Rate an Krankenhauseinweisungen oder Todesfällen im Vergleich zur Kontrollgruppe mit 200 IE/d zeigte.
In der zweiten Phase zeigten die Ergebnisse keinen statistisch signifikanten Unterschied in Bezug auf das primäre Outcome der Gruppe mit 1000 IE/d und der Kontrollgruppe mit 200 IE/d (76.9 vs. 76.0 Ereignisse pro 100 PJ; HR 0.94; 95%CI 0.76 – 1.15). Im Gegensatz dazu war das Risiko eines schweren Sturzes (mit Luxation/Fraktur) (HR 1.87; 95%CI 1.03 – 3.41) sowie das Risiko eines Sturzes mit Krankenhauseinweisung (HR 2.48; 95 %CI 1.13 – 5.48) in der Gruppe mit 1000 IU/d signifikant erhöht.
Kommentare
Der Begriff «sturdy» wird im Deutschen mit «robust» übersetzt. Robust ist diese Studie methodisch in vielerlei Hinsicht: adaptives Design, das mehrere Vitamin-D-Dosierungen beinhaltet. Die Auswahl der gefährdeten bis robusten Vitamin-D-Mangelpopulation erfolgte anhand von expliziten Kriterien und wies gute Adhärenz und begrenzte Attrition auf.
Die Wahl der Dosierung der Kontrolldosis von 200 IE/d, die von den Prüfärzten gewählt wurde, kann jedoch in Frage gestellt werden. Dies aufgrund einer geschätzten durchschnittlichen täglichen Aufnahme von 725 IE/d (Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel), was einer geschätzten täglichen Deckung von 925 IE/d entspricht. Ausgehend von dieser Annahme, warum nicht eine Placebo-Kontrollgruppe vorschlagen? Oder, in Kenntnis dieser ungleichen Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln (und damit von Vitamin D und Kalzium) in der amerikanischen Bevölkerung, wäre auch die Idee interessant, die Gesamtaufnahme zu vereinheitlichen, indem man den Patienten auffordert, während der Studie keine Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren (oder die Dosierung entsprechend der eigenen Aufnahme anzupassen.
Insgesamt kommt die Studie nicht nur zu dem Schluss, dass eine höhere Vitamin-D-Supplementierung als die in den Richtlinien empfohlene keine Vorteile für robuste bis vulnerable ältere Patienten bringt, sondern sie liefert sogar zusätzliche Belege für die Möglichkeit von schädlichen Auswirkungen einer Substitution mit zu hohen Dosen (d.h. ≥ 50000 IE/d).
Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese Studie nicht für unsere am stärksten abhängigen und gebrechlichen Patienten gilt, insbesondere nicht für solche mit neurokognitiven Störungen, sowie solche mit Osteoporose oder schweren Vitamin-D-Mangel-erscheinungen (< 10 µg/L).
Dr. med. Solène Mérandon, Leiterin der Klinik CUTR Sylvana
Dr. med. Sylvain Nguyen, Leitender Arzt Abteilung für Geriatrie und geriatrische Rehabilitation CHUV, Chemin de Sylvana 10, 1066 Epalinges
Quelle: Appel LJ, Michos ED, Mitchell CM et al. The Effects of Four Doses of Vitamin D Supplements on Falls in Older Adults. Ann Intern Med 2021; 174:145-156
1. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orav J et al. Monthly High-Dose Vitamin D Treatment for the Prevention of Functional Decline, JAMA Intern Med 2016; 176(2): 175-183
2. Sakem B, Nock C, Stanga Z et al. Serum Concentration of 25-OH-Vitamin D and Immunoglobulins in an Older Swiss Cohort. BMC Med 2013 ; 11:176