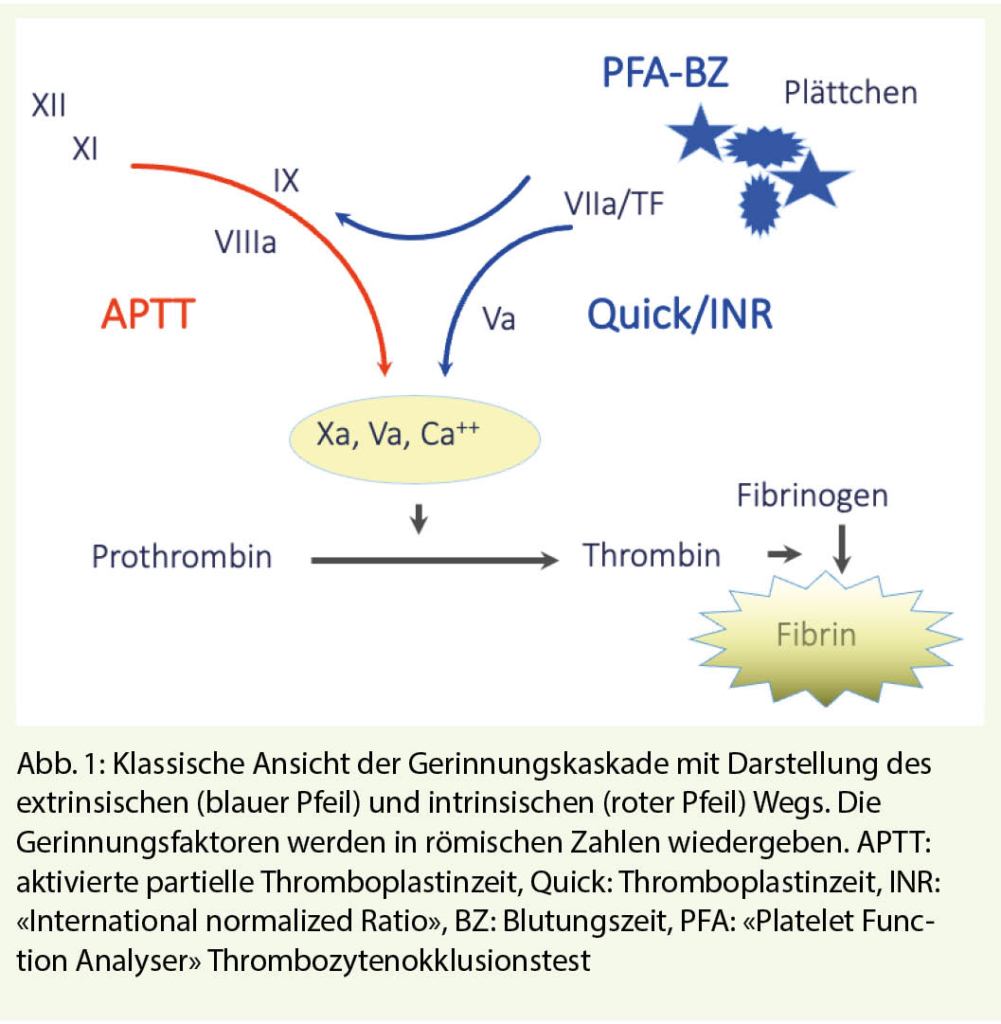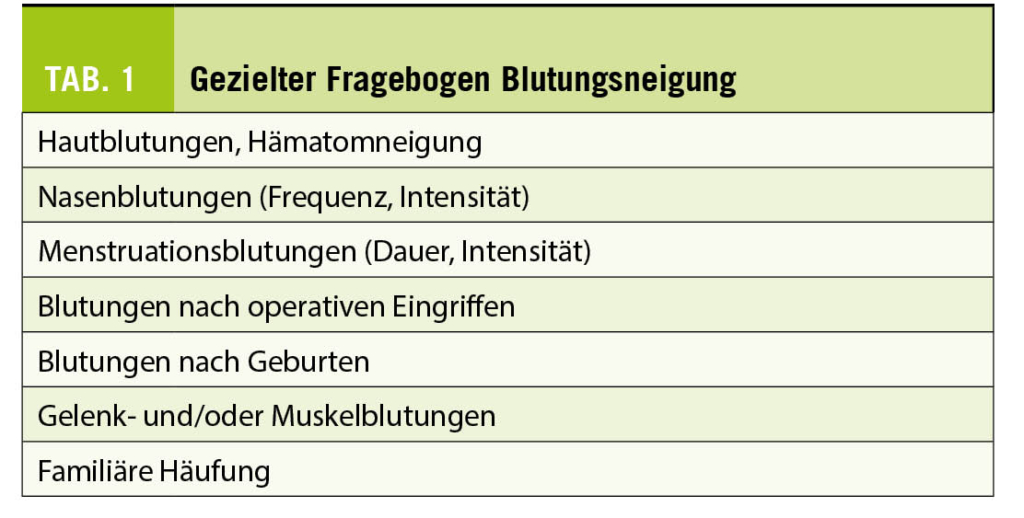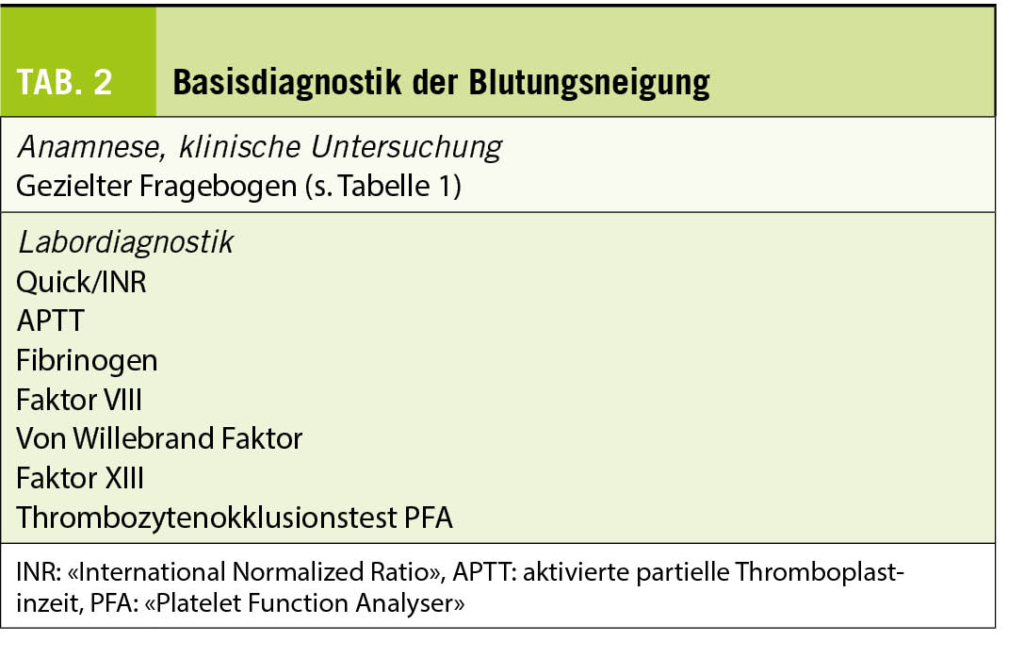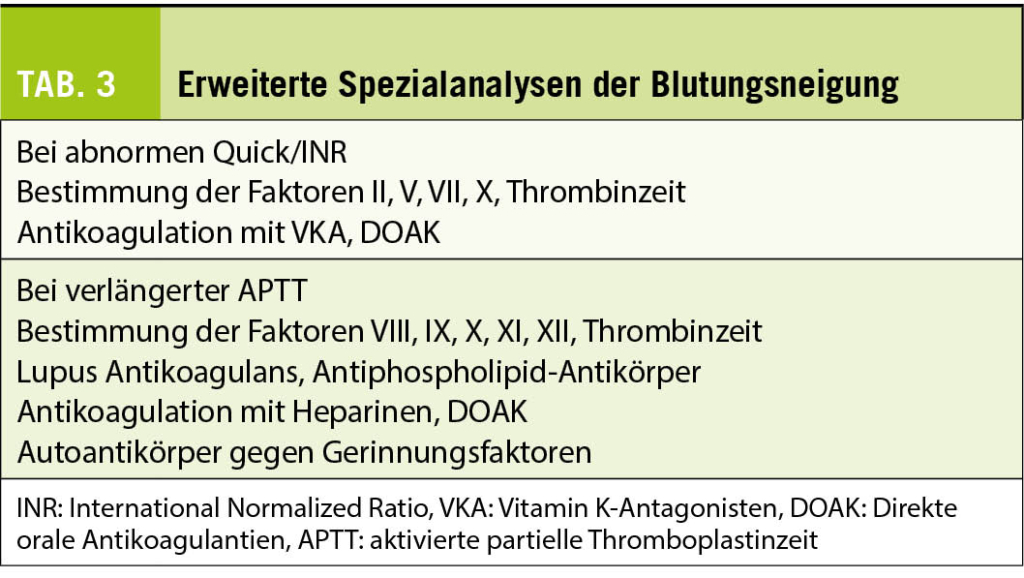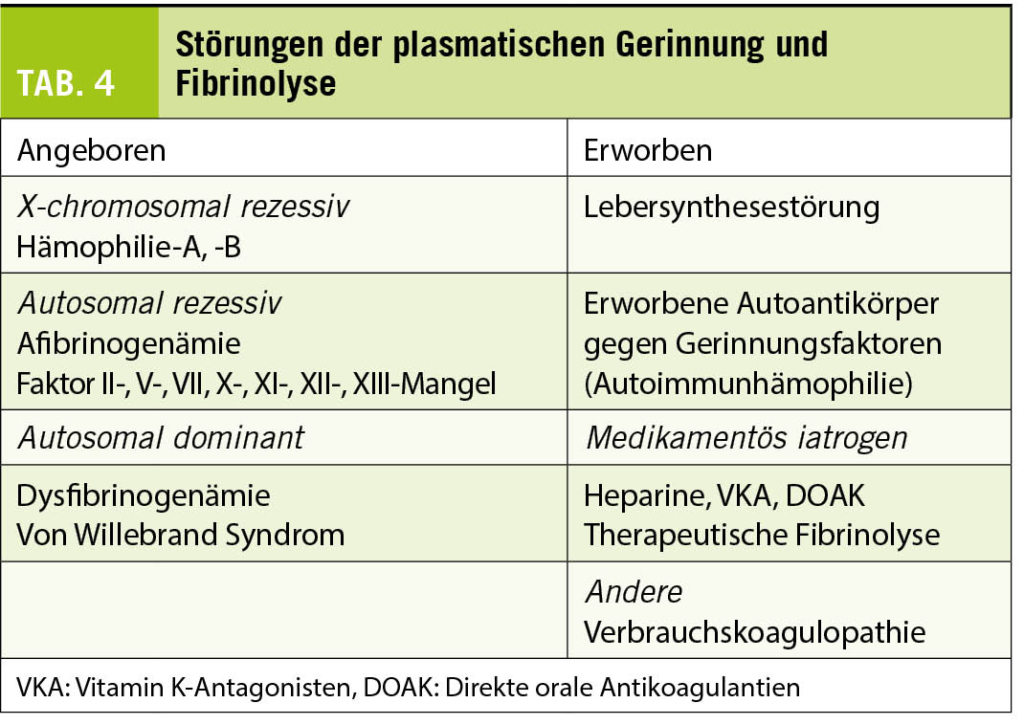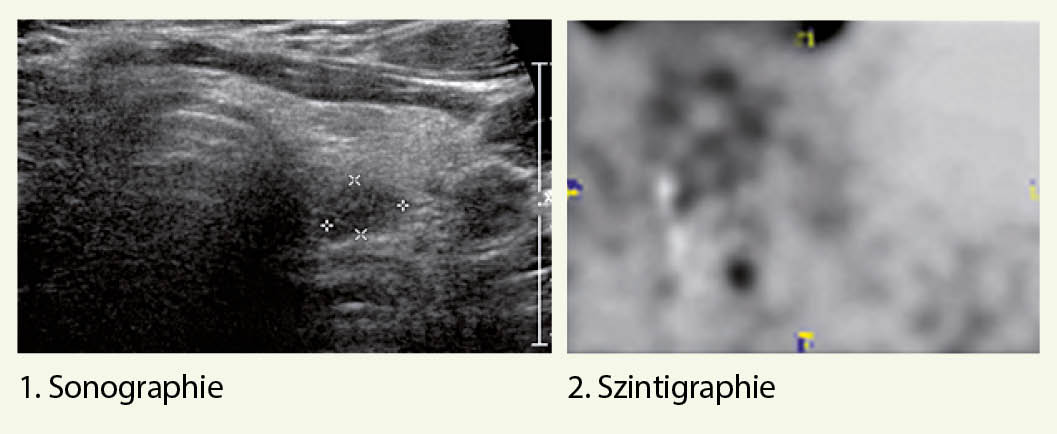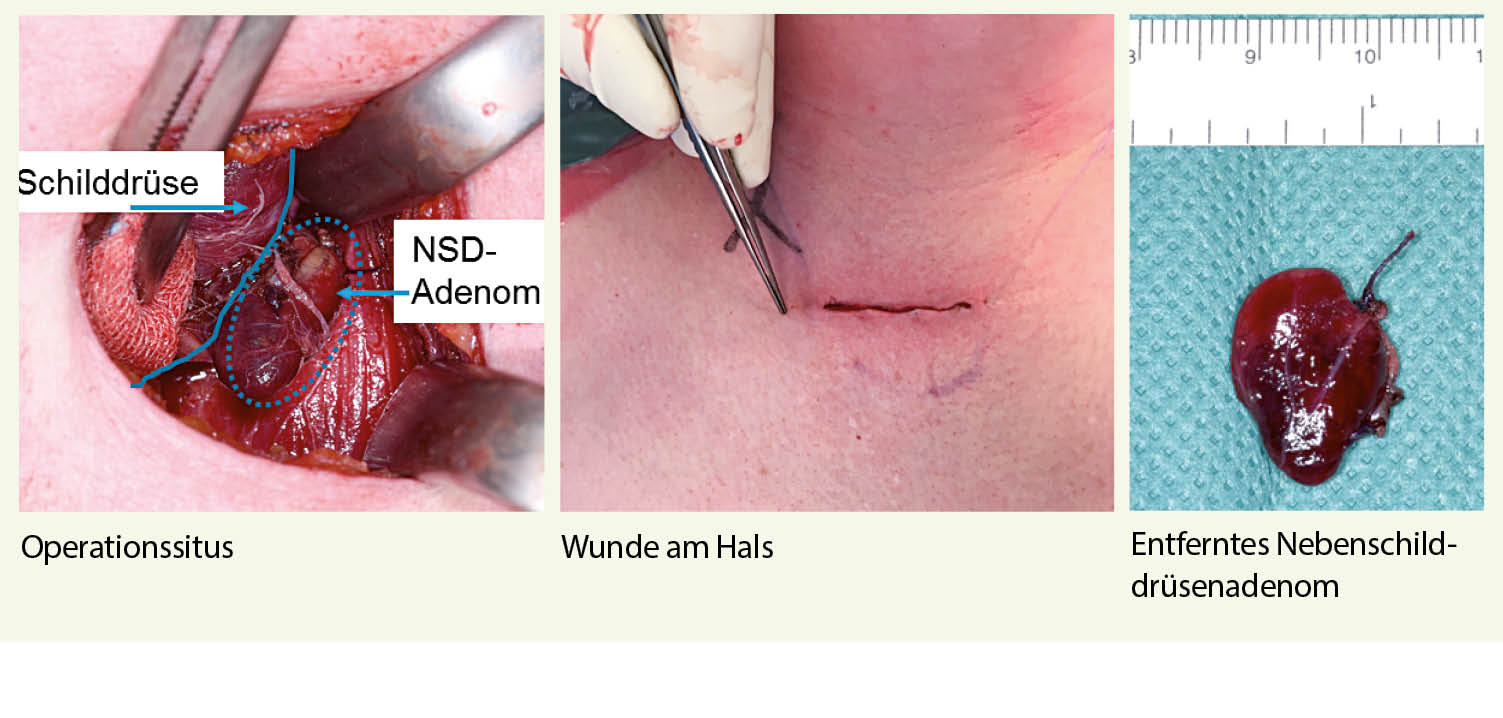Aufgrund der steigenden Zahl älterer Menschen nimmt die Zahl der Krebspatienten und die Zahl der krebsbedingten Todesfälle zu. Gleichzeitig nimmt das Neuerkrankungsrisiko für Krebs insgesamt bei Männern ab und bleibt bei Frauen unverändert. Das Risiko, an Krebs zu sterben, nimmt bei Männern und bei Frauen ab. Diese Erkenntnisse gehen aus dem dritten Schweizerischen Krebsbericht 2021 hervor, den das Bundesamt für Statistik (BFS), die Nationale Krebsregistrierungsstelle (NKRS) und das Kinderkrebsregister (KiKR) gemeinsam erarbeitet haben. Der Bericht enthält die neuesten verfügbaren Daten zu Krebs in der Schweiz für die Periode 2013–2017.
Im Zeitraum von 2013 bis 2017 betrug die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen bei Männern rund 23 100 und bei Frauen rund 19 650. Sie hat damit innerhalb von fünf Jahren bei beiden Geschlechtern zusammen um etwa 3350 Fälle zugenommen. Für das Jahr 2021 werden rund 48 000 Meldungen neuer Krebsdiagnosen erwartet, 26 000 bei Männern und 22 000 bei Frauen. Hauptgrund für diese Zunahme ist die demografische Entwicklung mit einer wachsenden Zahl älterer Menschen.
Kein Grund für die Zunahme der Fälle ist das Erkrankungsrisiko, welches im Gegenteil für Krebs insgesamt zwischen 2003 und 2017 bei Frauen nahezu unverändert blieb und bei Männern sogar leicht abnahm. Die mittlere jährliche Neuerkrankungsrate hat in den letzten zwei Jahrzehnten derweil bei männlichen Kindern und Jugendlichen um 0,8% und bei weiblichen um 1,4% zugenommen. Hierbei kann es sich um eine Kombination aus verbesserter Registrierung, veränderter Diagnosepraxis, zufälligen Schwankungen aufgrund kleiner Fallzahlen und echtem Anstieg handeln. Die Mortalitätsraten haben bei Kindern und Jugendlichen im gleichen Zeitraum angesichts verbesserter Therapien abgenommen.
Vier Krebsarten dominieren
Bei Männern machen Prostata-, Lungen- und Dickdarmkrebs 50,3% der jährlichen Neuerkrankungen aus, bei Frauen entfallen 51,1% auf Brust-, Lungen- und Dickdarmkrebs. Die anderen Krebsarten haben alle je einen Anteil von weniger als 7% der jährlichen Neuerkrankungen. Bei Kindern sind Leukämien, Hirntumore und Tumore aus embryonalem unreifem Gewebe am häufigsten.
Jährlich sterben rund 17 000 Personen an Krebs
Pro Jahr starben zwischen 2013 und 2017 jährlich rund 9400 Männer und 7650 Frauen an Krebs. Somit waren 30% aller Todesfälle bei Männern und 23% aller Todesfälle bei Frauen in der Schweiz durch Krebs bedingt. Bei Männern werden 21% der Krebstodesfälle durch Lungenkrebs, 14% durch Prostatakrebs und 10% durch Dickdarmkrebs verursacht. Bei Frauen ist Brustkrebs für 18%,
Lungenkrebs für 16% und Dickdarmkrebs für 10% der Krebstodesfälle verantwortlich.
Bei Kindern verursachen Leukämien und Hirntumore die meisten Todesfälle. Insgesamt stellt Lungenkrebs mit 3200 Todesfällen pro Jahr die häufigste krebsbedingte Todesursache dar.
Die Sterberaten für Krebs sind im Zeitraum von 1988 bis 2017 im Durchschnitt bei den Frauen um 28% und bei den Männern um 39% zurückgegangen. Dies bedeutet, dass Frauen heutzutage ein um fast ein Drittel tieferes Risiko haben, an Krebs zu sterben, verglichen mit gleichaltrigen Frauen vor 30 Jahren. Bei den Männern hat das Sterberisiko in den vergangenen drei Jahrzehnten sogar um weit über ein Drittel abgenommen.
Bei vielen Krebsarten verbessern sich die Überlebenschancen
Im Zeitraum 2013–2017 beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate über alle Krebsarten hinweg betrachtet und unter Berücksichtigung anderer Todesursachen für Männer 64% und für Frauen 67%. Gegenüber dem Zeitraum 2003– 2007 ist dies bei Männern und bei Frauen ein Anstieg um jeweils 3 Prozentpunkte. Bei Kindern liegt die 5-Jahres-Überlebensrate mittlerweile sogar bei über 85%. Die Überlebenschancen werden von der Krebsart sowie vom Zugang zur medizinischen Behandlung und deren Wirksamkeit beeinflusst.
Tiefe Erkrankungs- und Sterberaten im internationalen Vergleich
Im Vergleich mit neun europäischen Ländern (darunter die Schweizer Nachbarstaaten und andere westeuropäische Nationen) liegen die Neuerkrankungsraten in der Schweiz für alle Tumorarten zusammen betrachtet bei Männern als auch bei Frauen tief. Was die Sterberaten angeht, so hat die Schweiz bei den Männern die zweitniedrigste und bei den Frauen die niedrigste Rate. Bei den
5-Jahres-Überlebensraten liegt die Schweiz auf einem mittleren Rang. Auch bei Kindern und Jugendlichen sind die Überlebensraten nach einer Krebserkrankung vergleichbar mit denen der Nachbarländer.
Inhalt, Datenquellen und Methoden
Der Schweizerische Krebsbericht 2021 erscheint im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Der Bericht enthält zu Krebs insgesamt und zu 24 einzelnen Krebsarten die wichtigsten epidemiologischen Kennzahlen: Häufigkeit der Neuerkrankungen, Häufigkeit der Todesfälle, mittlere Überlebensdauer nach Diagnosestellung, verlorene potenzielle Lebensjahre, das Erkrankungsrisiko, sowie die Anzahl der in der Schweiz mit oder nach einer Krebsdiagnose lebenden Personen. Der Bericht beschreibt den aktuellen Stand aufgrund der Daten 2013–2017, die Entwicklung zwischen 1988 und 2017 und schätzt die Erkrankungsraten und Sterbefälle für 2021. Die darin verwendeten statistischen Daten stammen aus den regionalen und kantonalen Krebsregistern, die von der Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) zusammengeführt werden, dem Kinderkrebsregister (KiKR) sowie von Erhebungen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Für neun mit der Schweiz aufgrund dem Stand der Entwicklung und der Datenlage gut vergleichbare Länder (Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen und Schweden) werden Vergleichszahlen aus internationalen Quellen präsentiert.
Der Hauptbericht zu Stand und Entwicklungen wird durch einen Methodenbericht komplettiert. In diesem sind weiterführende Angaben zu den verwendeten Klassifikationen, Datenquellen und Datenqualität, Definitionen und Berechnung der Indikatoren sowie zur Präsentation der Kennzahlen zu finden.
Auskunft
Rolf Weitkunat, BFS, Sektion Gesundheit der Bevölkerung,
Tel.: +41 58 485 67 24, E-Mail: rolf.weitkunat@bfs.admin.ch
Ulrich Wagner, NKRS, Nationale Krebsregistrierungsstelle,
Tel.: +41 44 634 53 73, E-Mail: ulrich.wagner@nicer.org
Shelagh Redmond, KiKR, Kinderkrebsregister,
Tel.: +41 31 684 38 99, E-Mail: shelagh.redmond@ispm.unibe.ch
Medienstelle BFS, Tel.: +41 58 463 60 13, E-Mail: media@bfs.admin.ch
Neuerscheinung
«Schweizerischer Krebsbericht 2021», BFS-Nummer: 1177-2100
Publikationsbestellungen, Tel.: +41 58 463 60 60,
E-Mail: order@bfs.admin.ch
Online-Angebot
Weiterführende Informationen und Publikationen:
www.bfs.admin.ch/news/de/2021-0245
Statistik zählt für Sie: www.statistik-zaehlt.ch
Abonnieren der BFS-NewsMails: www.news-stat.admin.ch
BFS-Internetportal: www.statistik.ch
Verfügbarkeit der Resultate
Diese Medienmitteilung wurde auf der Basis des Verhaltenskodex der
europäischen Statistiken geprüft. Er stellt Unabhängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht der nationalen und gemeinschaftlichen statistischen Stellen sicher. Die privilegierten Zugänge werden kontrolliert und sind
unter Embargo. Das Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM),
die Stiftung Nationales Institut für Krebsepidemiologie und Registrierung (NICER) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) haben diese Medienmitteilung ein Arbeitstag vor der offiziellen Publikation erhalten.