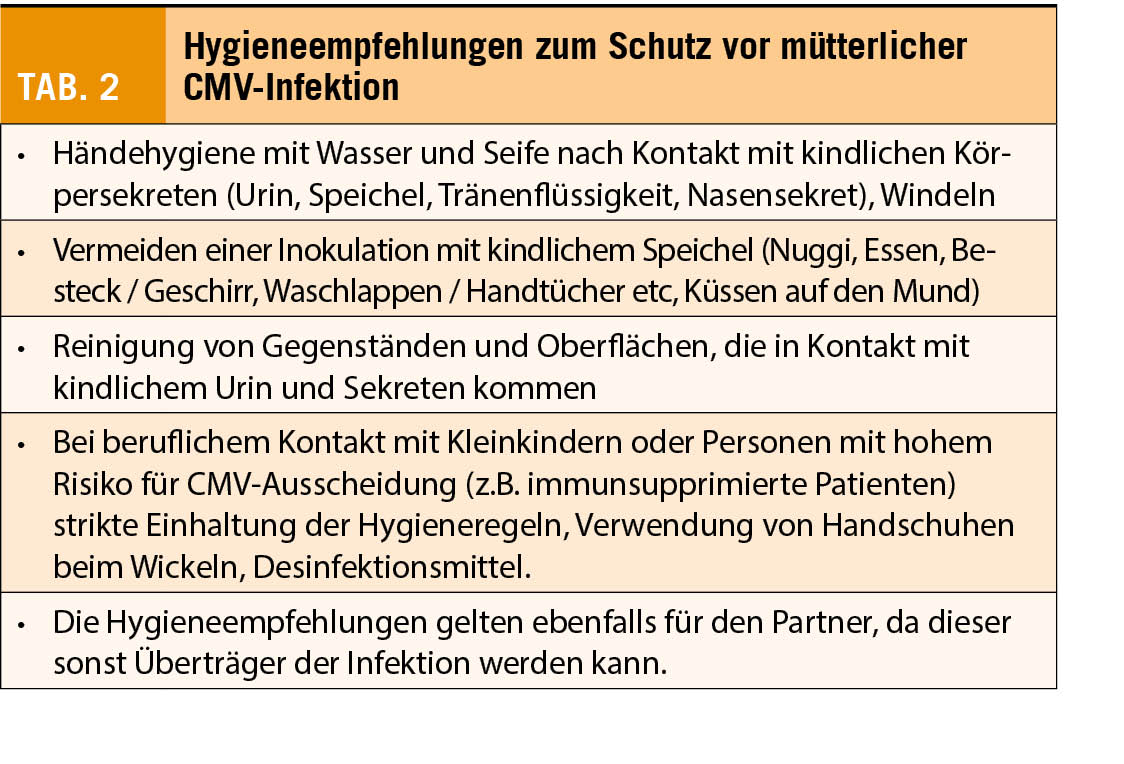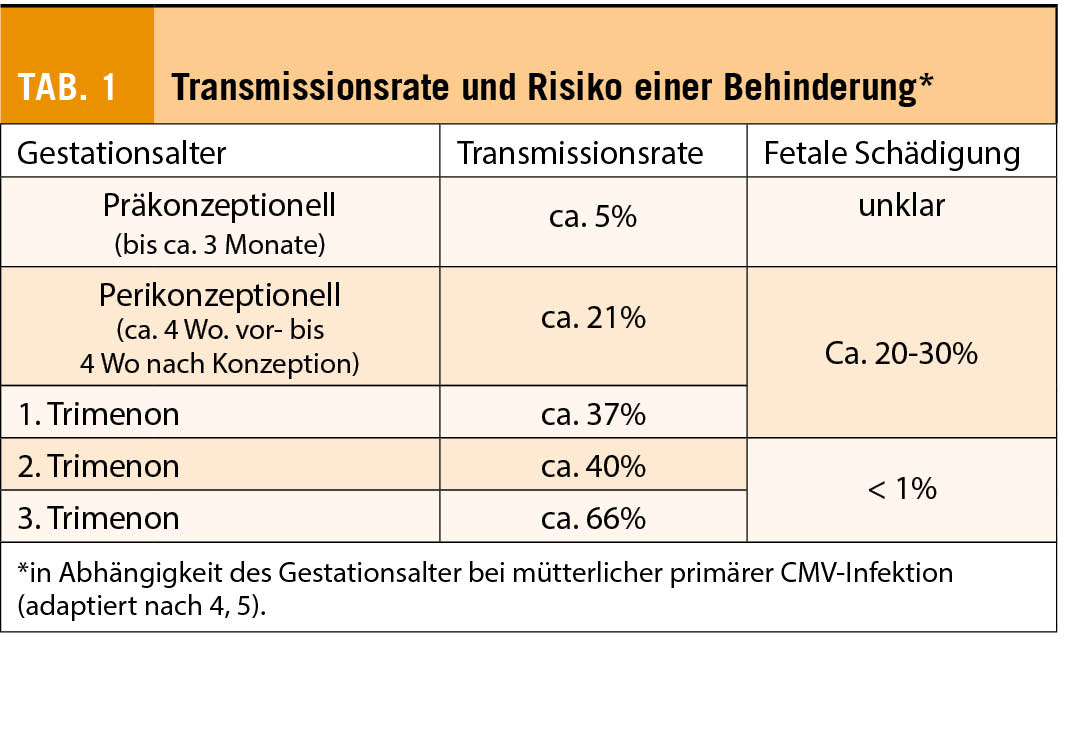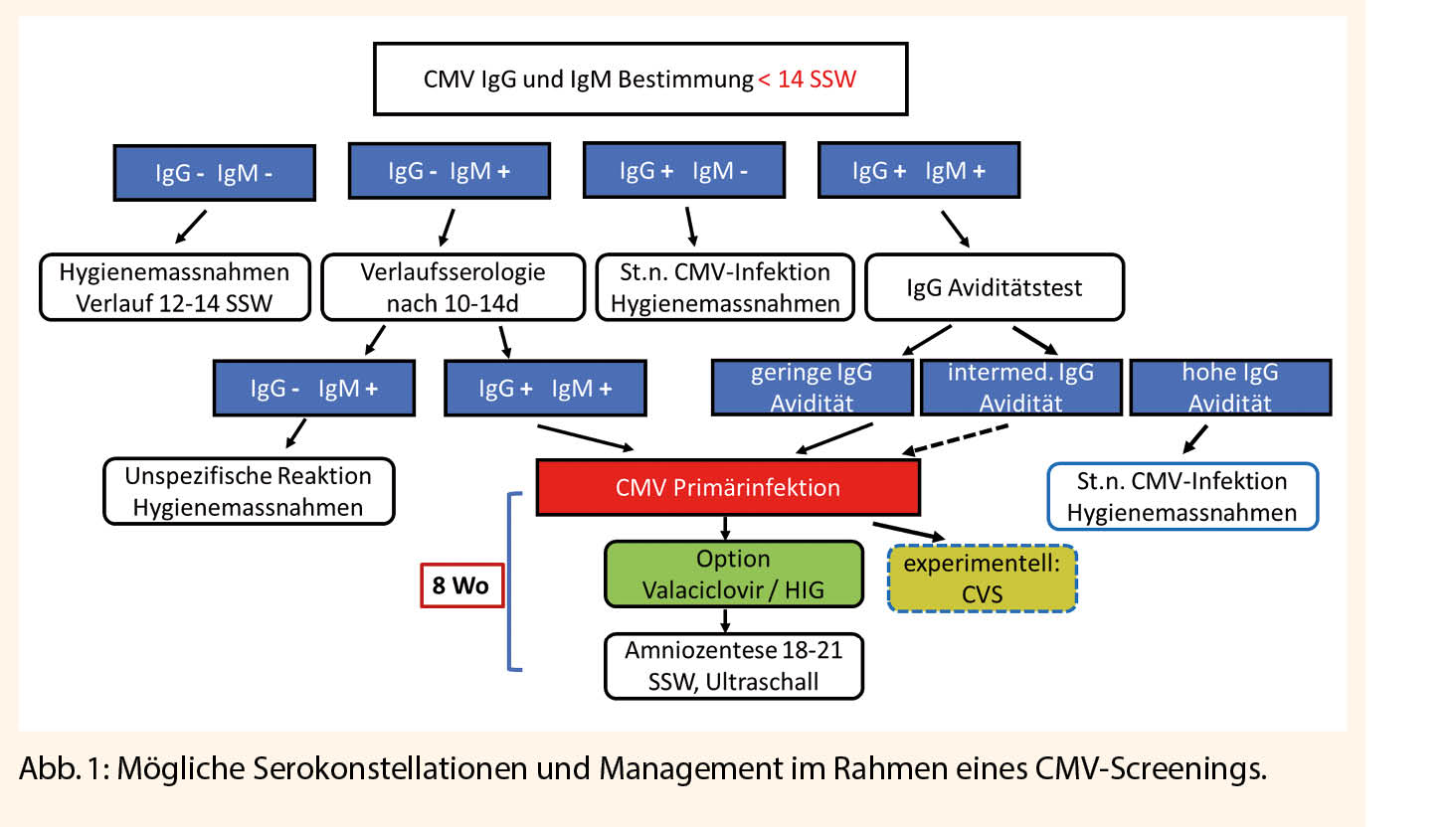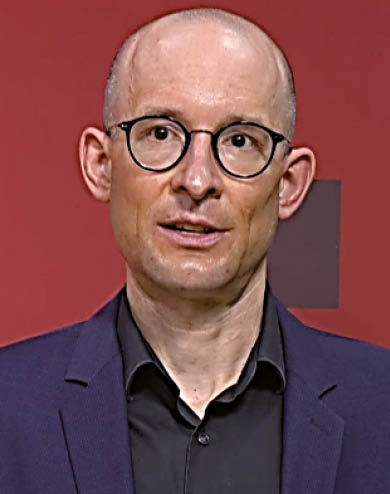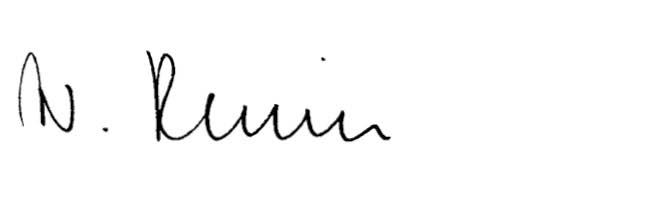EDITORIAL ESC-Kongress 2021 *virtuell*– die digitale Erfahrung
Neues aus der Kardiologie
Kongress der European Society of Cardiology 2021– the digital experience
Bedingt durch die COVID-19 Pandemie konnte auch dieses Jahr der ESC Kongress nur online erfolgen. Die Organisatoren ermöglichten den zahlreichen Besuchern trotz dieser Schwierigkeit einen sowohl wissenschaftlich als auch organisatorisch hervorragenden Kongress. Auch dieses Jahr wurden zahlreiche neue Daten in «Late Breaking News» vorgestellt, es wurden neue Guidelines erstmalig präsentiert und daneben vervollständigten zahlreiche Vorträge über neue Studienresultate und Poster Sessions das wissenschaftliche Programm, welches von Prof. Dr. med. Stephan Windecker, Bern, mit einem 68-köpfigen wissenschaftlichen Komitee mit höchster Kompetenz umsichtig zusammengestellt wurde.
Der Kongress fand in 417 Sessions, 141 Industrie-Sessions und an 36 Industrieständen, mit einer Fakultät und Referenten, die 317 Personen umfasste, statt. Trotz der durch die COVID-19 Pandemie bedingten Einschränkungen bot der ESC Kongress einmal mehr eine globale Bühne für die Wissenschaft und eine massgeschneiderte Plattform zur Gelegenheit sich mit den Besten zu verbinden und von ihnen zu lernen.
Mit unserer Kongress-Zeitung möchten wir den diesjährigen ESC Kongress nochmals aufleben lassen und Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse in Printversion näher bringen.

The Digital Experience
ESC Congress 2021 – Neues aus der Kardiologie
Auch diesmal wurden bei der Jahrestagung der European Society of Cardiology (ESC, 27. – 30.8.2021) zahlreiche neue Studienergebnisse präsentiert. Der virtuelle Kongress bot einen umfassenden Überblick über die wissenschaftliche Dynamik in diesem Fachgebiet.
Swisscardio ESC 2021 Update
Unter dem Vorsitz von Prof. Giovanni Pedrazzini, Lugano, dem Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und Prof. Christian Sticherling, Basel, wurden in einer ersten Session Präsentation von Hotline Sessions zu den Themen akute und chronische Koronarsyndrome, Valvular und Elektrophysiologie von Schweizer Kardiologen der zusammengefasst.
MASTER DAPT
Eine einmonatige duale Thrombozytenaggregationshemmer-Therapie (DAPT) nach einer Stent-Implantation bei Patienten mit hohem Blutungsrisiko bewahrt den ischämischen Nutzen und verringert das Blutungsrisiko. Das ist das Ergebnis einer bahnbrechenden Forschungsarbeit, die in einer Hot-Line-Sitzung vorgestellt wurde. Die verkürzte DAPT war der Standard-DAPT in Bezug auf unerwünschte klinische Nettoereignisse und schwerwiegende unerwünschte kardiale und zerebrale Ereignisse nicht unterlegen und in Bezug auf schwere oder klinisch relevante nicht-schwerwiegende Blutungen überlegen.

Im Gegensatz zu anderen Studien wurden keine Patienten mit akutem Koronarsyndrom ausgeschlossen oder die Anzahl, Lage oder Komplexität der behandelten Läsionen eingeschränkt. Die Ergebnisse können daher bei Patienten mit hohem Blutungsrisiko ohne postprozedurale ischämische Ereignisse, einschliesslich Patienten mit klinischen oder angiografischen Merkmalen mit hohem ischämischem Risiko, die Behandlungsentscheidungen zur DAPT einen Monat nach der PCI beeinflussen, so Prof. Marco Valgimigli, Cardiocentro Lugano, der Principal Investigator dieser Studie.
AMULET DIE

Im AMULET DIE Trial wurde der Watchman-FLX (BSC) mit einfachem Dichtungsmechanismus, der 2015 von der FDA zugelassen wurde, mit dem Verschlusssystem von AMULET (FDA-Zulassung 2021) verglichen, so Prof. Raban Jeger, Basel. Der AMULET Okkluder erwies sich gegenüber dem Watchman-Gerät in sämtlichen wichtigen Outcomes als nicht unterlegen. Im Hinblick auf den Verschluss der linken Vorhofvene dem Watchman-Gerät als überlegen. Trotz der reduzierten postinterventionellen Antikoagulation beim AMULET-Gerät waren die Raten an ischämischen oder Blutungsereignissen bei einem 18 monatigen Follow-Up vergleichbar.
ATLANTIS
In der ATLANTIS-Studie war Apixaban in voller Dosierung bei Patienten, die sich einer TAVI unterzogen, bei einer Indikation für orale Antikoagulation Behandlung mit Apixaban der Standardbehandlung (VKA, vs. Apixaban oder DAPT/SAPT vs. Apixaban) nicht überlegen. In den 2021 ESC Guidelines ist die orale Antikoagulation (OAC) lebenslang für TAVI-Patienten, die andere Indikationen für OAC haben, empfohlen (I/B). Eine lebenslange SAPT ist empfohlen nach TAVI bei Patienten ohne Baseline Indikation für OAC (I/A). die Routine OAC ist bei Patienten ohne Baseline Indikation für OAC nicht empfohlen (III/B). In ENVISAGR TAVI AF war Edoxaban dem VKA in Bezug auf den primären Wirksamkeitsendpunkt nicht unterlegen. Die Inzidenz schwerer Blutungen war unter Edoxaban höher als unter Vitamin-K-Antagonisten. Patienten, die die Kriterien für eine Dosisanpassung erfüllen, und Patienten ohne gleichzeitige Thrombozytenaggregations-Hemmer können eine geeignete Behandlungsgruppe für Edoxaban sein.
LOOP

In der von Prof. Dr. med. Michael Kühne, Basel, vorgestellten LOOP Studie wurde untersucht, ob die kontinuierliche Überwachung des Elektrokardiogramms (EKG) mit einem implantierbaren Schleifenschreiber und die anschliessende Antikoagulation bei Vorhofflimmern das Risiko eines Schlaganfalls oder einer systemischen arteriellen Embolie bei Risikopatienten verringern würde. Die Schlussfolgerungen aus der Studie waren, dass die kontinuierliche EKG Überwachung – mit oraler Antikoagulation bei Vorhofflimmern – den Schlaganfall bei Personen mit Risikofaktoren nicht verringert.
DECAAF II
Der Referent besprach ferner die Daten der DECAAF II Studie, die in einer Hot Line Session präsentiert wurden. An DECAAF II nahmen 843 Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern aus 44 Zentren weltweit teil. Die Teilnehmer wurden randomisiert und erhielten entweder Pulmonalvenenisolierung (PVI) plus bildgesteuerte Fibroseablation (Interventionsgruppe) oder PVI allein (Kontrollgruppe). Die Teilnehmer wurden im Hinblick auf den primären Endpunkt des Wiederauftretens von Vorhofarrhythmien (einschliesslich Vorhofflattern, Vorhofflimmern oder Vorhoftachykardie) 12 bis 18 Monate lang beobachtet. Das Wiederauftreten von Vorhofrhythmusstörungen wurde mit Hilfe mehrerer EKG-Methoden ermittelt, darunter 12-Kanal-EKG-Aufzeichnungen, Holter-Aufzeichnungen und ein Smartphone-EKG-Gerät, das alle Patienten nach der Ablation erhielten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die gezielte Behandlung der Vorhoffibrose bei Vorhofflimmern-Patienten mit geringem Fibrosegrad (weniger als 20 %) die Ergebnisse der Ablation verbessern kann. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die PVI bei Vorhofflimmern mit hohem Fibrosegrad (mehr als 20 %) die gängige Ablationsstrategie bleiben sollte. Die Ablation plus kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) ist einer pharmakologischen Frequenzkontrolle überlegen, wenn es darum geht, die Sterblichkeit bei Patienten mit schwerem symptomatischem permanentem Vorhofflimmern (AF) und engem QRS zu senken. Dies geht aus einer aktuellen Studie hervor, die heute in einer Hot-Line-Sitzung auf dem ESC vorgestellt wurde.
APAF-CRT
APAF-CRT war eine zweiphasige Studie bei Patienten mit schwerem symptomatischem permanentem Vorhofflimmern und engem QRS. Die erste Phase, die sich auf die Morbidität konzentrierte, zeigte, dass die Ablation des AV-Übergangs und die CRT die Zahl der Krankenhausaufenthalte aufgrund von Herzinsuffizienz verringerte und die Symptome der Herzinsuffizienz im Vergleich zur pharmakologischen Frequenzkontrolle nach zwei Jahren Nachbeobachtung verbesserte.
Die Ergebnisse der zweiten Phase, die sich auf die Sterblichkeit konzentrierte, werden heute vorgestellt. In einer grösseren Population mit einer längeren Nachbeobachtungszeit wurde in der Studie die Hypothese getestet, dass die Ablation des AV-Übergangs und die biventrikuläre Stimulation der pharmakologischen Frequenzkontrolle bei der Senkung der Gesamtmortalität überlegen ist.
Unter dem Vorsitz von Prof. Stephan Windecker, Bern, und Prof. Christian Müller, Basel, wurden in einer zweiten Session die Hot Line Präsentationen zu Herzinsuffizienz, Diabetes, Hypertonie, Lipide und Niereninsuffizienz besprochen.
EMPEROR PRESERVED
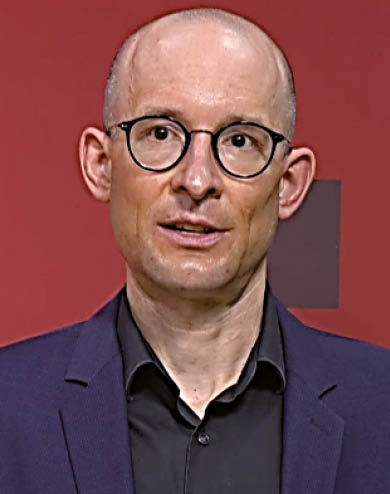
Wir wussten, dass es keine etablierte Therapie für HFpEF gibt und dass die SGLT-2 Hemmer die Hospitalisationen infolge Herzinsuffizienz verringern und günstige Wirkungen auf linksventrikuläre bei Patienten mit erhaltener LVEF haben. Wir wussten nicht, dass SGLT-2 Hemmer die Hospitalisierung und Mortalität wegen Herzinsuffizienz bei HFpEF verringern, stellte Prof. Micha Maeder, St. Gallen, fest. In der EMPEROR PRESERVED Studie reduzierte Empagliflozin das kombinierte Risiko eines kardiovaskulären Todes oder einer Krankenhauseinweisung wegen Herzinsuffizienz bei Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Ejektionsfraktion, unabhängig davon, ob ein Diabetes vorlag oder nicht. Dies ist die erste Studie, die einen günstigen Effekt bei HFpEF gezeigt hat.
GUIDE-HF
Es war bekannt, dass das hämodynamisch gelenkte (HD)- Management die Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz bei Patienten im NYHA III Stadium mit vorheriger Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz unabhängig von der LVEF reduziert. Es war aber nicht bekannt, ob das HD-gelenkte Management auch bei NYHA II und NYHA IV Patienten und solchen mit erhöhten natriuretischen Peptiden aber ohne Herzinsuffizienz wirksam ist. Die Ergebnisse der GUIDE-HF Studie deuten darauf hin, dass die Vorteile eines hämodynamisch geführten Managements zur Verringerung der Krankenhausaufenthalte bei Herzinsuffizienz auch für Patienten mit weniger schwerer Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse II) und für Patienten mit NYHA-II- und -III-Symptomen und erhöhten natriuretischen Peptiden, aber ohne vorherigen Krankenhausaufenthalt, gelten. Bei den Patienten mit Herzinsuffizienz der NYHA-Klasse IV wurden keine konsistenten Ergebnisse erzielt, ihre Zahl war jedoch gering. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich eindeutig auf die Ergebnisse von GUIDE-HF aus,
FIGARO-DKD

Finerenon verbessert die Ergebnisse bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Nierenerkrankung und Diabetes, wie die in einer Hot Line Session präsentierte FIGARO-DKD-Studie zeigte. Die Daten wurden von Frau PD Dr. Qian Zhou, Basel, vorgestellt. Finerenon ist ein nicht-steroidaler, selektiver Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (MRA) und der erste Vertreter dieser Substanzklasse, der einen Nutzen im Hinblick auf renale und kardiovaskuläre Ergebnisse bei Patienten mit CKD und Typ-2-Diabetes in der Studie FIDELIO-DKD gezeigt hat. In FIGARO-DKD senkte Finerenon die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität um 13% und ergab einen günstigen Trend für Nieren-bezogene Outcomes (senkte die Inzidenz von ESKD signifikant). FIGARO-DKD zeigte den Bedarf an früher Behandlung zur Senkung der kardiovaskulären und der Herzinsuffizient-Bel. Die Studie zeigte auch die Wichtigkeit des Monitorings des Albumin/Creatinin-Verhältnisses im Urin bei Patienten mit T2DM trotz einer eGFR>60ml/min/1.73m2 auf.
STEP
Qian Zhou kommentierte ferner die STEP Studie, die eine intensive gegenüber der Standard-Blutdruck-Kontrolle bei älteren hypertensiven Patienten untersuchte. Dabei zeigte sich, dass das intensive systolische Blutdruckziel (110 bis <130mmHg gegenüber dem Standard-Blutdruckziel 130 bis <150mmHg) kardiovaskuäre Ereignisse und 26%, Schlaganfall um 33% ACS um 33% und akute Herzinsuffizienz um 73% senkte. Die Therapie mit Olmesartan, Amlodipin und HCT wurde gut vertragen.
QUARTET
In der mutizentrischen QUARTET-Studie wurde eine Vierertablette (mit Irbesartan zu 37-5 mg, Amlodipin zu 1-25 mg, Indapamid zu 0-625 mg und Bisoprolol zu 2-5 mg) mit einer Monotherapie-Kontrolle (Irbesartan 150 mg) verglichen. Falls der Blutdruck nicht den Zielwert erreichte, konnten in beiden Gruppen zusätzliche Medikamente verabreicht werden, beginnend mit Amlodipin in einer Dosierung von 5 mg. Es zeigte sich, dass eine frühzeitige Behandlung mit einer fest dosierten Vierfach-Vierteldosis-Kombination zu einer stärkeren und anhaltenden Blutdrucksenkung als die übliche Monotherapie führte
NATURE-PCSK9
Eine weitere Studie, die von Qian Zhou vorgestellt wurde war NATURE-PCSK9. In dieser Studie wurden die Auswirkungen einer LDL-Senkung durch eine einmal jährlich verabreichte Dosis eines PCSK9-siRNA im Vergleich zur üblichen Behandlung ab einem Alter von 30, 40, 50 oder 60 Jahren auf das Lebenszeitrisiko für kardiovaskuläre Ereignisse bis zum Alter von 80 Jahren untersucht. Die Gesamtergebnisse zeigten, dass die impfstoffähnliche Strategie im Vergleich zur üblichen Behandlung zu einer anhaltenden Senkung des LDL-Plasmaspiegels um 34 % im Zeitdurchschnitt führte. Ausserdem wurde eine schrittweise Erhöhung der proportionalen Verringerung des Lebenszeitrisikos für kardiovaskuläre Ereignisse mit jedem früheren Lebensjahrzehnt, in dem mit der LDL-Senkung begonnen wurde, beobachtet. So wurde beispielsweise bei Männern, die im Alter von 60 Jahren mit der Behandlung begannen, eine 27%ige Verringerung des Lebenszeitrisikos festgestellt, während der Beginn der Behandlung im Alter von 30 Jahren mit einer 52%igen Verringerung des Risikos verbunden war. Ähnliche Ergebnisse wurden bei Frauen beobachtet.
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen
Wie gefährlich sind gesättigte Fette?
Gesättigte Fette gelten schlechthin als ungesund, sprich atherogen. Doch die Zusammenhänge sind weitgehend ungeklärt. Dazu kommt, dass Menschen, die sich vermehrt mit ungesättigten Fetten ernähren, in der Regel stark übergewichtig sind und ein erhöhtes LDL-Cholesterin aufweisen. Somit stellt sich die Frage, ob die gesättigten Fette direkt oder indirekt über das Gewicht bzw. das erhöhte LDL-C ihre ungünstige Wirkung an den Gefässen entfalten. Und welche Bedeutung hat die Herkunft der Fette? Sind gesättigte Fette aus Fleisch und Milchprodukten unterschiedlich zu bewerten?
Diesen Fragen ist man in einer Beobachtungsstudie nachgegangen. Insgesamt fand sich nach einer 8,5-jährigen Beobachtungszeit keine klare Assoziation zwischen der Gesamtmenge an gesättigten Fetten und dem kardiovaskulären Risiko. Doch eine um 5% höhere Menge an gesättigten Fetten an der Gesamtenergiezufuhr aus Fleisch erhöhte das kardiovaskuläre Risiko um ca. 20%. Doch nach einer Gewichtsadjustierung waren die Ergebnisse nicht mehr signifikant. «Der vermehrte Genuss von Milchprodukten verringerte zwar das kardiovaskuläre Risiko, aber nach Gewichtsadjustierung ebenfalls nicht signifikant», so Dr. Rebecca Kelly, Oxford.
PS
Akuter Herztod: Atemnot ist ein wichtiges Alarmsymptom
Viele Patienten, die einen akuten Herztod erleiden, klagen über prämonitorische Symptome wie Stenokardien oder Luftnot. Bisher war man der Meinung, dass der Brustschmerz der zuverlässigste Prädiktor sei. Doch jetzt konnte in einer Studie gezeigt werden, dass die Atemnot das drohende fatale Ereignis zuverlässiger voraussagt als ein Angina pectoris-Anfall. «Klagt der Patient über plötzlich aufgetretene starke Atembeschwerden, so müssen die Alarmglocken läuten», so Prof. Filip Gnesin, Hillerod. Einer von zehn Patienten mit einem akuten Herztod hatte in dem Zeitfenster von 24 Stunden vor dem Ereignis den ärztlichen Notdienst wegen Atembeschwerden telefonisch kontaktiert, so das Ergebnis einer dänischen Registerstudie. Von 4.071 Patienten mit einem Herzstillstand hatten 481 (11.8%) vor dem Ereignis den Arzt kontaktiert. 59,4% klagten über Atembeschwerden, 23,0% über Schwindel, 20,2% über Bewusstseinsverlust, 19,5% über Brustschmerzen und 19,1% über Blässe. Doch nur bei 68,7% der
Patienten mit Atemnot erfolgte eine notfallmässige Behandlung im Vergleich zu 83% bei Angabe von Brustschmerz. Von den Patienten mit Atemnot verstarben 81% innerhalb von 30 Tagen, bei Brustschmerzpatienten waren es 47%. «Die Daten zeigen, dass das Symptom Atembeschwerden zu selten als Alarmsymptom für den akuten Herztod wahrgenommen wird», so Gnesin.
PS
Diabetische Nephropathie: Finerenon schützt Herz und Niere
Die diabetische Nephropathie ist eine der häufigsten Folgeerkrankungen bei Diabetikern. Betroffene Patienten haben ein stark erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. «Dabei korreliert das Risiko mit dem Ausmass der Nierenschädigung», so Prof. Gerasimos Filippatos, Athen. Das Infarktrisiko sei deutlich höher als bei Diabetikern ohne Nephropathie. Dazu komme eine zunehmende Verschlechterung der Nierenfunktion. Das pathophysiologische Geschehen werde durch hämodynamische, metabolische und inflammatorische Mechanismen getriggert. Die Therapie müsse daher sowohl die Niere als auch das Herz im Auge haben, also kardiorenal protektiv wirken. Da sei Finerenon eine neue vielversprechende Option.
Finerenon ist ein selektiver nicht-steroidaler Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonist (MRA), für den in ersten Studien eine günstige Wirkung auf das kardiorenale Outcome nachgewiesen werden konnte. In der FIGARO-DKD-Studie wurden 7.437 Patienten mit einer diabetischen Nephropathie randomisiert, placebokontrolliert mit Finerenon behandelt. Die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR) lag bei diesen Patienten zwischen 30 und 300 bei einer GFR zwischen 25 und 90 ml/min oder > 60 /min, wenn die UACR > 300 betrug. Als primärer Endpunkt wurde die Kombination aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall oder stationärer Einweisung wegen Herzinsuffizienz definiert. Mit Finerenon konnte nach einem medianen Follow up von 3,4 Jahren eine signifikante Risikoreduktion von 13% erreicht werden. In der Finerenon-Gruppe hatten 12,4% ein primäres Endpunktereignis, in der Placebo-Gruppe waren es 14,2%. Diese Überlegenheit war vor allem der niedrigeren Rate an Krankenhauseinweisungen geschuldet. Diese wurde um 29% gesenkt.
Sekundärer Studienendpunkt war die Verschlechterung der Nierenfunktion, nämlich der GFR um 40%. Diesen renalen Endpunkt erreichten 9,5% in der Finerenon-Gruppe und 10,8% in der Placebo-Gruppe. Die Gesamtrate an Nebenwirkungen war nicht unterschiedlich. Doch unter Finerenon musste die Medikation häufiger wegen einer Hyperkaliämie unterbrochen werden (1,2% vs, 0,4%).
PS
Luftverschmutzung: Ein Risikofaktor für den akuten Herztod
Dass die Luftverschmutzung auch aus kardialer Sicht gesundheitsschädlich ist, steht ausser Zweifel. Jetzt konnte in einer italienischen Studie gezeigt werden, dass eine enge Korrelation zwischen der Konzentration an Schadstoffen und dem Risiko für den akuten Herztod besteht. An Tagen mit hoher Belastung war das Risiko für einen akuten Herztod in Städten höher als in Zeiten geringer Luftverschmutzung. «Diese Korrelation zeigte sich bei allen Schadstoffen», so Prof. Francesca R. Gentile, Pavia.
PS
Drohnen bei der Reanimation
Biei der Reanimation bedeutet Zeit Überleben. Mit Hilfe von Drohnen lässt sich die Reanimation beim plötzlichen Herztod optimieren. Dies zeigen erste Erfahrungen in Schweden bei 14 Patienten. Bei Einsatz einer Drohne konnte der automatische externe Defibrillator den Patienten schneller erreichen als mit dem Rettungswagen «Der Zeitgewinn betrug zwei Minuten», so Dr. Sofia Schierbeck, Stockholm. Die Drohne erreichte den Patienten in 64% der Fälle früher. Doch die Drohne konnte nur bei günstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Man darf annehmen, dass diese Technologie auch in anderen kritischen Situationen wie Hypoglykämie oder anaphylaktischer Schock Anwendung finden könnte.
PS
Opioide und akuter Herztod
Eine Überdosis an Opioiden ist immer häufiger die Ursache des akuten Herztods. Sie ist mittlerweile ebenso häufig wie andere Ursachen wie die KHK. Nach einer aktuellen Erhebung in den USA sind 3,1% der Fälle mit einem akuten Herztod auf eine Opioid-Einnahme zurückzuführen. «Man muss aber berücksichtigen, dass bei Opioid-Patienten auch häufiger Komorbiditäten wie Alkoholmissbrauch, Rauchen und Depression vorliegen», so Dr. Senada S. Malik, Biddeford.
PS
Hämodynamisches Management verhindert Hospitalisierung
Ein hämodynamisch gesteuertes Management auch von Patienten in einem frühen Stadium der Herzinsuffizienz kann eine stationäre Behandlung verhindern. So die Ergebnisse der GUIDE-HF-Studie. Dabei wurde 1 000 Patienten in einem randomisierten Design interventionell ein kabelloser Sensor in die Pulmonalarterie implantiert, mit dem Ziel den Pulmonalarteriendruck kontinuierlich zu überwachen. Die Patienten befanden sich in NYHA II-IV und waren in den vorangegangenen 12 Monaten wegen Herzinsuffizienz hospitalisiert worden oder bei ihnen waren innerhalb von 30 Tagen vor der Intervention erhöhte BNP-Spiegel bestimmt worden. Als primärer Endpunkt wurde die Kombination aus Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz oder einer notfallmässigen Vorstellung oder Tod festgelegt. Durch das hämodynamische Monitoring wurde die Hospitalisierungsrate um 17% gesenkt. Wurden nur die Patienten vor der Corona-Pandemie ausgewertet, waren es sogar 28%. Doch die Mortalität wurde nicht beeinflusst. «Die Daten zeigen, dass ein hämodynamisches Monitoring auch bei Patienten mit NYHA II und bei Symptomen und erhöhten BNP-Werten aber ohne vorangegangene Hospitalisation sinnvoll ist», so Prof. JoAnn Lindenfeld, Nashville.
PS
Grüne Umgebung wirkt kardioprotektiv
Nicht nur Veränderungen des Lebensstils und Medikamente wirken präventiv, sondern auch die Umgebung, in der man lebt. Dies konnte jetzt in einer Beobachtungsstudie mit fast 250 000 Probanden gezeigt werden. «Personen, die in einer grünen Umgebung leben, erleiden seltener einen Herzinfarkt oder Schlaganfall», so Dr. William Aitken, Miami. Die Risikoreduktion betrug 16%. Auch das Risiko für Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz und Hypertonie war niedriger. Zugleich konnte gezeigt werden, dass auch eine neue Begrünung vorteilhaft ist. Wo eine Bepflanzung durchgeführt wurde, waren die Krankheits-Inzidenzen rückläufig. Das Pflanzen von Bäumen sollte deshalb zu einem Präventionsprojekt erhoben werden.
PS
Adhärenz verlängert das Leben
Die Sekundärprävention nach einem kardiovaskulären Ereignis umfasst Lifestyle-Änderungen und Medikamente. «Eine konsequente Umsetzung dieser Empfehlungen führt zu sieben weiteren Jahren ohne ein erneutes kardiales Ereignis»,
so Dr. Tinka Van Trier, Amsterdam. Dies ist das Ergebnis einer Registerstudie. Doch im Alltag klafft eine grosse Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Nach einem Jahr hatten nur 30% mit dem Rauchen aufgehört, 79% waren weiterhin übergewichtig, 45% waren weiterhin nicht regelmässig sportlich aktiv und nur 2% erreichten die Zielwerte für Blutdruck, Blutzucker und LDL-Cholesterin. 40% hatten weiterhin erhöhte Blutdruckwerte und 65% erhöhte LDL-C-Werte. 87% nahmen Antithrombotika, 85% Lipidsenker und 86% Antihypertensiva.
PS
Edoxaban bei Vorhofflimmern-Patienten mit TAVI
20 bis 40% der TAVI-Patienten leiden zusätzlich an Vorhofflimmern. Bei einem Teil der Patienten besteht das Vorhofflimmern bereits vor der Klappenintervention, bei anderen tritt es erst im Rahmen des Eingriffs erstmals auf. Bisher wird bei Patienten mit Vorhofflimmern, die eine TAVI erhalten, eine dauerhafte OAK mit einem VKA durchgeführt. Im Rahmen der ENVISAGE-TAVI AF-Studie wurde jetzt das NOAK Edoxaban mit dem VKA hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit verglichen, wobei mit der Antikoagulation zwischen 12 Stunden und 5 Tagen nach dem erfolgreich durchgeführten Eingriff begonnen wurde. Eingeschlossen in diese randomisierte Studie wurden 1,426 TAVI-Patienten mit Vorhofflimmern. Primärer Endpunkt war die Kombination aller unerwünschten klinischen Ereignisse: Gesamtmortalität, Myokardinfarkt, Schlaganfall, systemische Thromboembolie, Klappenthrombose und grössere Blutungsereignisse nach der ISTH-Definition. Der primäre Sicherheitsendpunkt war die Inzidenz an schweren Blutungen. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 82 Jahren, der Anteil der Frauen betrug 47,5%. Die häufigsten Komorbiditäten waren Herzinsuffizienz (87%) und KHK (42%). 17% der
Patienten hatten bereits einen Schlaganfall oder eine TIA überstanden. Das mediane Follow up lag bei 18 Monaten.
«Die Auswertung ergab keine Unterlegenheit von Edoxaban», so Prof. George Dangas, New York. Die Rate des primären Endpunkts betrug in der Edoxaban-Gruppe 17,5%, in der VKA-Gruppe 16,5% (HR 1,05; 95% KI 0,85-1,31; p = 0,01 für Nicht-Unterlegenheit). Was die Sicherheit betrifft, lag die Rate an schweren Blutungen bei Edoxaban höher als bei dem VKA, wobei der Unterschied vor allem bei den gastrointestinalen Blutungen bestand. Unter Edoxaban trat bei 9,7% eine stärkere Blutung auf vs. 7,0% unter dem VKA (HR 1,40; 95% KI 1,03-1,91). Eine sekundäre Analyse ergab, dass bei Patienten, die eine niedrigere Edoxaban-Dosis benötigten oder die zusätzlich keine Plättchenhemmer einnahmen, kein Unterschied bei der Blutungsrate bestand. «Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Reduktion der Dosis streng zu beachten und eine Kombination von Edoxaban mit Plättchenhemmern zu vermeiden», so Dangas.
PS
EMPEROR-Preserved-Studie: Empagliflozin wirkt auch bei HFpEF
Nachdem der SGLT2-Inhibitor Empagliflozin in der EMPEROR-Reduced-Studie bei Patienten mit einer systolischen Herzinsuffizienz seine günstige Wirkung unter Beweis stellen konnte, wurde die Wirksamkeit dieser Substanz jetzt auch bei herzinsuffizienten Patienten mit erhaltener Pumpfunktion (HFpEF; EF > 40%) im Rahmen einer Studie (EMPEROR-Preserved-Studie) untersucht.
Eingeschlossen wurden 9.718 Patienten. «Die Ergebnisse zeigen, dass mit Empagliflozin bei Patienten mit HFpEF ein
vergleichbarer Benefit erzielt werden kann wie bei Patienten mit HFrEF», so Prof. Milton Packer, Dallas. Das Risiko für ein tödliches kardiales Ereignis oder eine Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz wurde auch bei den Patienten mit HFpEF durch Empagliflozin um ca. 30% gesenkt. Der günstige Effekt war bei allen Patienten bis zu einer EF von < 65% nachweisbar. Die Wirksamkeit nahm bei Patienten mit einer EF > 65% ab. Bei Patienten mit einer EF von 40-60% war der Benefit des SGLT2-Inhibitors ausgeprägter als unter dem ARNI in der PARAGON-HF-Studie. Im Unterschied zur EMPEROR-Reduced-Studie wurden bei HFpEF die renalen Endpunkte nicht positiv beeinflusst, was daran liegen könnte, dass die renalen Endpunkte stringenter definiert wurden.
PS
Erweiterte Katheterablation bei Vorhofflimmern
Der Frage, ob durch eine zusätzlich zur Pulmonalvenenisolation durchgeführte Ablation von mittels MRT detektierten fibrotischen Arealen im Vorhof das Rezidivrisiko gesenkt werden kann, wurde in der DECAAF-Studie nachgegangen. Eingeschlossen wurden 843 Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern. Insgesamt wurde die Rezidivrate durch die erweiterte Ablationsstrategie nicht gesenkt (Rezidivrate nach einem Jahr 46,1% in der Kontrollgruppe vs. 43% in der Interventionsgruppe). «Doch Patienten mit einer geringen Fibrosierung im Stadium 1 oder 2, d.h. einem Fibroseanteil von weniger als zwanzig Prozent, profitierten von der erweiterten Ablationsstrategie», so Prof. Nassir Marrouche, New Orleans. Die Rezidivrate nach einem Jahr wurde bei diesen Patienten um 16% reduziert. Bei einer Fibrosierung von > 20% brachte die zusätzliche Ablation im Vorhof keinen Nutzen.
PS
sGC-Stimulator: Ein neuer Therapieansatz bei Herzinsuffizienz
Die Therapie der chronischen Herzinsuffizienz hat in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte erfahren. Trotzdem ist dieses Krankheitsbild weiterhin mit einer sehr schlechten Prognose assoziiert, die durchaus vergleichbar ist mit der einer malignen Erkrankung. Die 5-Jahres-Mortalität liegt bei 75% und dies gilt für alle Formen der Herzinsuffizienz. So verliert ein 65-jähriger Patient mit einer Herzinsuffizienz ca. 15 Jahre an Lebenszeit.
Der Verlauf der Erkrankung ist charakterisiert durch rezidivierende Dekompensationen. Jede dieser Dekompensationen bedeutet nicht nur eine passagere Verschlechterung des klinischen Bildes, sondern führt zu einer weiteren Verschlechterung der Pumpfunktion und auch der Prognose. Nach der Dekompensation ist immer vor der nächsten Dekompensation. Das Risiko während einer Hospitalisierung oder innerhalb von 3 Monaten nach einer Hospitalisierung zu versterben ist bei
Patienten nach einer sich verschlechternden chronischen Herzinsuffizienz signifikant höher als bei einer neu aufgetretenen Herzinsuffizienz. Es ist deshalb wichtig, diese Abwärtsspirale aufzuhalten, mit anderen Worten, den Patienten zu stabilisieren.
Ein vollkommen neues Therapieprinzip ist die Stimulation des NO-sGC-cGMP-Signalwegs mit Vericiguat (Verquvo®). «Auf diese Weise wird die cGMP-Produktion auch unter Bedingungen mit niedrigen NO-Spiegeln, wie es bei der Herzinsuffizienz der Fall ist, erhöht», so Prof. Burkert Pieske, Berlin. Dies führt zu einer Verbesserung der myokardialen Funktion, zu einer Hemmung des Remodeling, zu einer Verbesserung der vaskulären Funktion, zu einer Abnahme der Fibrosierung und der Inflammation.
Dass diese Substanz bei Risikopatienten nach einer Dekompensation die Abwärtsspirale stoppen kann, dies belegen die Ergebnisse der VICTORIA-Studie. Eingeschlossen in diese randomisierte, placebokontrollierte Studie wurden Patienten mit einer symptomatischen chronischen Herzinsuffizienz NYHA-Klasse II-IV, die kürzlich dekompensiert waren und einer stationären Behandlung und Diuretika i.v. bedurften. Sie mussten zum Zeitpunkt des Studienbeginns klinisch stabil sein. Vericiguat reduzierte das Risiko für eine HF-bedingte Hospitalisierung oder CV-Tod um 4,2 Ereignisse pro 100 Patientenjahre. Die jährliche NNT betrug somit 24. Beim Gesamtüberleben ergab sich kein Unterschied. Die Substanz wurde gut vertragen, die Zieldosis von 10 mg erreichten 89,2%.
PS
Vorhofflimmern-Screening lohnt sich
Das Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung. Die Inzidenz steigt mit dem Alter. Angesichts der demographischen Entwicklung dürfte die Zahl der Betroffenen in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die gefürchtetste Komplikation ist der kardioembolische Insult. Jeder vierte Insult geht auf das Vorhofflimmern zurück. Durch eine effektive Antikoagulation können zwei Drittel dieser fatalen Ereignisse verhindert werden. Dabei sollte, soweit keine Kontraindikation vorliegt, vorzugsweise ein NOAK wie Apixaban eingesetzt werden, da diese Substanzen das Management vereinfachen und sicherer machen.
Doch nicht selten geht das Vorhofflimmern ohne Symptome einher, so dass es nicht erkannt und keine OAK eingeleitet wird. Es wird dann nur zufällig entdeckt. Gelegentlich führt auch erst der ischämische Insult zur Detektion des Vorhofflimmerns. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für ein Screening. Die Leitlinie empfiehlt bisher nur ein opportunistisches Vorgehen, d.h. bei über 65-Jährigen sollte bei jedem Arztbesuch der Puls getastet werden und ab dem 75. Lebensjahr sollte zumindest jährlich ein EKG abgeleitet werden, um das Vorhofflimmern nicht zu übersehen und die betroffenen Patienten mittels OAK vor dem Insult zu schützen.
«In den letzten Jahren hat dank moderner digitaler Technologien das systematische Screening zunehmende Bedeutung erfahren», so Dr. Emma Svennberg, Stockholm. Im Rahmen der schwedischen STROKESTOP-Studie wurde die Effektivität eines Massenscreenings bei 75- bis 76-jährigen Personen untersucht und zwar mit Hilfe eines EKG-Handgerätes. Die Teilnehmer, insgesamt ca. 30 000, wurden randomisiert angehalten, über einen Zeitraum von zwei Wochen zweimal täglich ein EKG abzuleiten. Primärer Endpunkt der Studie war die Kombination aus ischämischem Insult, systemischer Embolie, Gesamtmortalität, zerebraler Blutung und Hospitalisierung wegen einer Blutung bei einem Follow-up von 5 Jahren. Mittels dieses Screenings konnte die Rate an Vorhofflimmern-Detektionen in der Interventionsgruppe von 12 auf 14% gesteigert werden. In der Interventionsgruppe traten 4,456 Ereignisse des primären Endpunkts auf, in der Kontrollgruppe waren es 4 616 Ereignisse. «Diese Daten belegen, dass ein Populations-basiertes Vorhofflimmern-Screening bei älteren Personen einen klinischen Benefit bringt», so Svennberg.
PS
Krebs-assoziierte venöse Thromboembolie:
Apixaban ist LMWH nicht unterlegen
Thromboembolische Ereignisse (VTE) sind eine häufige und zugleich gefürchtete Komplikation bei Tumorpatienten. Betroffen sind ca. 20% aller Patienten mit einem Malignom. Besonders häufig ist ein solches Ereignis bei Pankreas-, Gehirn-, Ovarial- und Magen-Darm-Malignomen. Nicht selten manifestiert sich das Malignom sogar primär als VTE. «Das VTE-Risiko wird aber nicht nur von der Lokalisation des Primärtumors sondern auch von Patientencharakteristika und der Art der Therapie bestimmt», so Prof. Stavros Konstantinides, Mainz. Wichtige Risikofaktoren sind ein höheres Alter, eine vorausgegangene VTE, eine Thrombozytose, das Vorliegen einer hereditären Thrombophilie wie ein Faktor V-Leiden und pulmonale, renale und kardiale Komorbiditäten.
Charakteristisch für die Krebs-assoziierte VTE sind das hohe Rezidiv- und Blutungsrisiko, was bei dem therapeutischen Management bedacht werden muss. So beträgt die Rezidivrate nach einem Jahr bei Nicht-Tumor-Patienten 6,8% im Vergleich zu 20,7% bei Tumorpatienten. Die Häufigkeit von schweren Blutungen steigt von 4,9% bei Nicht-Tumor-Patienten auf 12,4% bei Malignompatienten.
Die bisherige Standardtherapie ist ein niedermolekulares Heparin (LMWH) über 12 Monate. Doch diese Behandlung ist wegen der Notwendigkeit der Injektion bei Patienten sehr unbeliebt, was sich auf die Adhärenz negativ auswirkt. Nach 12 Monaten wird das LMWH nur noch von 21% der Patienten gespritzt. Da bieten NOAKs wie Apixaban wesentliche Vorteile. Die ESC-Guidelines empfehlen daher vorrangig die Gabe eines NOAK, soweit keine Kontraindikationen wie eine schwere Niereninsuffizienz vorliegen. Mit Apixaban kann im Unterschied zu Edoxaban und Dabigatran sofort ohne Vorschaltung eines LMWH, also ohne Switchen, die Therapie begonnen werden, wobei die Dosis nach 7 Tagen von 2 x 10 mg auf 2 x 5 mg reduziert wird.
Die Wirksamkeit und Sicherheit von Apixaban wurde im Rahmen der prospektiven und randomisierten CARAVAGGIO-Studie bei 1.170 Patienten mit einer Krebs-assoziierten VTE untersucht und zwar im Vergleich mit dem LMWH Dalteparin. Nach 12 Monaten konnte die Rezidivrate mit Apixaban um 37% gesenkt werden bei einer vergleichbaren Zahl an schweren Blutungen [1]. Vorausgegangene Studien mit Rivaroxaban (SELECT-D-Studie) und Edoxaban (Hokusai VTE Cancer-Studie) hatten zwar im Hinblick auf die bessere Effektivität vergleichbare Ergebnisse gezeigt, allerdings bei einem erhöhten Blutungsrisiko.
PS
Kurz und knapp
Kongresssplitter
- Depressive Raucher, die nach einem Infarkt mit dem Rauchen aufhören, profitieren auch stimmungsmässig davon.
- Hoch-verarbeitete Lebensmittel sind ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse.
- Der Genuss von bis zu drei Tassen Kaffe pro Tag reduziert das Risiko für Schlaganfall und fatale kardiale Ereignisse.
NOAK auch bei kardiologischen Interventionen
Die Einführung der NOAKs hat die Antikoagulation bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern einfacher und vor allem sicherer gemacht. In den Zulassungsstudien erwiesen sich diese Substanzen einem VKA überlegen, d.h. die Rate an schweren vor allem intrakraniellen Blutungen lag um ca. 50% niedriger und dies bei einer zumindest gleichen Effektivität. Doch wie sieht es mit der Sicherheit und Wirksamkeit aus, wenn eine Intervention wie Kardioversion oder Katheterablation oder eine PCI durchgeführt wird.
Bei der Kardioversion ist eine effektive orale Antikoagulation unverzichtbar, um peri-prozedurale Schlaganfälle zu verhindern. Für Apixaban (Eliquis®) liegen Daten aus zwei Studien vor, die zeigen, dass diese Substanz in solchen Situationen einen antithrombotischen Schutz ohne erhöhtes Blutungsrisiko verspricht. «Dies ist einmal die ARISTOTLE-Substudie, zum anderen die EMANATE-Studie, in der Apixaban mit Heparin/VKA verglichen wurden», so Prof. Renato D. Lopes, Duke. Bzgl. der Endpunkte Schlaganfall und starke Blutungen war Apixaban dem Heparin/VKA überlegen.
Nach der ESC-Leitlinie 2020 ist bei einer Kardioversion eine orale Antikoagulation über mindestens 3 Wochen vor der Intervention angezeigt. Bei Patienten mit Vorhofflimmern, das über 24 Stunden anhält, sollte die Antikoagulation nach der erfolgreichen Kardioversion zumindest über
4 Wochen fortgeführt werden, bevor mittels CHA2DS2-Vasc-Score die Indikation für eine dauerhafte OAK gestellt wird. Nur bei Patienten mit einem < 24 Stunden anhaltendem Vorhofflimmern und sehr geringen Schlaganfall-Risiko kann die OAK nach 4 Wochen beendet werden.
Für den Einsatz von Apixaban bei der Katheterablation liegen Daten aus der AXAFA-AFNET vor. Auch bei diesem Eingriff war Apixaban dem Regime Heparin/VKA nicht unterlegen. Den Endpunkt aus Gesamtmortalität, Schlaganfall oder starker Blutung erreichten unter Apixaban 6,9% vs. 7,3% unter VKA. Auch hier gilt, dass vor dem Eingriff eine OAK für 3 Wochen erforderlich ist und nach der erfolgreichen Ablation sollte die OAK zumindest über 2 Monate fortgeführt werden, bei hohem Risiko aber dauerhaft.
Die KHK ist eine häufige Komorbidität bei Vorhofflimmern. Doch eine Triple-Therapie ist mit einem deutlich erhöhten Blutungsrisiko assoziiert. Im Rahmen der AUGUSTUS-Studie wurde zwei Fragen nachgegangen, nämlich ob auch in solchen Situationen das NOAK Apixaban sicherer ist als ein VKA und ob eine zusätzliche duale Plättchenhemmung mit ASS plus einem P2Y12-Inhibitor notwendig ist oder ob auf ASS verzichtet werden kann. Die Auswertung ergab eine signifikante Überlegenheit von Apixaban im Vergleich zu VKA und die duale Therapie war im Vergleich zur Triple-Therapie signifikant sicherer im Hinblick auf schwere Blutungsereignisse ohne Anstieg des Ischämierisikos.
PS
NOAK bei Vorhofflimmern:
Practical Guide hilft bei der Entscheidungsfindung
Die European Heart Rhythm Association (EHRA) hat einen aktualisierten Practical Guide für den Einsatz der NOAKs bei Patienten mit Vorhofflimmern herausgegeben, der kürzlich auf dem europäischen Kardiologenkongress vorgestellt wurde. «Obwohl die NOAKs grundsätzlich als erste Wahl empfohlen werden, gibt es Einschränkungen durch Kontraindikationen», so Prof. Hein Heidbuchel, Antwerpen. Kontraindiziert ist ein NOAK bei mechanischen Herzklappenprothesen, bei einer moderaten und schweren rheumatischen Mitralstenose und bei einer schweren chronischen Niereninsuffizienz mit einer GFR < 15 ml/min. Auch Begleitmedikationen können ein Hinderungsgrund sein. Vorsicht geboten ist auch bei einer ausgeprägten Gebrechlichkeit, bei massivem Über- oder Untergewicht, bei einer Thrombozytopenie, bei einer schweren Leberfunktionsstörung und nach einer grösseren Blutung.
Wird nach der individuellen Risikostratifizierung mittels CHA2DS2-Vasc-Score die Indikation für eine dauerhafte orale Antikoagulation gestellt, so gilt es die für den einzelnen Patienten optimale Substanz in der richtigen Dosierung auszuwählen, wobei das pharmakologische Profil der Substanzen berücksichtigt sein sollte. Dabei spielt die Nierenfunktion eine grosse Rolle. Bis zu einer GFR von 30 ml/min sind Rivaroxaban, Edoxaban und Apixaban einsetzbar, wobei die Dosis ab einer GFR von 50 ml/min reduziert werden sollte, bei Rivaroxaban auf 15 mg einmal täglich, bei Edoxaban auf 30 mg täglich. Bei Apixaban wird die Dosisreduktion auf 2,5 mg zweimal täglich dann empfohlen, wenn eines der folgenden Kriterien vorliegt: Alter ≥ 80 Jahre, Körpergewicht ≤ 60 kg, Kreatinin ≥ 1,5 mg/dl. Für ältere Patienten mit einer Niereninsuffizienz ist nach Studienergebnissen Edoxaban eine gute und sichere Wahl.
Was das Körpergewicht betrifft, so sollte man bei einem BMI von ≤ 12,5 kg/m2 und ab 40 kg/m2 mit NOAKs sehr vorsichtig sein und evtl. Plasmaspiegel-Bestimmungen durchführen. Letzteres kann auch dann sinnvoll sein, wenn Interaktionen mit Begleitmedikamenten möglich sind. «Doch bei der grossen Mehrheit der Patienten sind Spiegelbestimmungen nicht notwendig», so Heidbuchel.
Die Indikation für eine zusätzliche Gabe eines Plättchenhemmers sollte sehr streng gestellt werden. Bei einer stabilen KHK besteht dann, wenn das akute Ereignis oder die Intervention länger als 1 Jahr zurückliegt, keine Indikation dafür. Bei PCI-
Patienten sollte die Triple-Therapie so kurz wie möglich erfolgen, in der Regel reichen 4 Wochen.
Was das perioperative Bridging betrifft, so ist ein solches bei einem NOAK nicht notwendig, Es reicht eine kurze Unterbrechung der Therapie, wobei der Beginn der Therapiepause und die Zeit bis zur Wiederaufnahme der NOAK-Therapie sich am Ischämie- und Blutungsrisiko und auch an der Nierenfunktion orientiert.
PS
Neue ESC-Leitlinie für Herzinsuffizienz
Trotz gewisser Fortschritte ist das Krankheitsbild der Herzinsuffizienz weiterhin mit einer sehr schlechten Prognose assoziiert, die durchaus vergleichbar ist mit der einer malignen Erkrankung. Die 5-Jahres-Mortalität liegt bei 75% und dies gilt für alle Formen der Herzinsuffizienz. So verliert ein 65-Jähriger Patient mit einer Herzinsuffizienz ca. 15 Jahre an Lebenszeit. Der Verlauf der Erkrankung ist charakterisiert durch rezidivierende Dekompensationen. Jede dieser Dekompensationen bedeutet nicht nur eine passagere Verschlechterung des klinischen Bildes, sondern führt zu einer weiteren Verschlechterung der Pumpfunktion und auch der Prognose. Nach der Dekompensation ist immer vor der nächsten Dekompensation. Das Risiko während einer Hospitalisierung oder innerhalb von 3 Monaten nach einer Hospitalisierung zu versterben, ist bei Patienten nach einer sich verschlechternden chronischen Herzinsuffizienz signifikant höher als bei einer neu aufgetretenen Herzinsuffizienz. Es ist deshalb wichtig, diese Abwärtsspirale aufzuhalten, mit anderen Worten, den Patienten zu stabilisieren.
«Die Therapie der chronischen Herzinsuffizienz hat in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte erfahren, Zu den bereits etablierten Substanzgruppen, nämlich RAS-Inhibitoren, Betablocker und MRA, die die Prognose verbessern, sind die SGLT2-Inhibitoren und der ARNI dazu gekommen» so Prof. Theresa McDonagh, London. Dabei stellt sich die Frage, welche Substanz wann gegeben werden sollte. In der neuen ESC-Leitlinie wird empfohlen die «Big four» (ARNI, SGLT2-Inhibitor, Betablocker und MRA) möglichst früh gemeinsam einzusetzen.
Wichtig für Herzinsuffizienz-Patienten sind auch die Schutzimpfungen gegen Influenza, Pneumokokken und COVID-19, da diese Infektionen den Krankheitsverlauf und die Prognose bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz verschlechtern.
PS