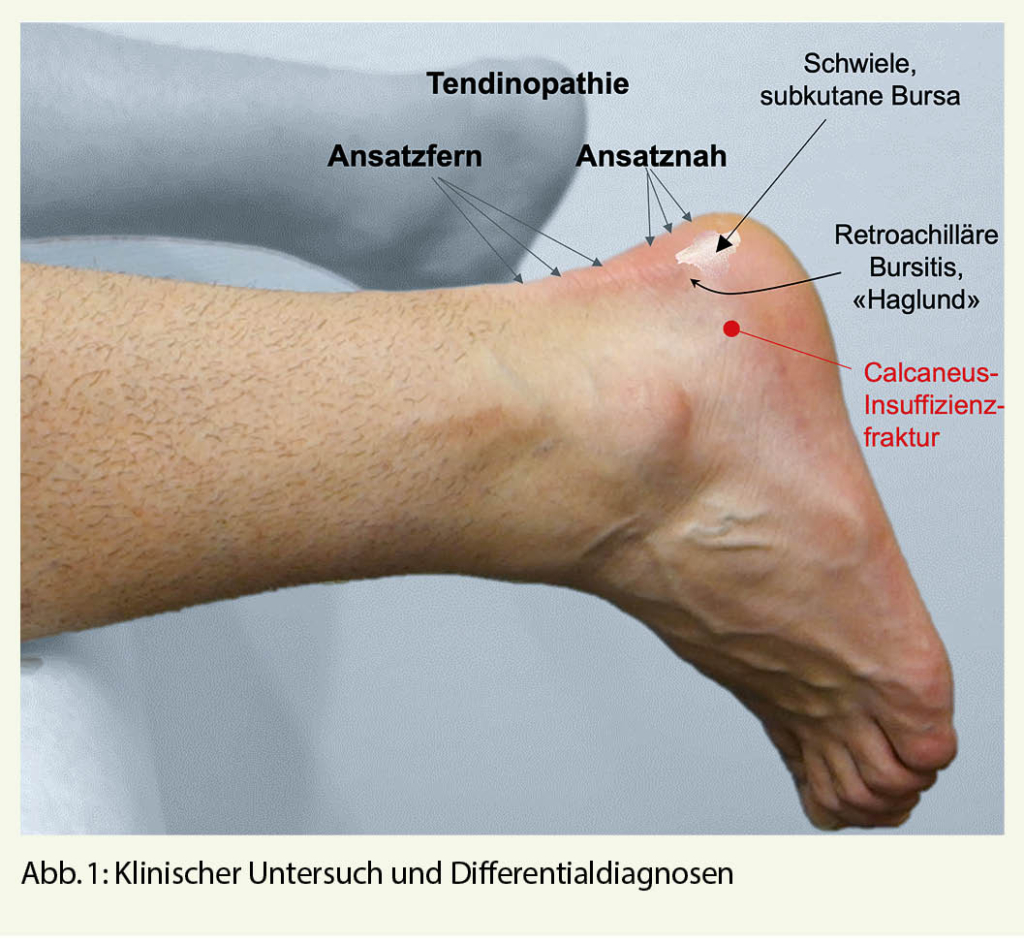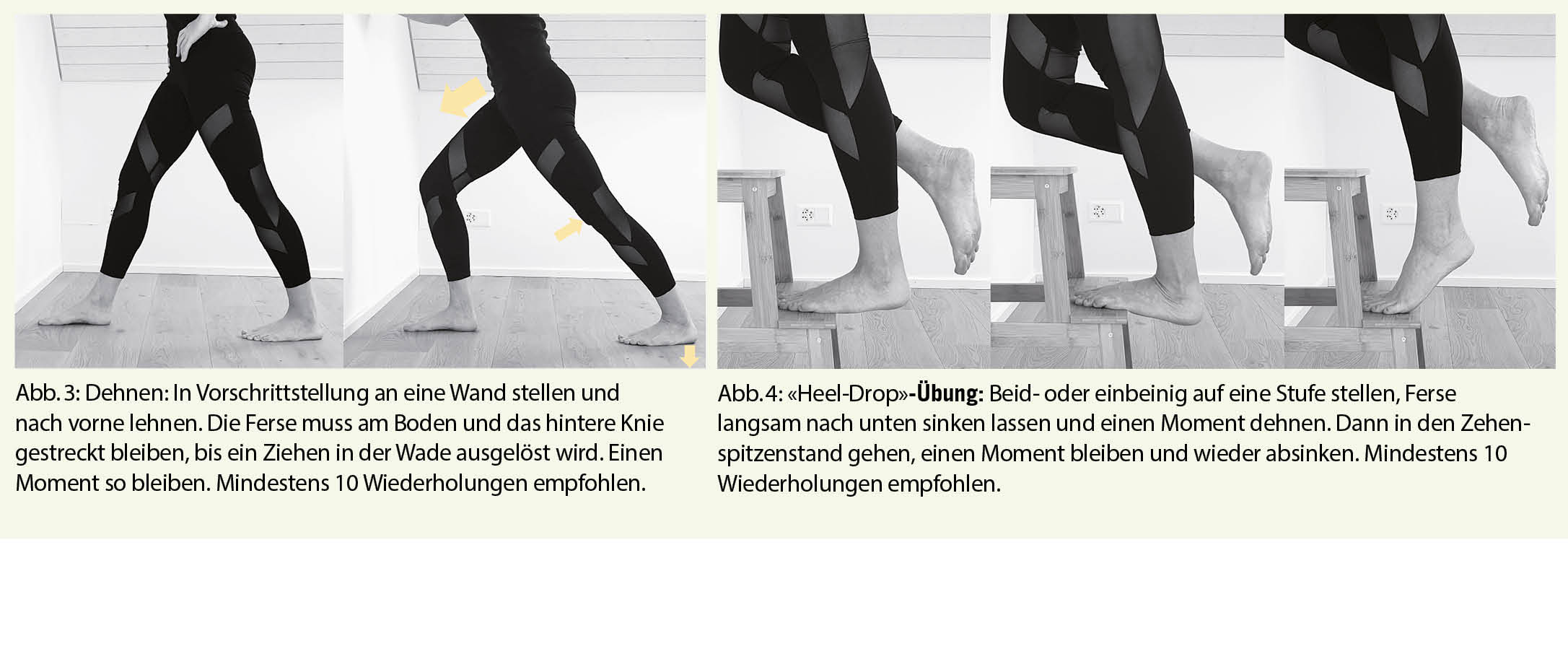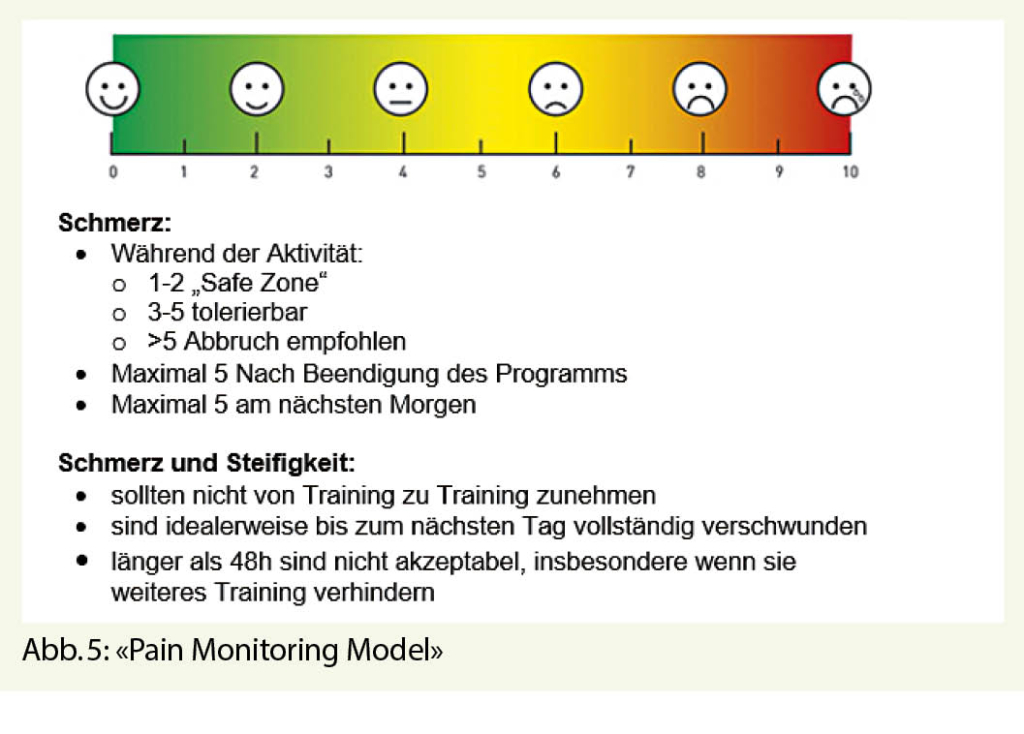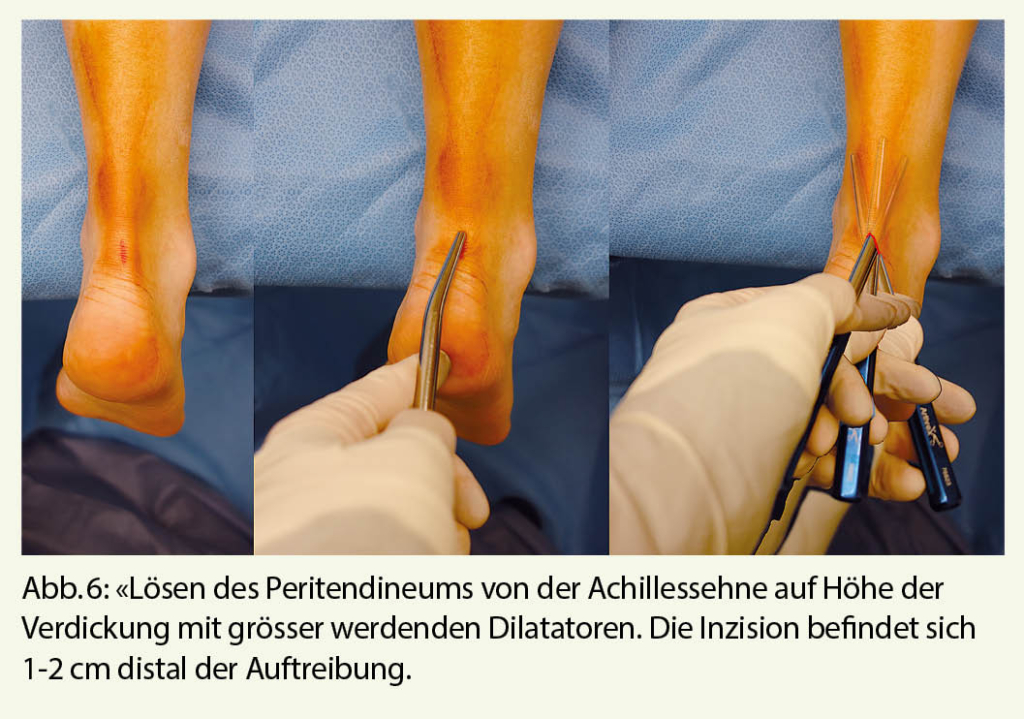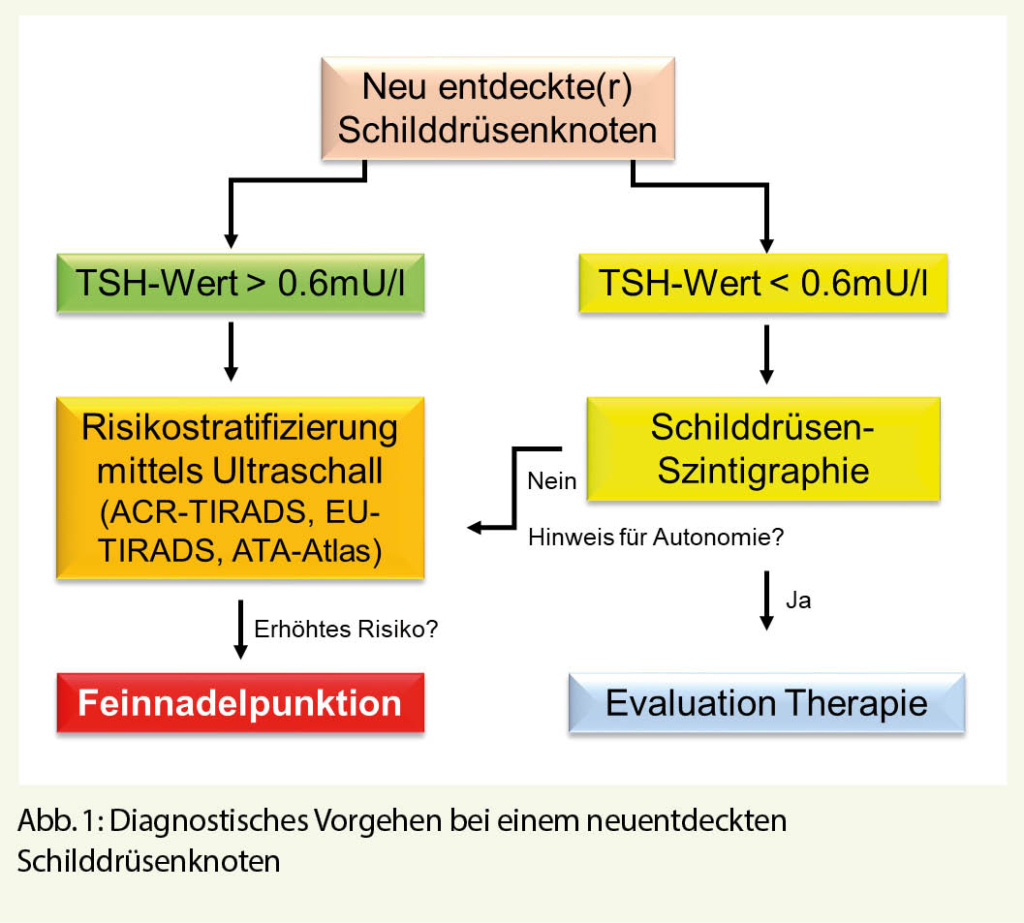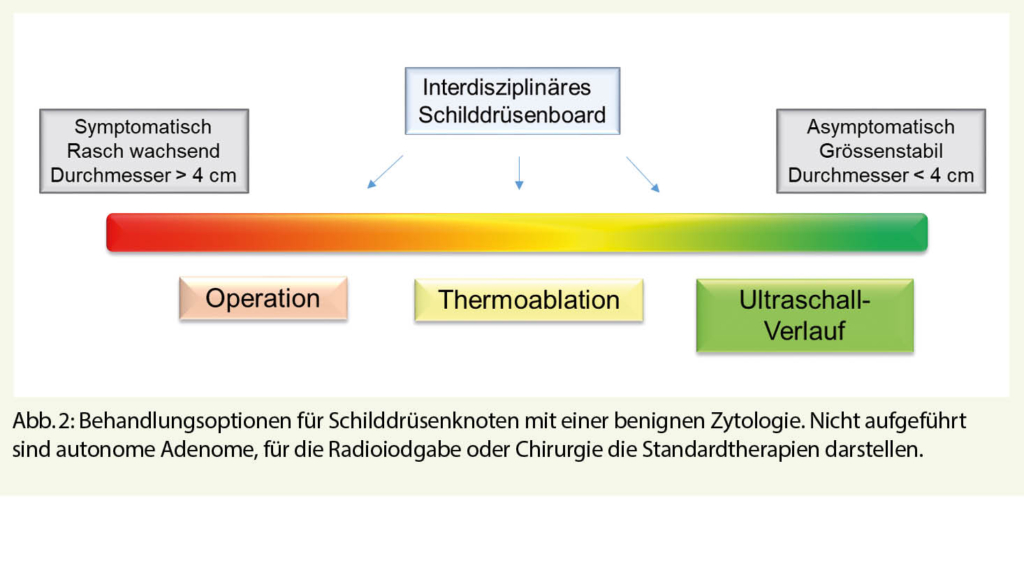Der nachfolgende Bericht beleuchtet ausgewählte Highlights vom wissenschaftlichen Meeting der American Diabetes Association, das vom 25.–29. Juni 2021 in virtueller Form statt-gefunden hat.
GRADE-Studie
Diese Studie untersuchte, ähnlich wie 1998 die UKPDS-Studie, die Wertigkeit der initialen Therapie bei Patienten, welche mit Metformin (1000-2000 mg täglich) vorbehandelt sind und ein HbA1c von 6.8 bis 8.5% aufweisen.
Untersucht wurden DPP-4-Hemmer (Sitagliptin), GLP-1-RA (Liraglutid), Sulfonylharnstoffe (Glimepirid) und Insulin Glargin. Leider wurden SGLT-2-Hemmer nicht berücksichtigt, weil sie erst einige Monate nach Studienbeginn auf dem amerikanischen Markt zugelassen wurden. Der primäre Endpunkt war ein HbA1c > 7.0%, bestätigt beim nächsten Quartalbesuch. Der sekundäre Endpunkt war ein HbA1c > 7.5%, nachdem in den 3 Nicht-Glargin-Gruppen Insulin Glargin begonnen wurde. Es wurden 5047 Patienten eingeschlossen.
Die Resultate legen nahe, dass das beste HbA1c nach 6 Monaten mit Glimepirid und Liraglutid und nach 48 Monaten die besten Resultate mit Glargin und Liraglutid erreicht wurden.
Schwere Hypoglykämien waren in der Glimepirid-Gruppe 2-3 x höher als unter Liraglutid und 70% häufiger als unter Glargin allein.
Die besten, aber nicht signifikanten Ergebnisse für 3-Punkte MACE, Mortalität und Herzinsuffizienz ergaben sich für Liraglutid.
Diabetes und Herzinsuffizienz
5 Jahre nach Diabetesdiagnose hatten 2/3 aller Patienten mit Typ-2-Diabetes Evidenz einer linksventrikulären Dysfunktion auch ohne Ischämie. Diese 68% teilen sich in folgende Subkategorien auf: 27% nur systolische Funktionsstörung, 16% nur diastolische Dysfunktion und 25% kombinierte systolische und diastolische Funktionsstörung.
Aus diesem Grunde ist die nachfolgende Pressemitteilung sehr wesentlich:
«Bei einer Verlaufsbeobachtung von 1.9 Millionen Patienten mit Typ-2-Diabetes war die häufigste Erstmanifestation einer kardiovaskulären Erkrankung die PAVK mit 16%, die zweithäufigste Form mit 14% die Herzinsuffizienz, gefolgt von 12% nicht-tödlichem Herzinfarkt und 10% zerebrovaskulären Ereignissen und 4% kardiovaskulärem Tod.»
Emperor Preserved Trial
Kurz nach dem ADA-Kongress wurden in einer Pressemitteilung die Hauptresultate dieser Studie publiziert. Zum ersten Mal hat eine klinische Studie erfolgreich gezeigt, dass eine Therapie das Risiko von Hospitalisierungen und kardiovaskulären Todesfällen bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) senken kann. Empagliflozin wirkt auch bei erhaltener und nicht nur bei eingeschränkter Ejektionsfraktion. Es ist damit der erste SGLT2-Hemmer mit diesen Resultaten.
Amplitude Trial
AMPLITUDE ist eine kardiovaskuläre Endpunktstudie mit Efpeglenatid einem Exendin-4-basierten GLP-1-RA, welcher zur Verlängerung der Halbwertszeit mit einem IgG4 Fc-Fragment gekoppelt ist. Es wurden Dosen von 4 und 6 mg einmal wöchentlich s.c. an 4076 Patienten getestet. 90% der Patienten hatten bereits eine kardiovaskuläre Erkrankung und 32% hatten eine eGFR < 60 ml/min. Der mediane Follow-up betrug 1.8 Jahre. 3-Punkte MACE oder nicht-kardiovaskulärer Tod wurde signifikant um 27% gesenkt, ebenso der kombinierte Nierenendpunkt um 33%. Interessant war bei einer explorativen Studie in Bezug auf MACE, dass die Resultate mit 6 mg besser waren als mit 4 mg.
Dies ist die erste Studie, die bei einem nicht humanen GLP-1-RA einen solchen Effekt auf verschiedene Endpunkte gezeigt hat.
Makrovaskuläre Endpunkte und Amputationen beim LEADER-Trial (Subanalyse)
Bereits ab einem HbA1c von 5.5% steigt das Risiko für eine koronare Herzkrankheit und für einen Schlaganfall, und zwar um 50-55% pro 1% HbA1c-Erhöhung. Im Leader-Trial konnten Amputationen durch Liraglutid um 35% signifikant reduziert werden.
Therapie der Adipositas mit dem STEP-Programm
Die 4 Studien dieses Programms schlossen 4700 Patienten ein. Beim Step-2-Programm wurden Patienten mit Typ-2-Diabetes eingeschlossen und in den 3 übrigen nur solche mit Adipositas und Komorbiditäten.
Am 4. Juni 2021 hat die FDA den Gebrauch von 2.4 mg Semaglutid bei Adipositas oder Übergewicht und Komorbidiäten zugelassen.
Die Dosis wird langsam von 0.25 mg auf 0.5, 1.0, 1.7 und 2.4 mg innerhalb von 16 Wochen gesteigert. Die Gewichtsabnahme betrug 15-17% bei Personen ohne Diabetes und 10% bei Personen mit Diabetes über 1 Jahr bei einem Ausgangs-BMI von 36-38.
Der Step-4-Trial hat zudem untersucht, was passiert, wenn nach 20 Wochen die Therapie mit 2.4 mg Semaglutid gestoppt wird. Die Gewichtsabnahme bis zu diesem Zeitpunkt betrug 10.6%. Bei Absetzen betrug der Gewichtsverlust nach 1 Jahr noch 5.4% und bei der Gruppe, bei der das Semaglutid weiterhin gegeben wurde 17.7%.
Interessanterweise konnte das HbA1c im Vergleich zu 1.0 mg Semaglutid nicht weiter gesenkt werden. Bei einem Gewichtsverlust <10% betrug die HbA1c-Senkung 1.1% in beiden Gruppen und bei einem Gewichtsverlust > 10% wurde in beiden Gruppen eine HbA1c-Senkung von 2.2% erreicht.
In einer Subanalyse des STEP-1-Programms konnte gezeigt werden, dass unter 2.4 mg Semaglutid die totale Fettmasse um 7% abnahm und die Magermasse um 3.5% gesteigert wurde, während bei der Placebo-Gruppe die Fettmasse um 0.4% abnahm und die Magermasse um 0.3 % anstieg.
In der gleichen Studie wurde auch die glykämische Gruppe untersucht. Alle Patienten hatten zu Beginn der Studie keinen Diabetes. Bei der Semaglutid-Gruppe hatten 55% einen normalen Glukose-status und 45% einen Prädiabetes. Nach 68 Wochen hatten 84% einen normalen Glukosestatus und nur noch 16% einen Prädiabetes. Bei der Placebogruppe hatten zu Beginn 60% einen normalen Glukosestatus und 40% einen Prädiabetes. Nach 68 Wochen hatten 3% einen Diabetes und 48% einen Prädiabetes und nur noch 49% einen normalen Glukosestatus.
Diese Resultate deuten auf eine präventive Wirkung zur Verhinderung eines Diabetes durch Gewichtsverlust unter 2.4 mg Semaglutid hin.
Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
8091 Zurich
Roger.Lehmann@usz.ch
Der Autor deklariert Teilnahme an Advisory Boards und Referentenhonorare von Novo Nordisk, Sanofi, MSD, Boehringer Ingelheim, Servier und Astra Zeneca.