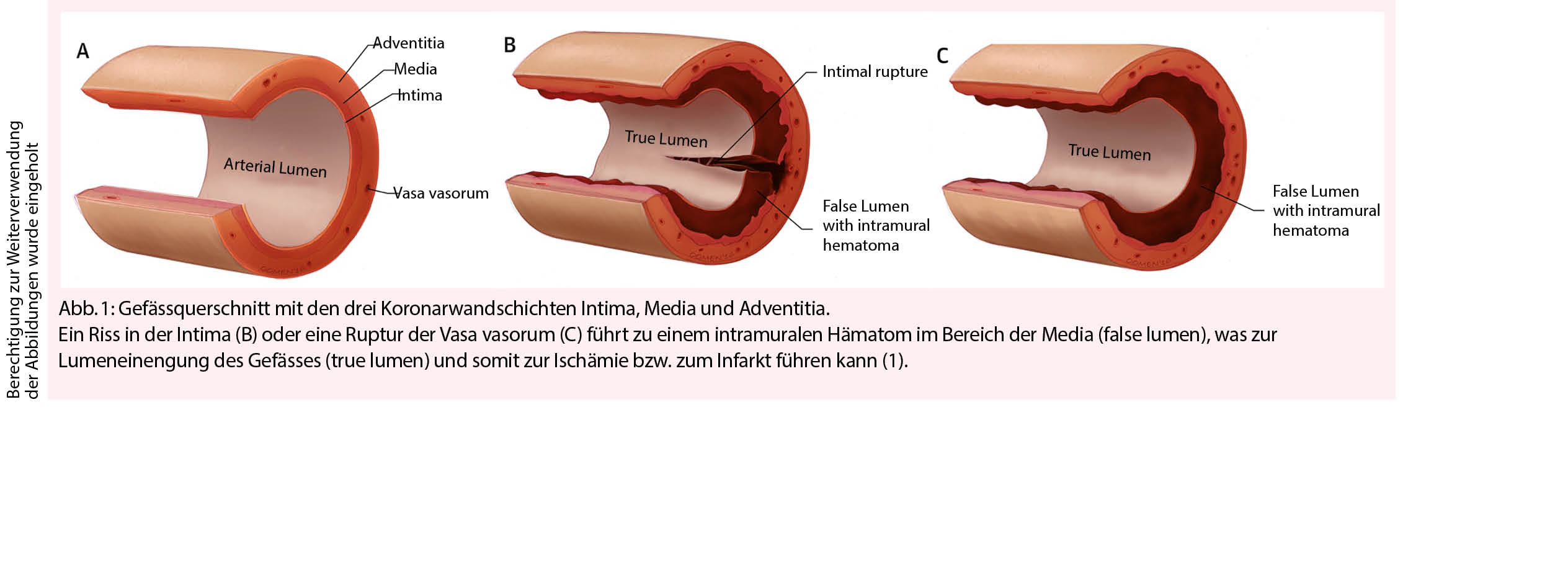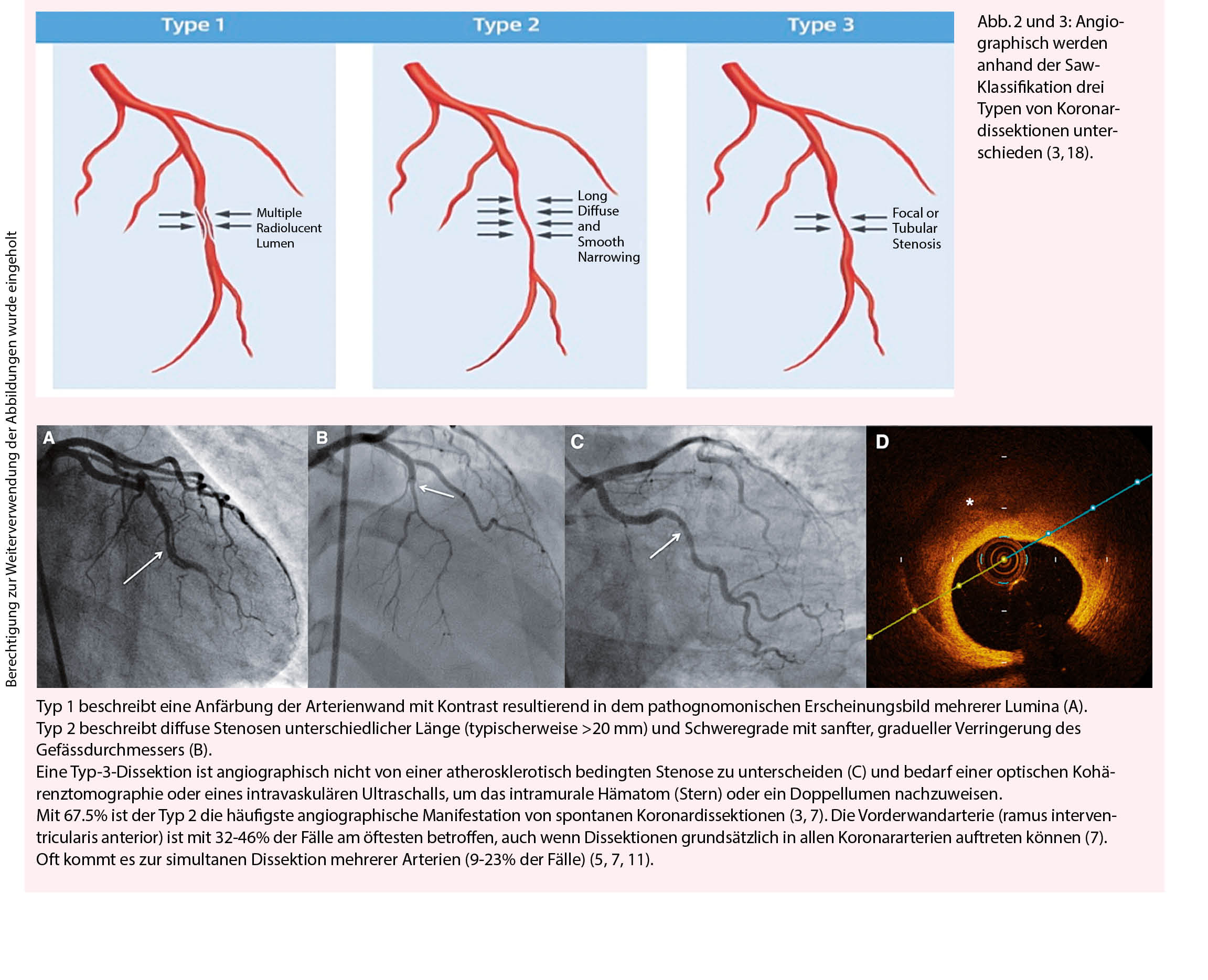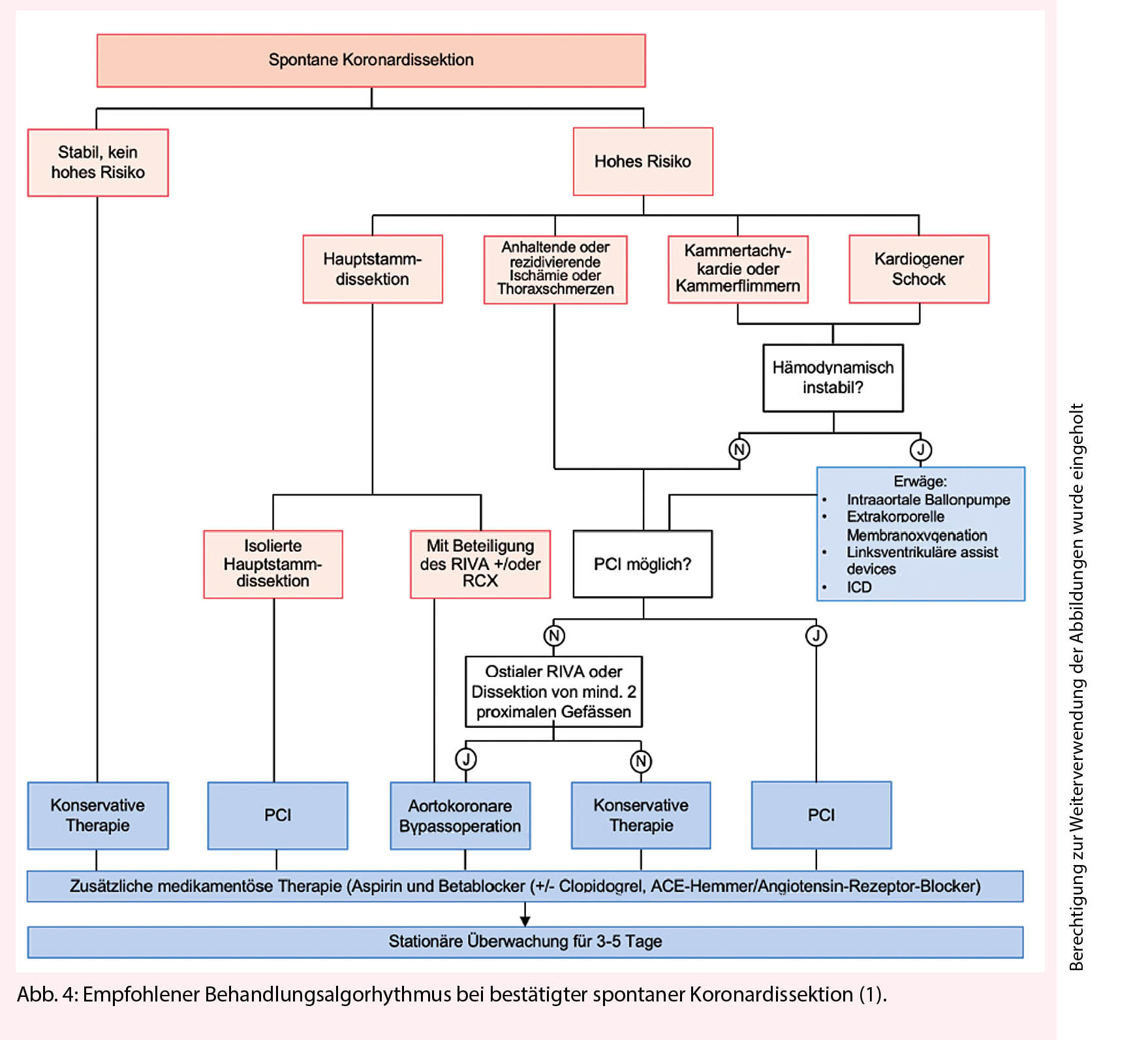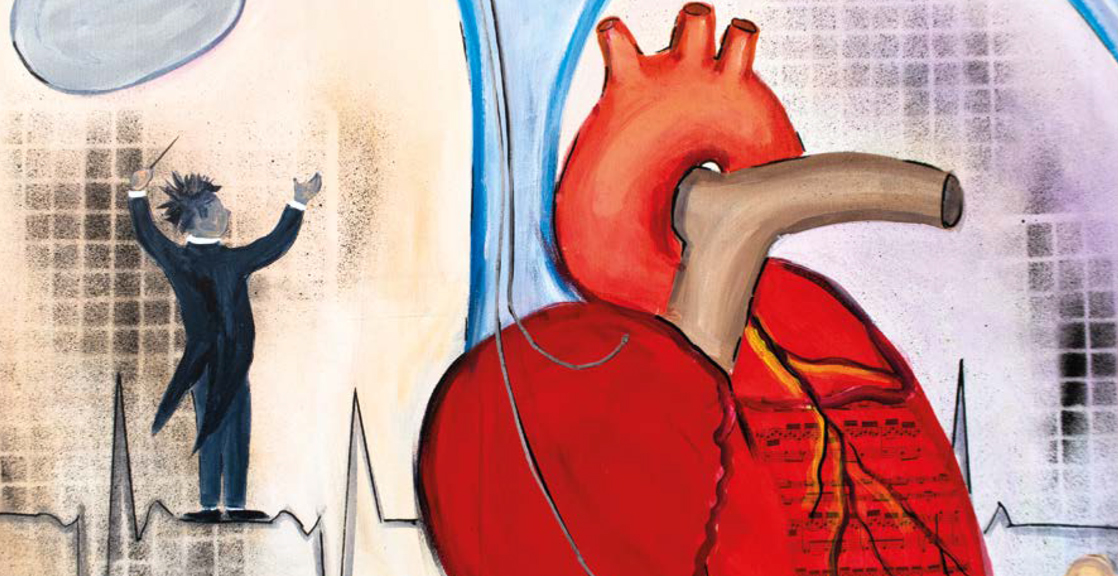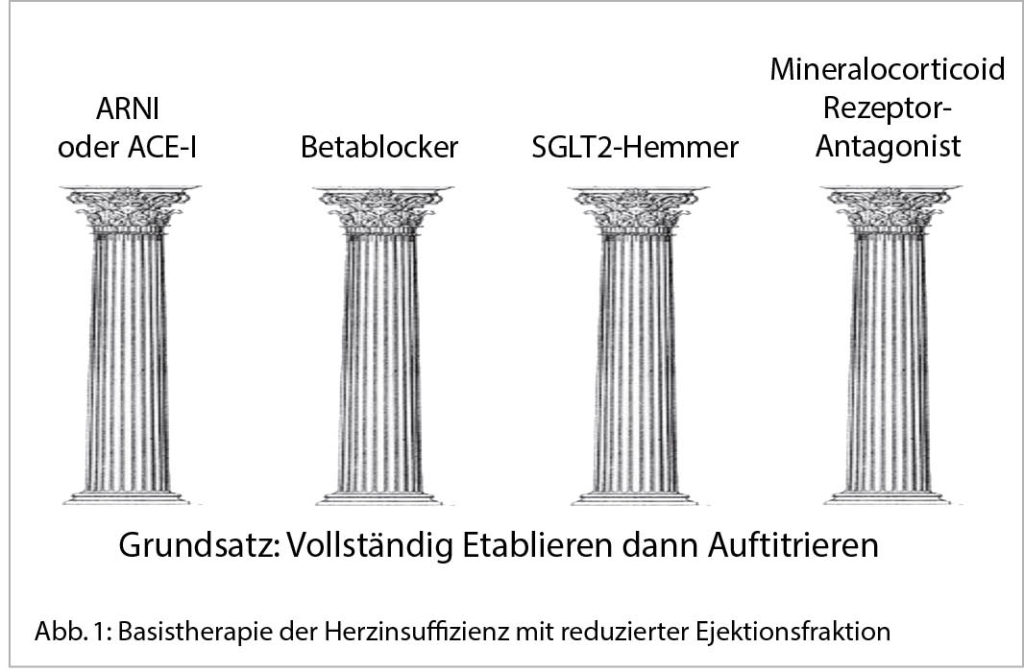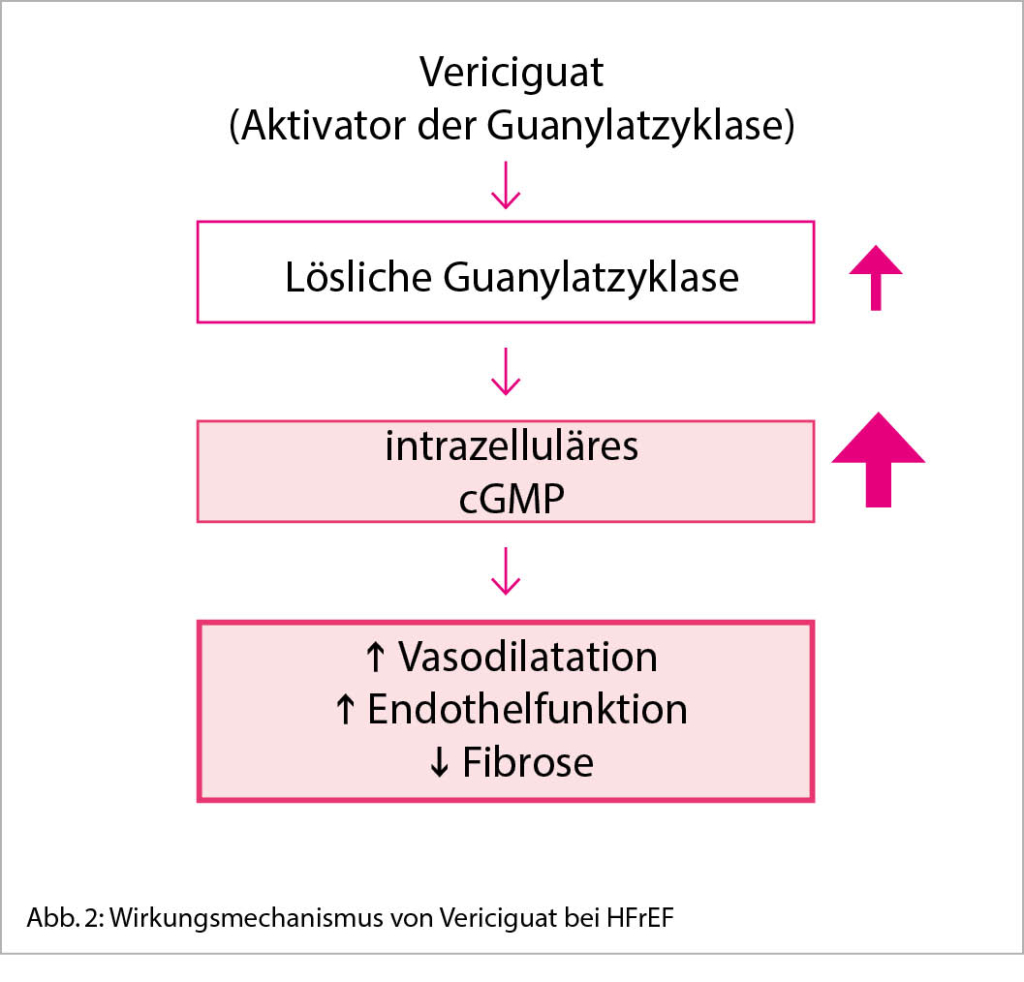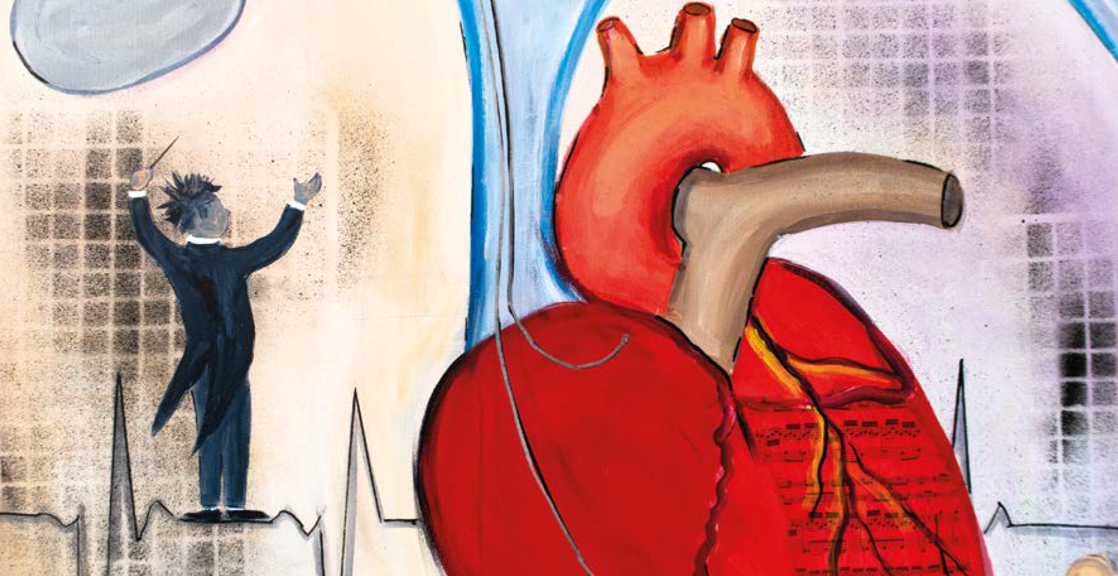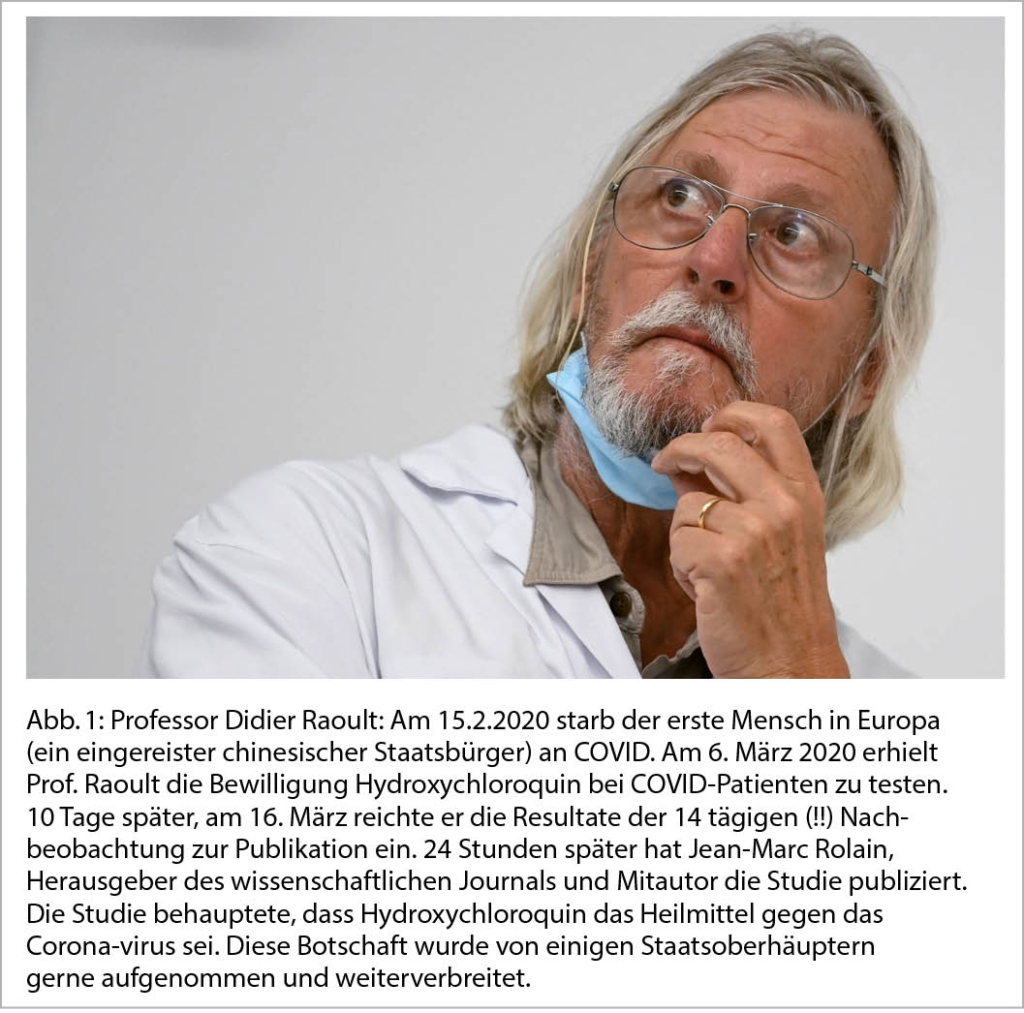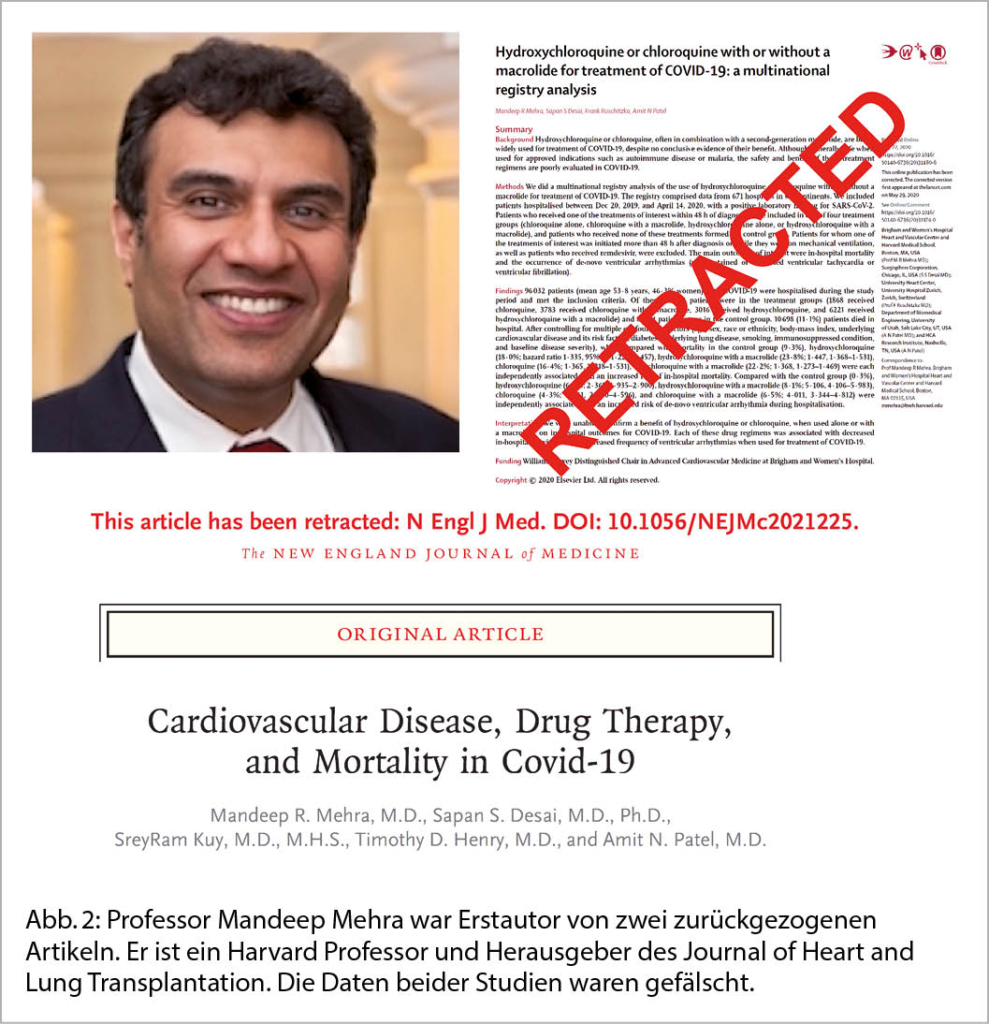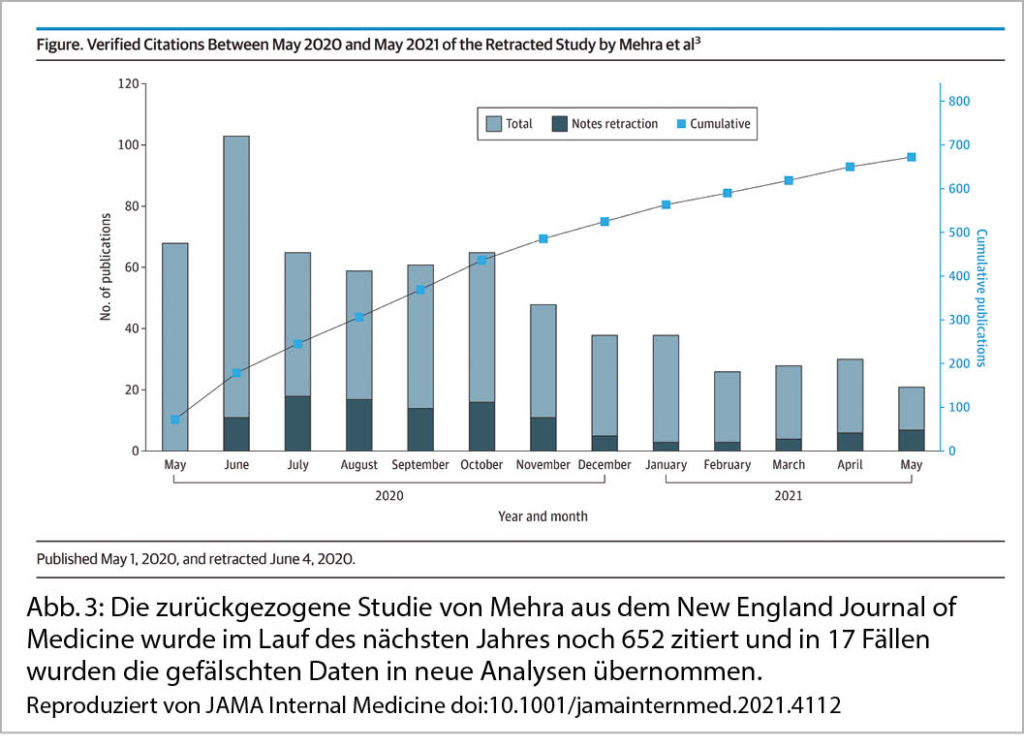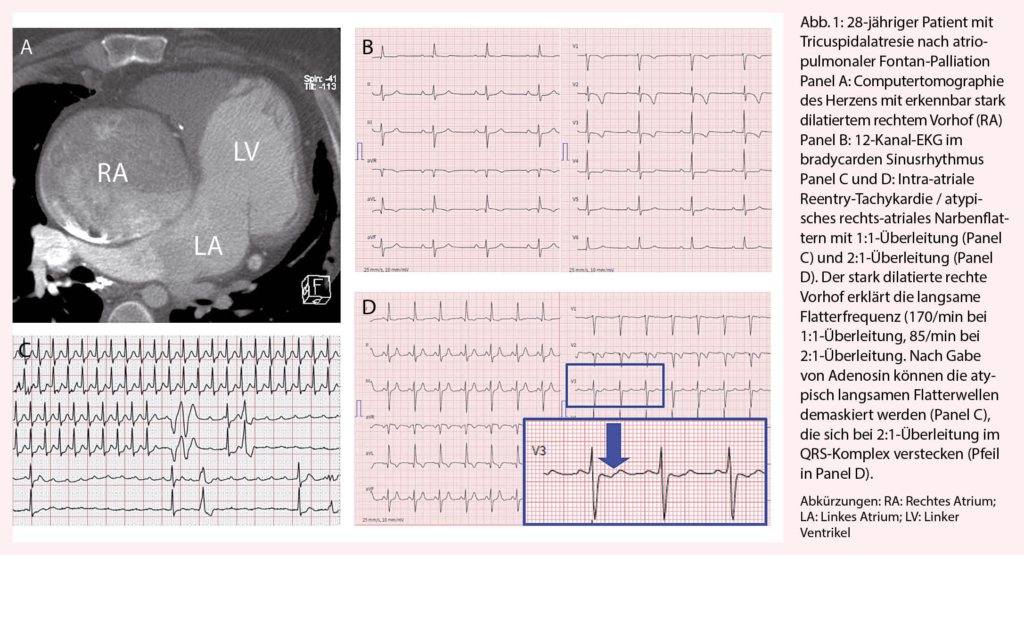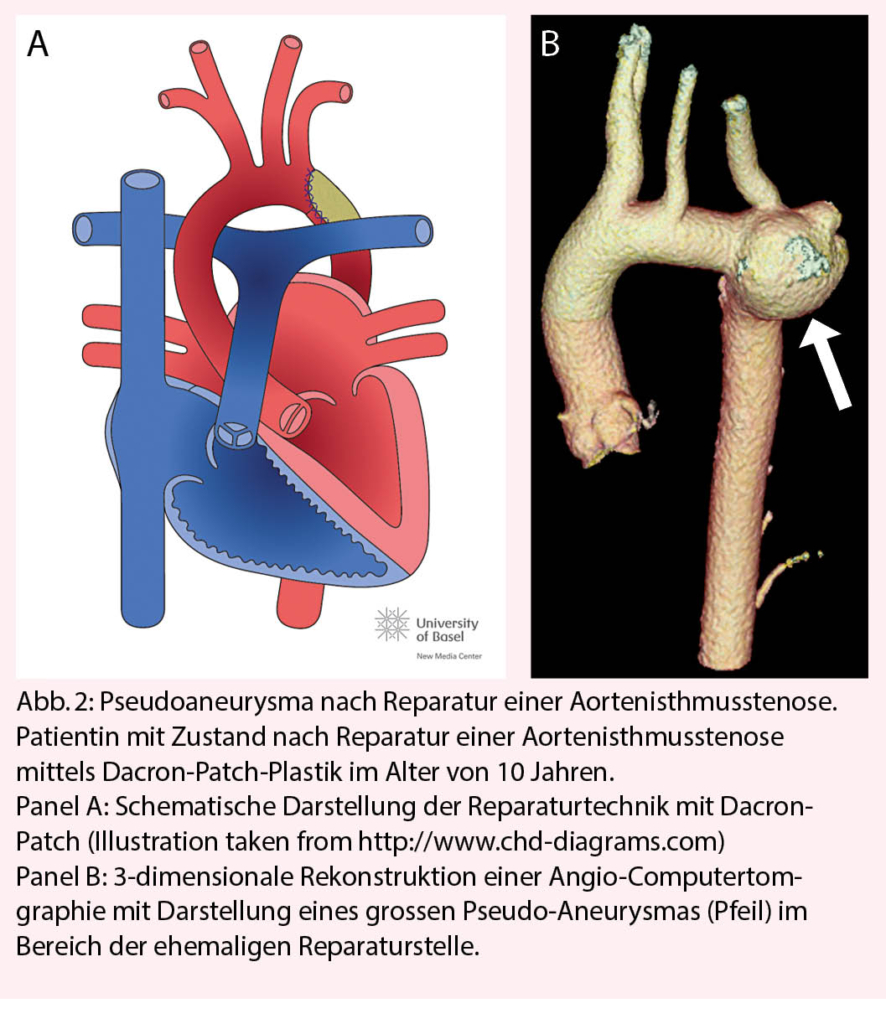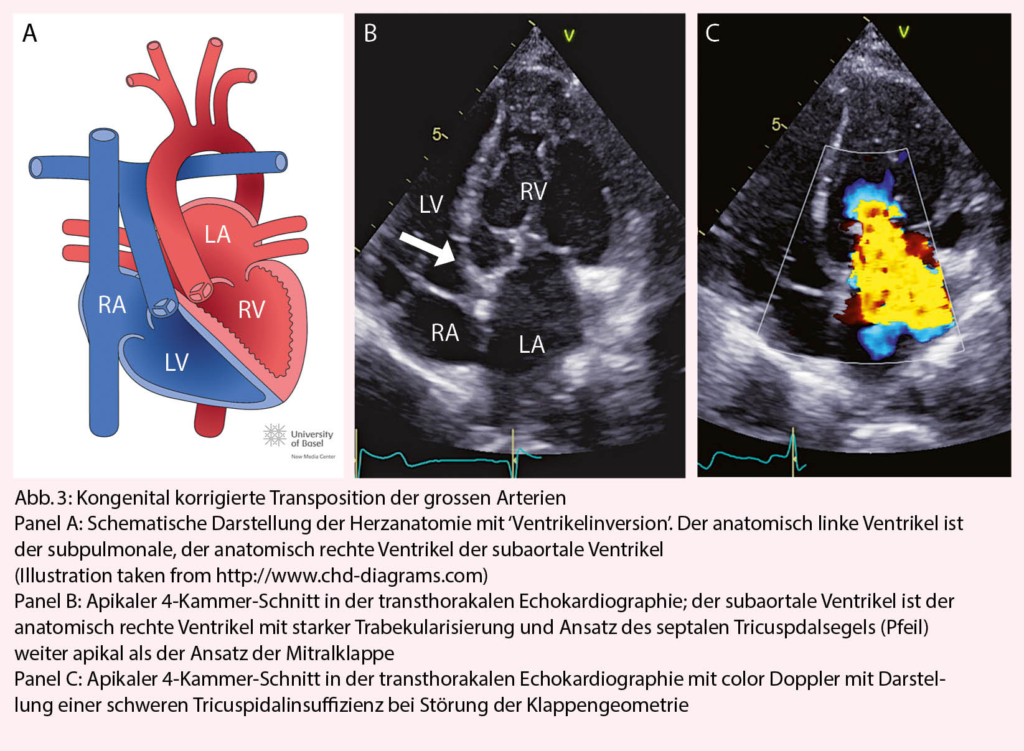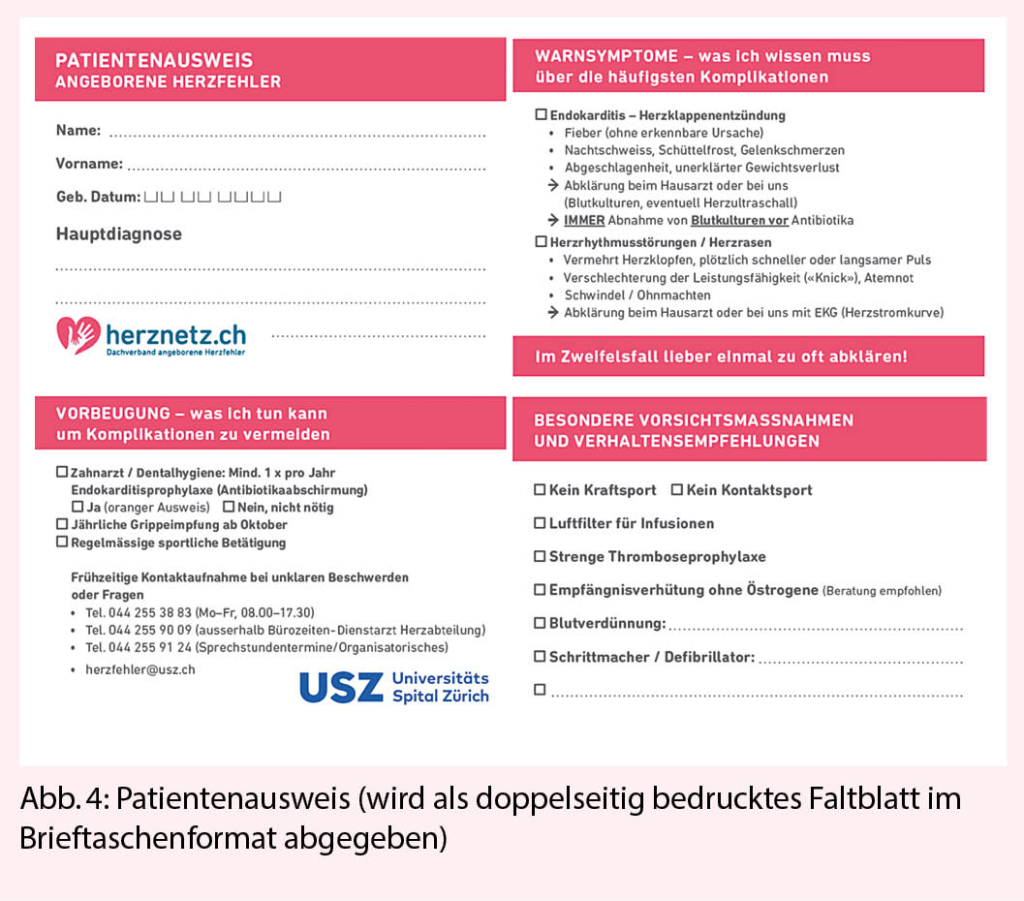Die häufigsten Symptome von COVID-19 sind Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, Sputumproduktion, Kurzatmigkeit, Geruchs- und Geschmacksverlust, Bindehautentzündung. Schwere Krankheitsverläufe sind gekennzeichnet durch Dyspnoe, erniedrigte Sauerstoffsättigung im Blut, Atemstillstand und venöse Thromboembolien. Ein wichtiges Thema sind auch die dermatologischen Manifestationen, die im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten.
Auffällig ist die Anzahl von Fallberichten und klinischen Serien, die ein komplexes Spektrum an Hautmanifestationen im Zusammenhang mit der SARS-Cov-2-Infektion beschrieben haben. Eine kürzlich veröffentlichte Übersichtsarbeit (1) hatte zum Ziel, die wichtigsten dieser beschriebenen Muster dermatologischer Manifestationen zusammenzufassen.
Die kutanen Manifestationen lassen sich wie folgt einteilen: Exanthem (varizellenartiger, papulovesikulärer und morbilliformer Ausschlag), vaskuläre (Chilblain-ähnliche, purpurrote/petechiale und livedoide Läsionen), urtikarielle und akropapulöse Eruption.
Exanthem-Muster
Varizellen-ähnliches Exanthem
Das varizellenartige Exanthem wurde erstmals von Marzano et al. (2) und Galván Casas et al. (3) als eine spezifische COVID-19-assoziierte Hautmanifestation beschrieben. Es ist klinisch durch ausgedehnte monomorphe papulovesikuläre Läsionen gekennzeichnet. In der jüngsten prospektiven in Spanien landesweit durchgeführten Studie (3) wurde dieses Exanthem bei 9% der untersuchten Patienten beschrieben. Die Läsionen treten im Median 3 Tage nach den Symptomen auf und dauern im Median 8 Tage an. Es ist mit einer moderaten Krankheitsschwere im Allgemeinen bei Patienten mittleren Alters assoziiert. Der Rumpf ist ständig betroffen und Juckreiz wird bei einigen, aber nicht allen Patienten beobachtet.
Die Histologie zeigt eine vakuoläre Degeneration mit desorganisierten Keratinozyten, vergrösserten und multinukleären Keratinozyten mit dyskeratotischen (apoptotischen) Zellen. Ein dichtes entzündliches Infiltrat kann vorhanden sein.
Makulo-papulöses Exanthem
Ein makulo-papulöser Ausschlag, der auch als morbilliform definiert wird und klinische Merkmale aufweist, die denen ähneln, die typischerweise bei viralen Exanthemen auftreten, wurde auch bei COVID-19-Patienten beschrieben (4-7). Der Ausschlag tritt gleichzeitig mit den anderen Symptomen der Infektion auf, hält kurz an (3-10 Tage) und ist bei den meisten Patienten von Juckreiz begleitet, bei älteren Patienten ist das makulo-papulöse Exanthem mit einer schweren Erkrankung verbunden. Galvan Casa et al. (3) berichteten über eine Prävalenz von 47% bei ihren 375 Patienten. Sie beschrieben eine perifollikuläre Verteilung in einigen Fällen und gelegentlich Schuppung. Der erythematöse Ausschlag kann an der Fossa antecubitalis und in den Axillarfalten besonders akzentuiert sein (8). Die Hautbiopsie zeigt einige unspezifische Merkmale eines virusbedingten Exanthems, wie z.B. eine leichte Spongiosis und ein leichtes perivaskuläres lymphozytäres Infiltrat.
Vaskuläres Muster
Bei einer SARS-CoV-2-Infektion wurden mehrere vaskuläre Läsionen beschrieben, darunter Chilblain-ähnliche Läsionen (die «COVID-Zehe»), besonders häufig bei Kindern, sowie livedoide Läsionen, purpurne Läsionen und akrale nekrotische Läsionen (9). Die meisten dieser klinischen Manifestationen können ein thrombotisches oder mikrothrombotisches pathologisches Gegenstück haben. Zusätzlich wurden Fälle von immunthrombozytopenischer Purpura und des Antiphospholipid-Antikörper-Syndroms mit ihren bekannten kutanen Manifestationen beschrieben (10, 11). SARS-CoV-2 infiziert den Wirt über den Rezeptor des Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2), der in verschiedenen Geweben, einschliesslich Endothelzellen, exprimiert wird (12). Das Spektrum der oben genannten vaskulären Läsionen kann auf verschiedene, möglicherweise sich überschneidende Mechanismen zurückzuführen sein. Dies sind u.a. eine direkte Wirkung des Virus auf Endothelzellen (13) und eine indirekte Wirkung über die Auslösung von Immun- oder Autoimmunreaktionen wie im Fall der Reaktion, die mit dem bekannten «Zytokinsturm» einhergeht. Welcher davon auch immer der auslösende Mechanismus war, die daraus resultierende mikrovaskuläre Dysfunktion kann zu einer erhöhten Gefässverengung und Organischämie, Entzündung und einem weiteren gerinnungsfördernden Zustand führen. Unter welchen Umständen Hautläsionen wie Chilblain-ähnliche Läsionen mit der Beteiligung innerer Organe korrelieren, muss noch definiert werden.
Chilblain-ähnliches Muster
Frostbeulen-ähnliche (Chilblain) oder pernioseartige Hautläsionen präsentieren sich als erythematös-ödematöse Manifestationen, die akrale Stellen betreffen, meist Zehen und Fusssohlen, mit möglicher bullöser Entwicklung. Sie sind in der Regel asymmetrisch und meist juckend und/oder schmerzhaft. (14). Sie betreffen typischerweise junge Patienten ohne systemische Symptome oder in Verbindung mit einer geringen Schwere der Erkrankung. Bemerkenswert ist, dass diese Patienten keine Vorgeschichte von Frostbeulen oder Raynaud-Phänomenen aufweisen. In der Fallserie, die von S. Recalcati berichtet wurde, verschwanden die Eruptionen nach 2-4 Wochen ohne jegliche Behandlung (15).
Fazit
- Die Hautmanifestationen, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion assoziiert sind, umfassen Exanthem (varizellenähnlicher, papulo-vesikulärer und morbilliformer Ausschlag), vaskuläre (Chilblain-ähnliche, purpurrote/petechiale und livedoide) Läsionen, urtikarielle Eruption und akropapulöse Eruption.
- Weitere zu berücksichtigende Hautmanifestationen sind die kutanen Reaktionen auf die zur Behandlung von COVID-19 verschriebenen Medikamente.
- Ob eine SARS-CoV-2-Infektion chronisch-entzündliche Erkrankungen wie Psoriasis oder atopische Dermatitis direkt verschlimmern kann, bleibt abzuwarten.
Quelle: Gisondi P et al. Cutaneous manifestations of SARS-CoV-2 infection: a clinical update. Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34:2499-2504.
riesen@medinfo-verlag.ch