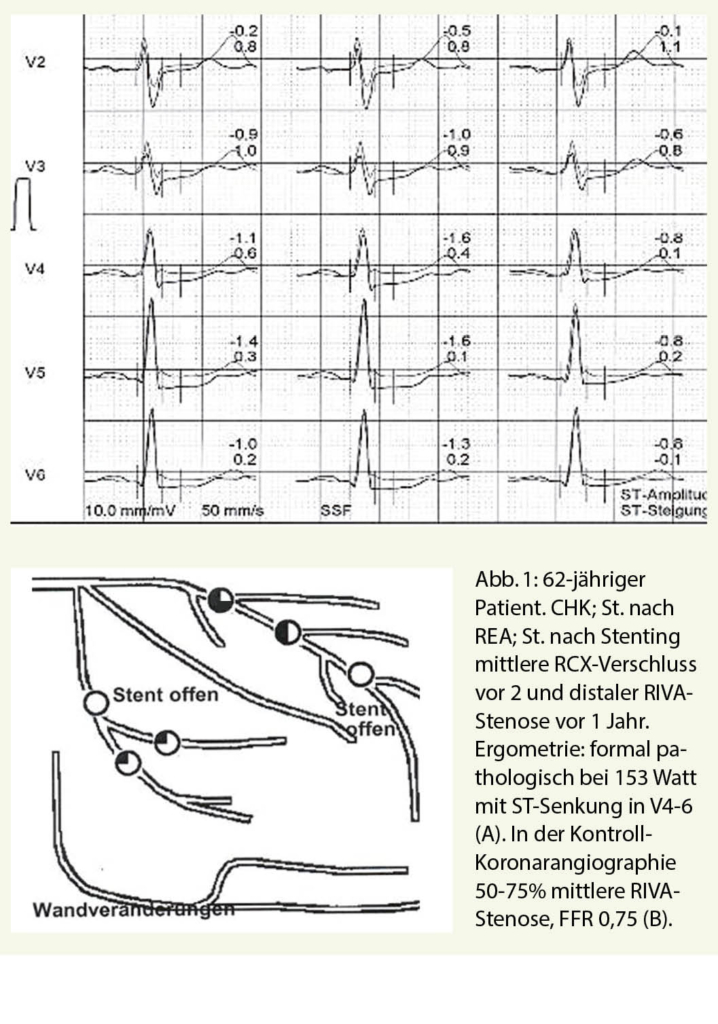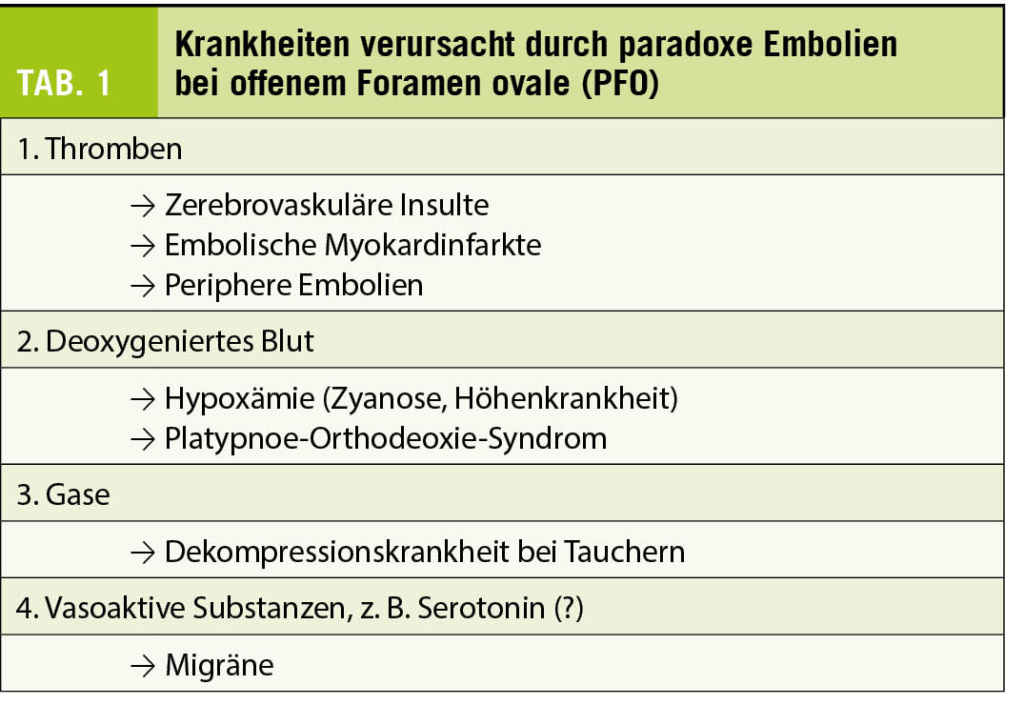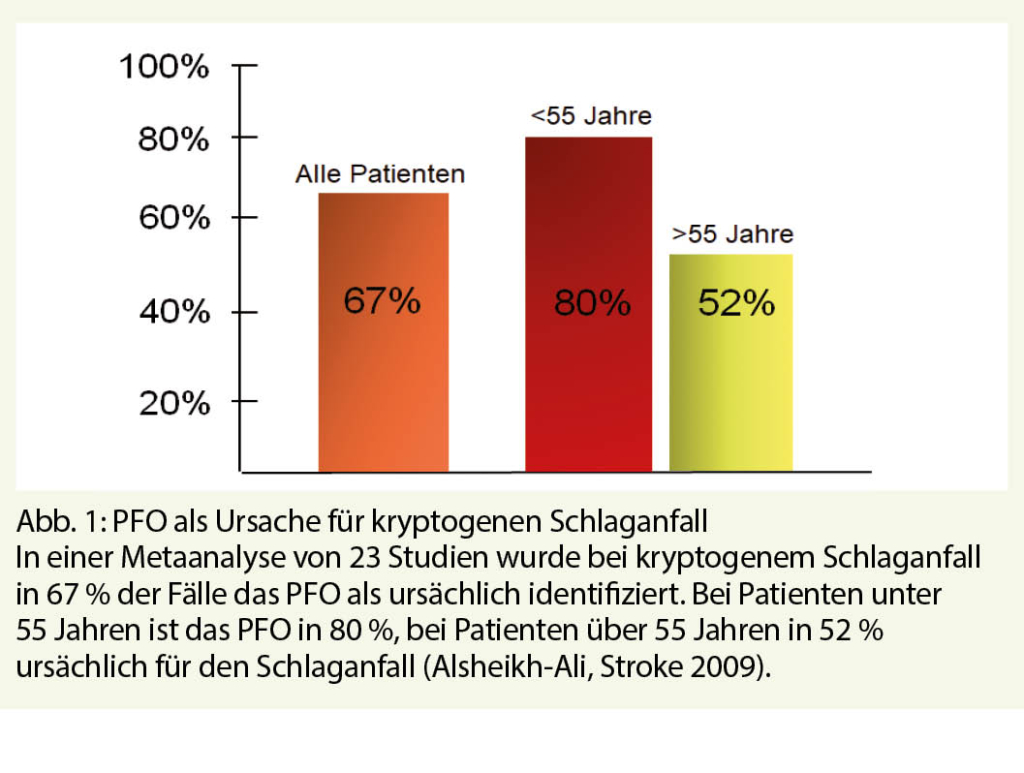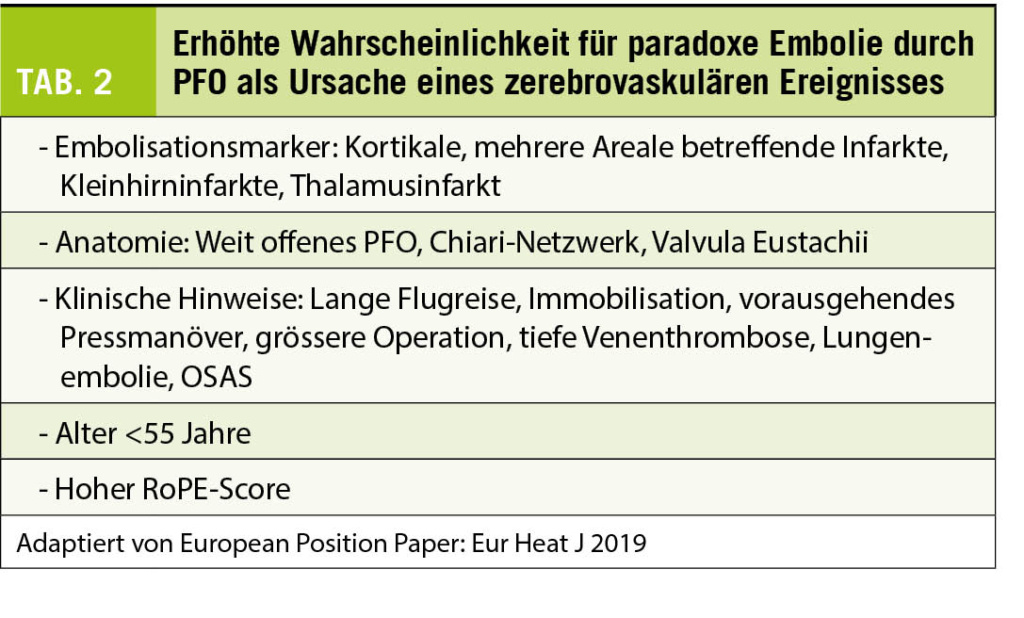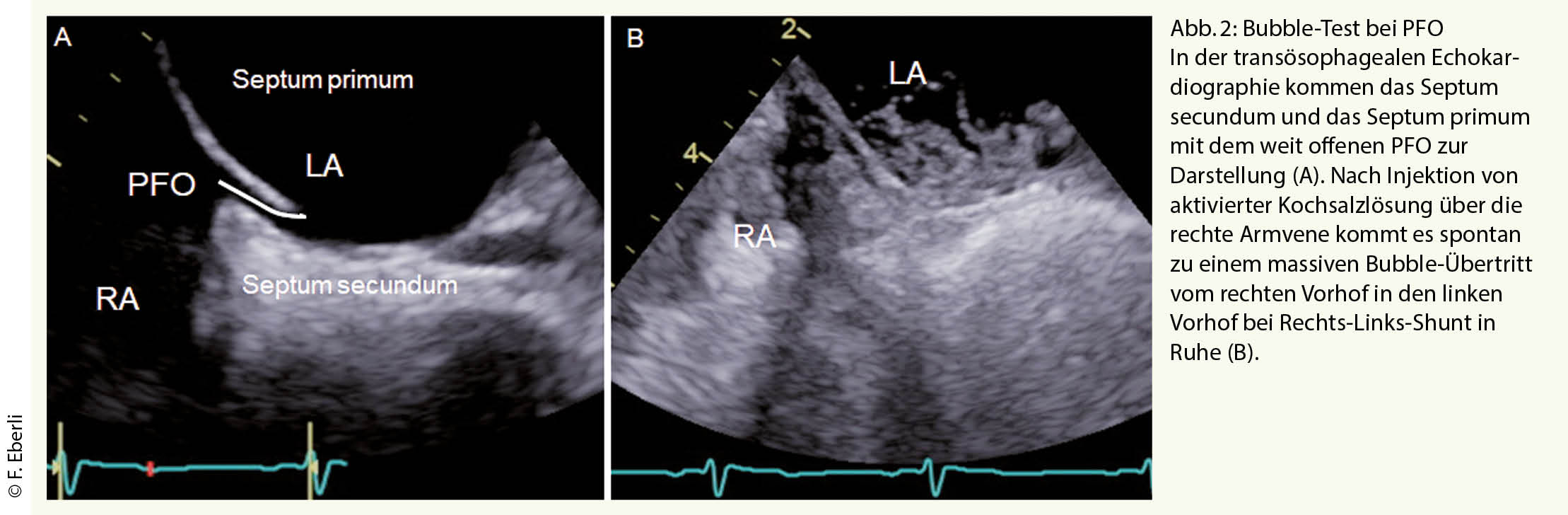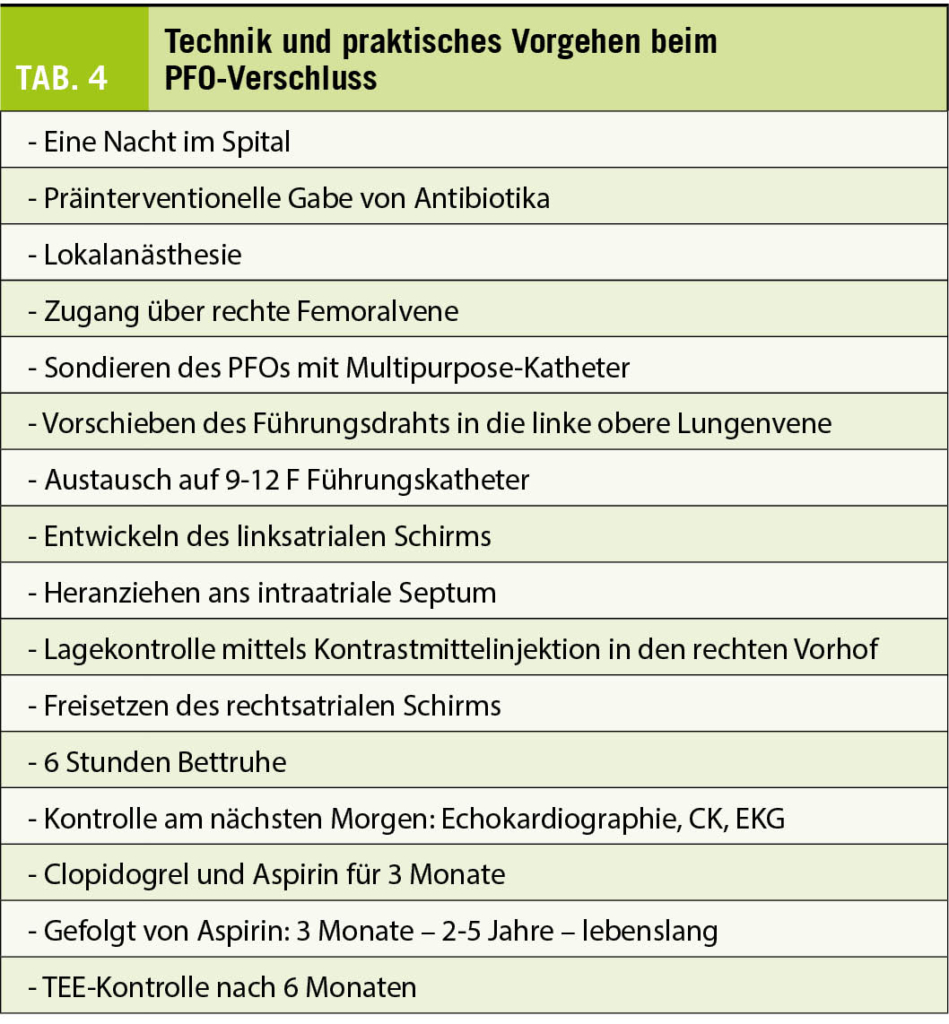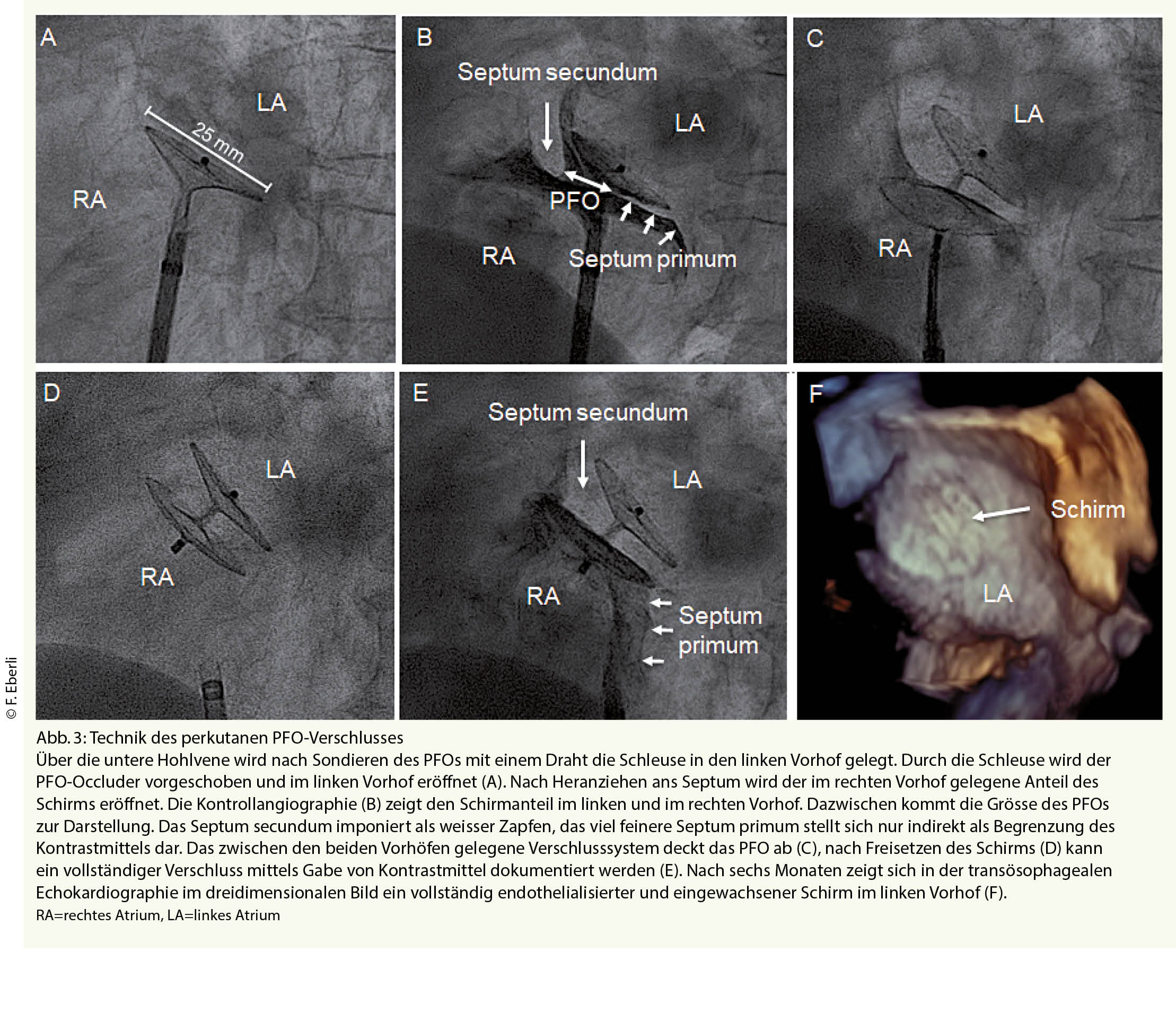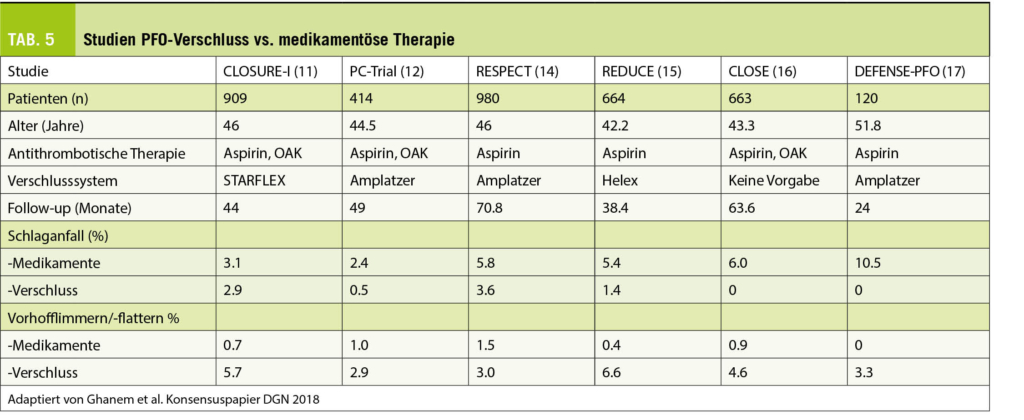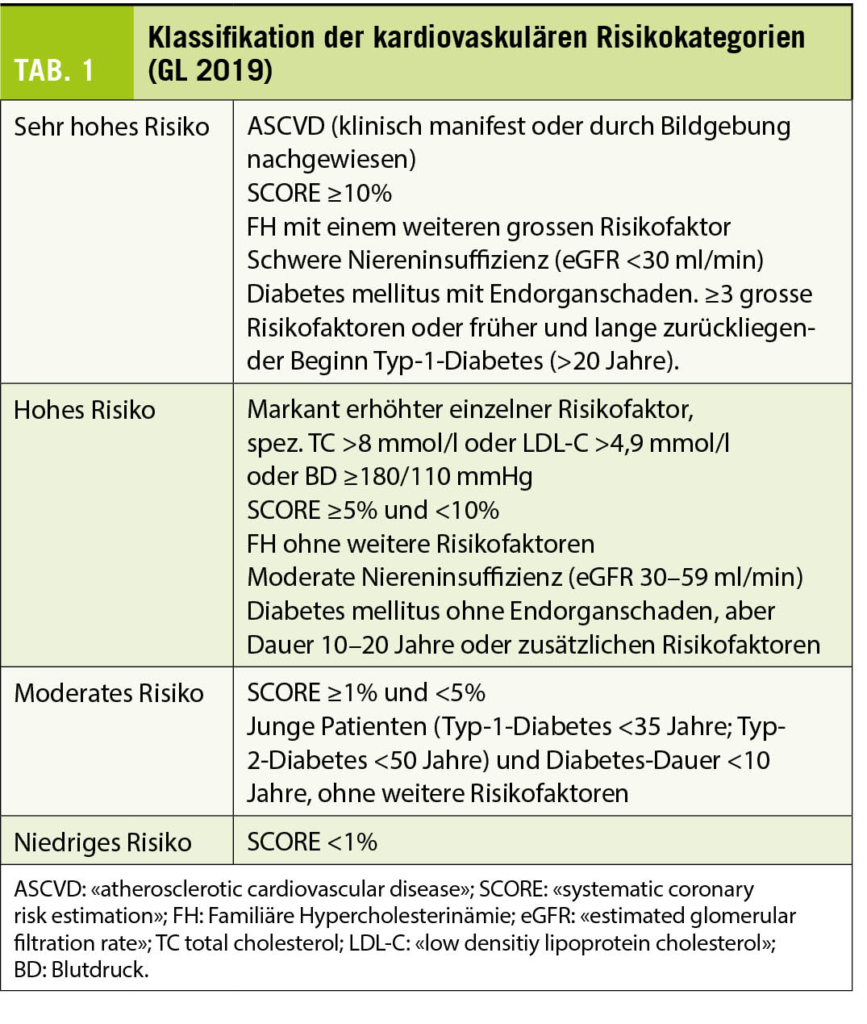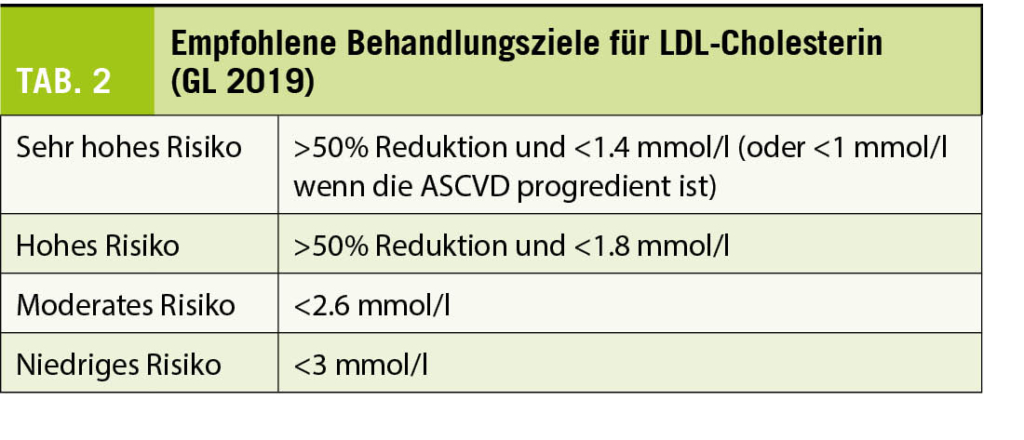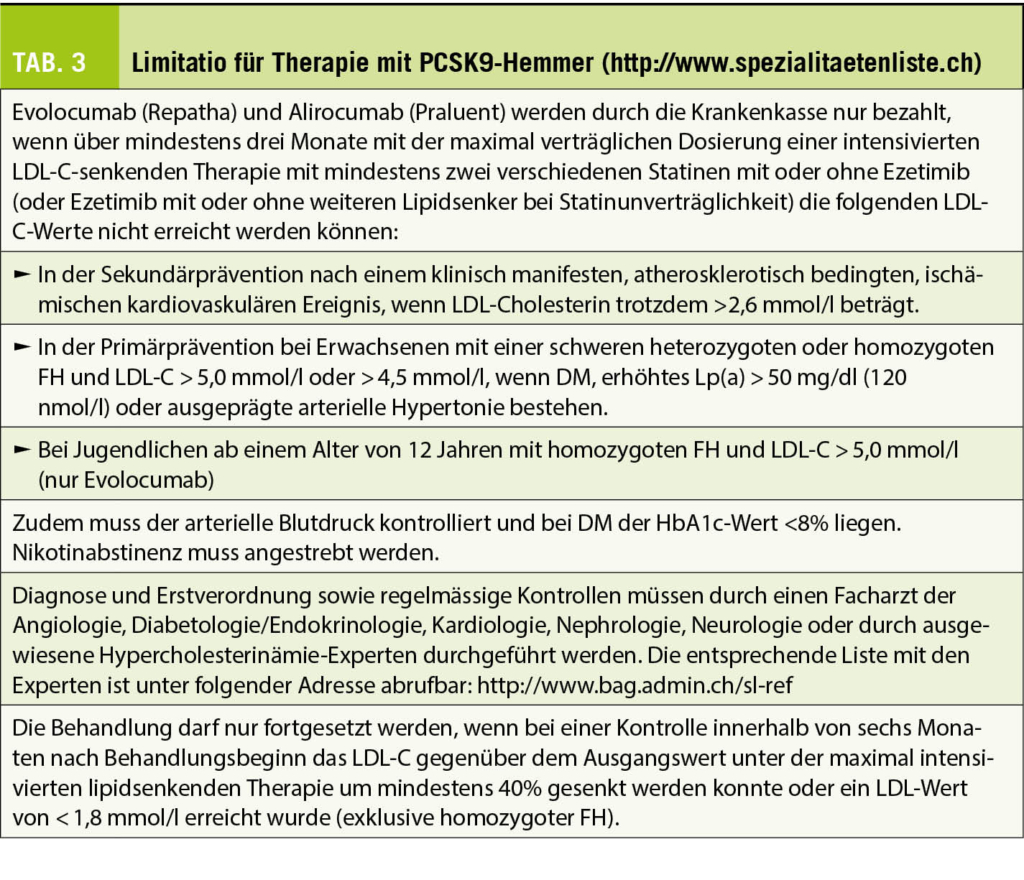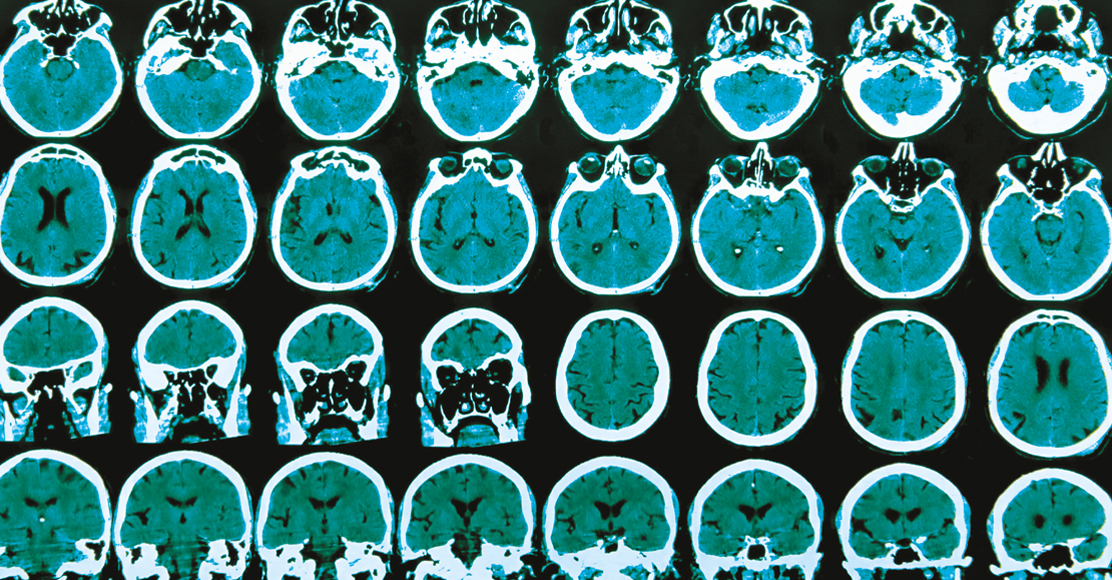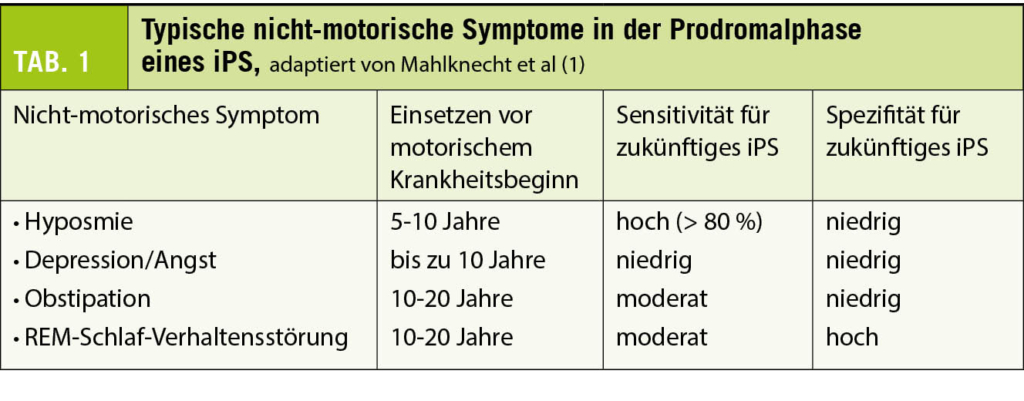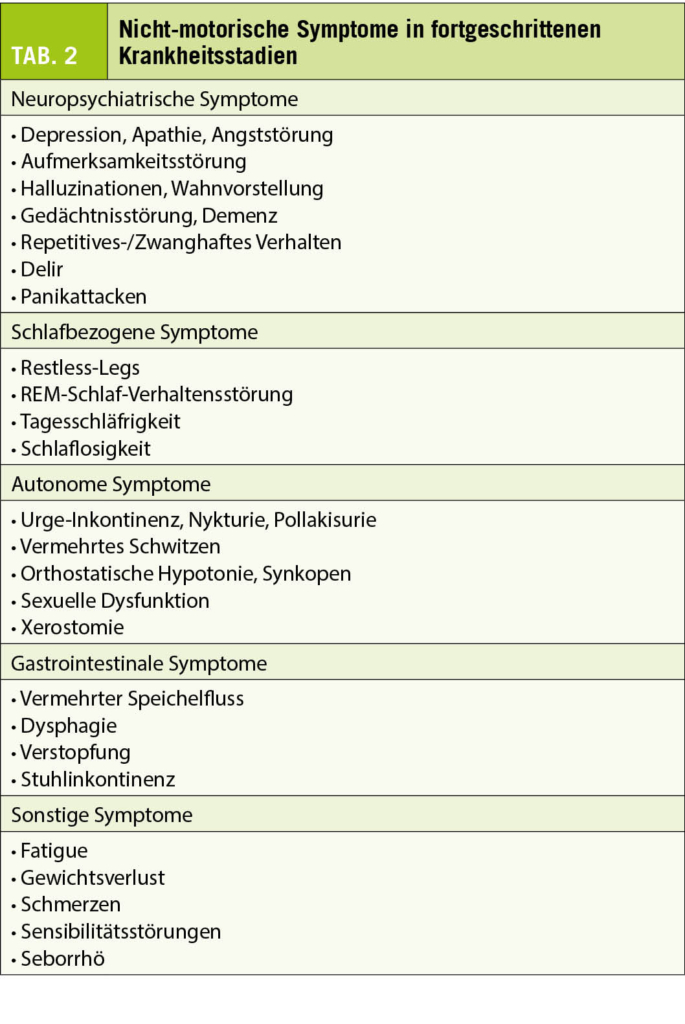1. Yunus MB (1983) Fibromyalgia syndrome: a need for uniform classification. J Rheumatol 10: 841–844
2. Müller W, Lautenschläger J (1990) Generalized tendomyopathy. I: Clinical aspects, follow-up and differential diagnosis. Z Rheumatol 49: 11–21
3. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, et al. (1990) The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis Rheum 33: 160–172
4. Wolfe F (2003) Stop using the American College criteria in the clinic. J Rheumatol 30: 1671–1672
5. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA et al. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. J Arthritis Care Res 2010; 62: 600–10.
6. Wolfe, F, Clauw DJ, Fitzcharles MA et al. (2016). 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. Semin Arthritis Rheum;46(3):319-329.
7. Egloff N, von Känel R, Müller V, Egle UT, Kokinogenis G, Lederbogen S, Durrer B, Stauber S (2015) Implications of proposed fibromyalgia criteria across other functional pain syndromes. Scand J Rheumatol 44: 416-24.
8. Van Houdenhove B, Egle UT (2004) Fibromyalgia: A stress disorder? Piecing the biopsychosocial puzzle together. Psychother Psychosom 73: 267–275
9. Van Houdenhove B, Egle UT, Luyten P (2005) The role of life stress in fibromyalgia. Curr Rheumatol Rep 7: 365–370
10. Cabo-Meseguer A, Cerda-Olmedo G, Trillo-Mata JL. Fibromyalgia: prevalence, epidemiologic profiles and economic costs. Med Clin (Barc). 2017;149: 441–8.
11. Buskila D, Press J, Gedalia A, et al. (1993) Assessment of nonarticular tenderness and prevalence of fibromyalgia in children. J Rheumatol 20: 368–370
12. Mikkelsson M, Kaprio J, Salminen JJ, et al. (2001) Widespread pain among 11-year-old Finnish twin pairs. Arthritis Rheum 44: 481–485
13. Clark P, Burgos-Vargas R, Medina-Palma C, et al. (1998) Prevalence of fibromyalgia in children: a clinical study of Mexican children. J Rheumatol 25: 2009–2014
14. Henriksson KG, Bäckman E, Henriksson C, de Laval JH (1996) Chronic regional muscular pain in women with precise manipulation work. A study of pain characteristics, muscle function, and impact on daily activities. Scand J Rheumatol 25: 213–223
15. Simms RW, Roy SH, Hrovat M, et al. (1994) Lack of association between fibromyalgia syndrome and abnormalities in muscle energy metabolism. Arthritis Rheum 37: 794–800
16. Buchwald D, Goldenberg DL, Sullivan JL, Komaroff AL (1987) The »chronic, active Epstein-Barr virus infection” syndrome and primary fibromyalgia. Arthritis Rheum 30: 1132–1136
17. Fye KH, Whiting-O’Keefe QE, et al. (1988) Absence of abnormal Epstein-Barr virus serologic findings in patients with fibrositis. Arthr Rheum 31: 1455–1456
18. Narváez J, Nolla JM, Valverde J (2005) No serological evidence that fibromyalgia is linked with exposure to human parvovirus B19. Joint Bone Spine 72: 592–594.
19. Wittrup IH, Christensen LS, Jensen B, et al. (2000) Search for Borna disease virus in Danish fibromyalgia patients. Scand J Rheumatol 29: 387–390
20. Buskila D, Neumann L (1997) Fibromyalgia (FM) and nonarticular tenderness in relatives of patients with FM. J Rheumaol 24: 941–944
21. Rivera J, de Diego A, Trinchet M, García Monforte A (1997) Fibromyalgia-associated hepatitis C virus infection. Br J Rheumatol 36: 981–985
22. Goulding C, O’Connell P, Murray FE (2001) Prevalence of fibromyalgia, anxiety and depression in chronic hepatitis C virus infection: Relationship to RT-PCR status and mode of acquisition. Eur J Gastroenterol Hepatol 13: 507–511
23. Kozanoglu E, Canataroglu A, Abayli B, et al. (2003) Fibromyalgia syndrome in patients with hepatitis C infection. Rheumatol Int 23: 248–251
24. Cairns V, Godwin J (2005) Post-Lyme borreliosis syndrome: A meta-analysis of reported symptoms. Int J Epidemiol 34: 1340–1345.
25. Hsu VM, Patella SJ, Sigal LH (1993) »Chronic Lyme disease” as the incorrect diagnosis in patients with fibromyalgia. Arthritis Rheum 36: 1493–500
26. Steere AC, Taylor E, McHugh GL, Logigian EL (1993) The overdiagnosis of Lyme disease. JAMA 269: 1812–1826
27. Weir PT, Harlan GA, Nkoy FL, et al. (2006) The incidence of fibromyalgia and its associated comorbidities: A population-based retrospective cohort study based on International Classification of Diseases, 9th Revision codes. J Clin Rheumatol 12: 124–128
28. Littlejohn G (2015) Neurogenic neuroinflammation in fibromyalgia and complex regional pain syndrome. Nat Rev Rheumatol 11: 639-48.
29. Wallace D, Bowman RL, Wormsley SB, Peter JB (1989) Cytokines and immune regulation in patients with fibrositis. Arthritis Rheum 32: 1334–1335
30. Gur A, Cevik R, Sarac AJ, et al. (2004) Hypothalamic-pituitary-gonadal axis and cortisol in young women with primary fibromyalgia: The potential roles of depression, fatigue, and sleep disturbance in the occurrence of hypocortisolism. Ann Rheum Dis 63: 1504–1506
31. Kadetoff D, Lampa J,Westman M, Andersson M, Kosek E (2012) Evidence of central inflammation in fibromyalgia-increased cerebrospinal fluid interleukin-8 levels. J Neuroimmunol 242: 33–38.
32. Xanthos DN, Sandkühler J. Neurogenic neuroinflammation: inflammatory reactions in response to neuronal activity. Nat Rev Neurosci 2014; 15: 43–53.
33. Littlejohn G, Guymer E (2018) Neurogenic inflammation in fibromyalgia. Sem Immunopathol 40: 291-300.
34. Üçeyler N, Zeller D, Kahn AK, Kewenig S, Kittel-Schneider S, Schmid A, Casanova-Molla J, Reiners K, Sommer C. Small fibre pathology in patients with fibromyalgia syndrome. Brain 2013; 136:1857-67.
35. Martinez-Lavin M, Hermosillo AG, Rosas M, Soto ME (1998) Circadian studies of autonomic nervous balance in patients with fibromyalgia: A heart rate variability analysis. Arthritis Rheum 41: 1966–1971
36. Cohen H, Neumann L, Shore M, et al. (2000) Autonomic dysfunction in patients with fibromyalgia: Application of power spectral analysis of heart rate variability. Semin Arthritis Rheum 29: 217–227
37. Cohen H, Buskila D, Neuman L, Ebstein RP (2002) Confirmation of an association between fibromyalgia and serotonin transporter promoter region (5-HTTLPR) polymorphism, and relationship to anxiety-related personality traits. Arthritis Rheum 46: 845–847
38. Glass JM, Lyden A, Petzke F, Clauw D (2004) The effect of brief exercise cessation on pain, fatigue, and mood symptom development in healthy, fit individuals. J Psychosom Res 57: 391–398
39. McBeth J, Chiu YH, Silman AJ, et al. (2005) Hypothalamic pituitary adrenal stress axis function and the relationship with chronic widespread pain and its antecedents. Arthritis Res Ther 7: R992–1000
40. Chrousos GP, Gold PW (1992) The concepts of stress and stress system disorders. Overview of physical and behavioral homeostasis. JAMA 267: 1244–1252
41. Arlt J, Jahn H, Kellner M, et al. (2003) Modulation of sympathetic activity by corticotropin-releasing hormone and atrial natriuretic peptide. Neuropeptides 37: 362–368
42. Riedel W, Schlapp U, Leck S, et al. (2002) Blunted ACTH and cortisol responses to systemic injection of corticotropin-releasing hormone (CRH) in fibromyalgia: Role of somatostatin and CRH-binding protein. Ann NY Acad Sci 966: 483–490
43. McLean SA, Williams DA, Stein P, et al. (2006) Cerebrospinal fluid corticotropin-releasing factor concentration is associated with pain but not fatigue symptoms in patients with fibromyalgia. Neuropsychopharmacol 31: 2776–2782
44. Dadabhoy D, Crofford LJ, Spaeth M, et al. (2008) Biology and therapy of fibromyalgia. Evidence-based biomarkers for fibromyalgia syndrome. Arthritis Res Ther 10: 211–229.
45. Moldofsky H, Scarisbrick P, England R (1975) Musculoskeletal symptoms and non-REM sleep disturbances in patients with »fibrositis syndrome” and healthy subjects. Psychosom Med 34: 341–351
46. Branco J, Atalaia A, Paiva T (1994) Sleep cycles and alpha-delta sleep in fibromyalgia syndrome. J Rheumatol 6: 1113–1117
47. Roizenblatt S, Moldofsky H, Benedito-Silva AA, Tufik S (2001) Alpha sleep characteristics in fibromyalgia. Arthritis Rheum 44: 222–230
48. Mundal I, Gråwe RW, Bjørngaard JH, Linaker OM, Fors EA (2014) Psychosocial factors and risk of chronic widespread pain: an 11-year follow-up study–the HUNT study. Pain 155: 1555-61.
49. Palagini L, Carmassi C, Conversano C, Gesi C, Bazzichi L, Giacomelli C, Dell’Osso L (2016) Transdiagnostic factors across fibromyalgia and mental disorders: sleep disturbances may play a key role. A clinical review. Clin Exp Rheumatoln34(2 Suppl 96): S140-4.
50. Nijs J , Loggia ML, Polli A, Moens M, Huysmans E, Goudman L, Meeus M, Vanderweeën L, Ickmans K, Clauw D (2017) Sleep disturbances and severe stress as glial activators: key targets for treating central sensitization in chronic pain patients? Exp Opin Therap Targ 21: 8, 817-826.
51. Clauw DJ, Crofford LJ (2003) Chronic wide-spread pain and fibromyalgia, what we know and what we need to know. Best Pract Res Clin Rheumatol 17: 685–701
52. McDermid AJ, Rollman GB, McCain GA (1996) Generalized hypervigilance in fibromyalgia: evidence of perceptual amplification. Pain 66: 133–144
53. Schweinhardt P, Sauro KM, Bushnell MC (2008) Fibromyalgia: A disorder of the brain? Neuroscientist 14: 415–421
54. Cook DB, Lange G, Ciccone DS, et al. (2004) Functional imaging of pain in patients with primary fibromyalgia. J Rheumatol 31: 364–378
55. Heinricher MM, Tavares I, Leith JL, Lumb BM (2009) Descending control of nociception: Specificity, recruitment and plasticity. Brain Res Rev 60: 214–225
56. Jensen KB, Srinivasan P, Spaeth R, Tan Y, Kosek E, Petzke F, Carville S, Fransson P, Marcus H, Williams SC, Choy E, Vitton O, Gracely R, Ingvar M, Kong J (2013) Overlapping structural and functional brain changes in patients with long-term exposure to fibromyalgia pain. Arthritis Rheum 65: 3293-303.
57. Roozendaal B, McEwen BS, Chatarij S (2009) Stress, memory and the amygdala. Nat Neurosci Rev 10: 423–433
58. Afari N, Ahumada SM, Wright LJ, Mostoufi S, Golnari G, Reis V, Cuneo JG (2014) Psychological trauma and functional somatic syndromes: A systematic review and meta-analysis. Psychosomatic Medicine 76 :2-11.
59. Imbierowicz K, Egle UT (2003) Childhood adversities in patients with fibromyalgia and somatoform pain disorder. Eur J Pain 7: 113–119
60. Van Houdenhove B, Neerinckx E, Lysens R, et al. (2001) Victimization in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia in tertiary care: A controlled study on prevalence and characteristics. Psychosomatics 42: 21–28
61. Goldberg RT, Pachas WN, Keith D (1999) Relationship between traumatic events in childhood and chronic pain. Disabil Rehabil 21: 23–30.
62. Walker EA, Keegan D, Gardner G, et al. (1997) Psychosocial factors in fibromyalgia compared with rheumatoid arthritis: II. Sexual, physical, and emotional abuse and neglect. Psychosom Med 59: 572–577
63. Boisset-Pioro MH, Esdaile JM, Fitzcharles MA (1995) Sexual and physical abuse in women with fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheu 38: 235–241
64. Macfarlane GJ, Norrie G, Atherton K, et al. (2009) The influence of socioeconomic status on the reporting of regional and widespread musculoskeletal pain: Results from the 1958 British Birth Cohort Study. Ann Rheum Dis 68: 1591–1595
65. Jones GT, Power C, Macfarlane GJ (2009) Adverse events in childhood and chronic widespread pain in adult life: Results from the 1958 British Birth Cohort Study. Pain 143: 92–96
66. Schanberg LE, Keefe FJ, Lefebvre JC, et al. (1998) Social context of pain in children with juvenile primary fibromyalgia syndrome: parental pain history and family environment. Clin J Pain 14: 107–115
67. Conte PM, Walco GA, Kimura Y (2003) Temperament and stress response in children with juvenile primary fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum 48: 2923–2930
68. Kashikar-Zuck S, Lynch AM, Graham TB, et al. (2007) Social functioning and peer relationships of adolescents with juvenile fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum 57: 474–480