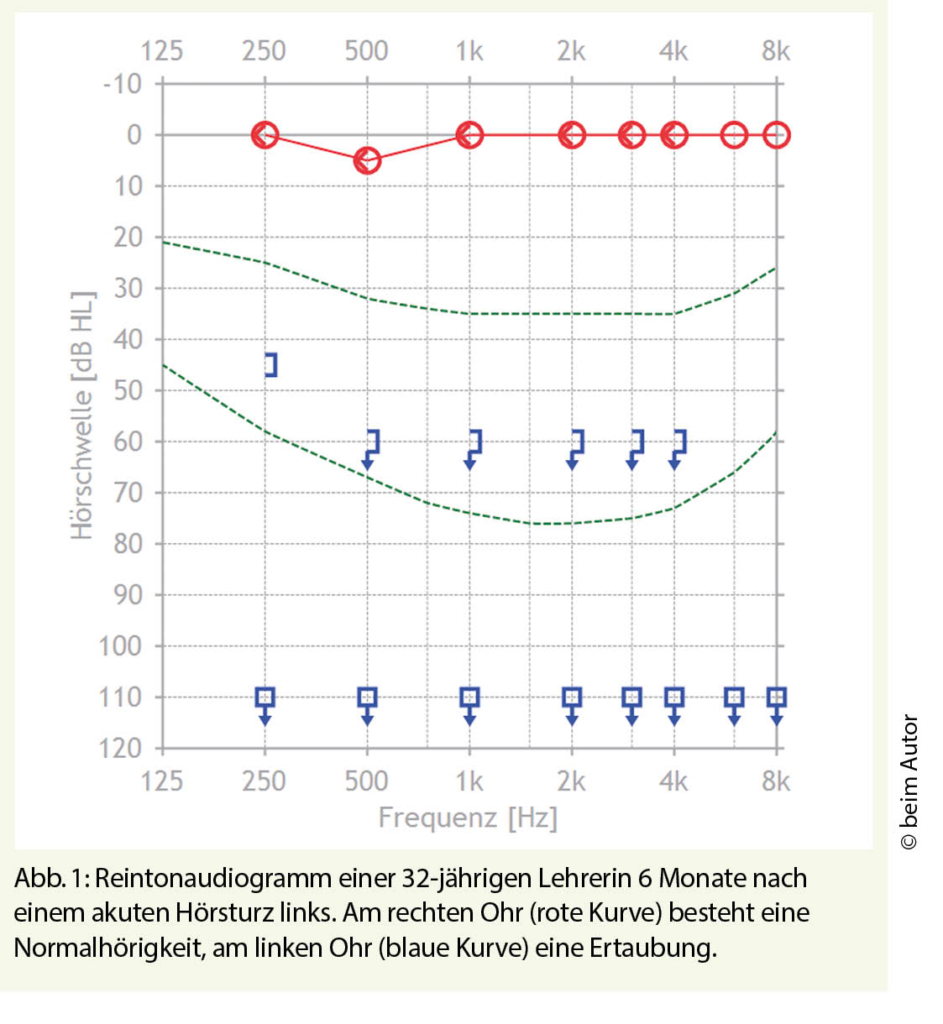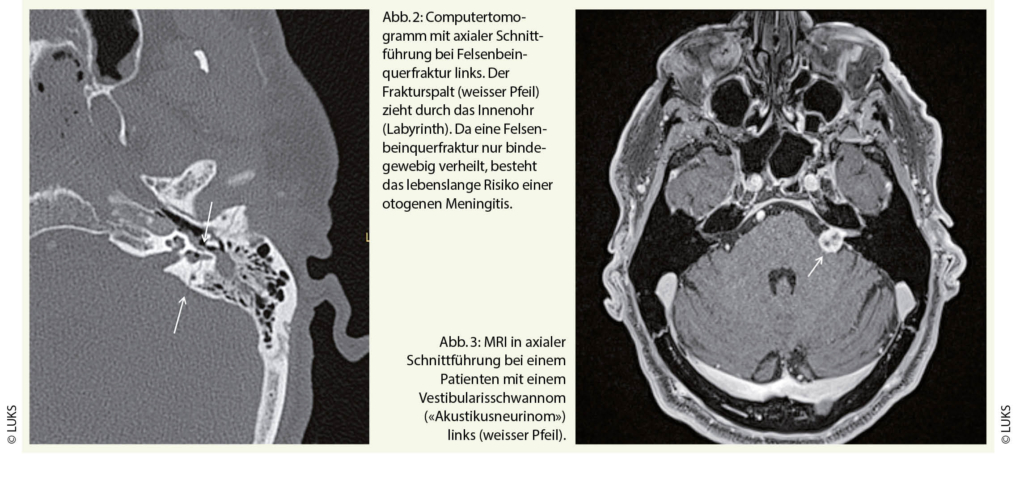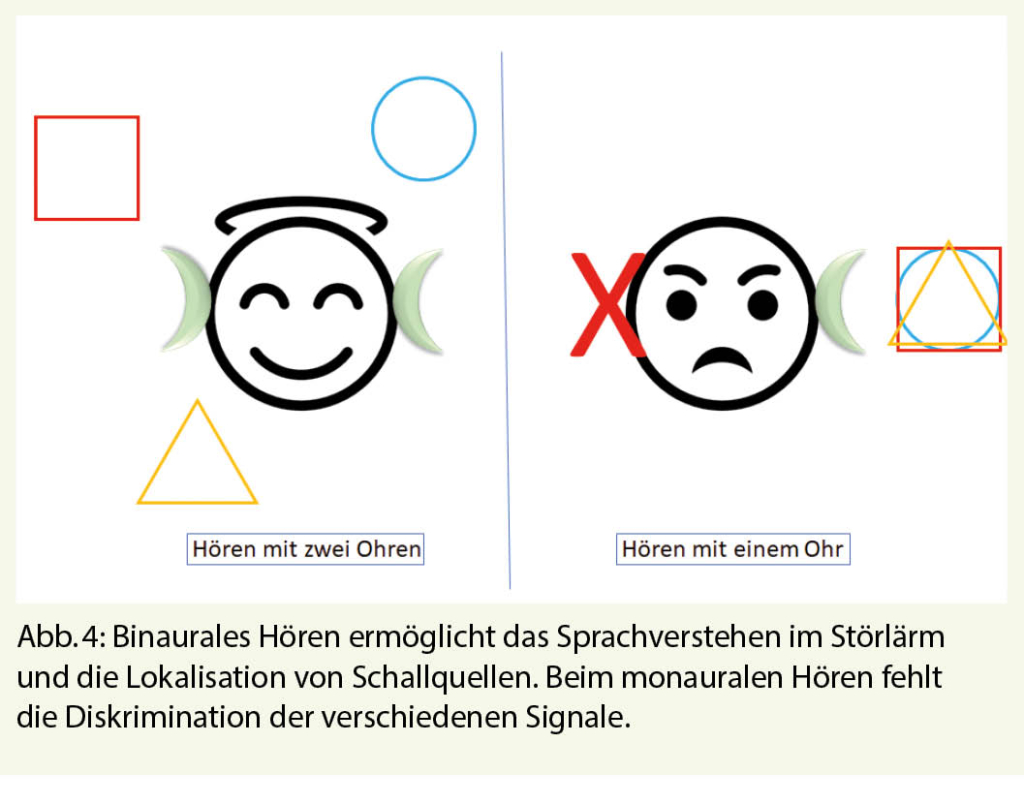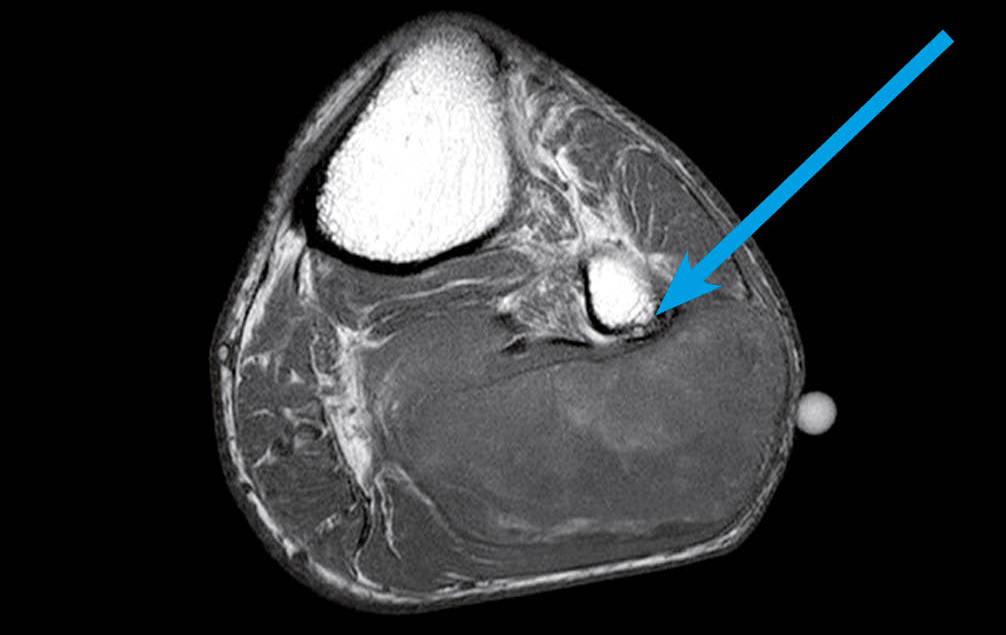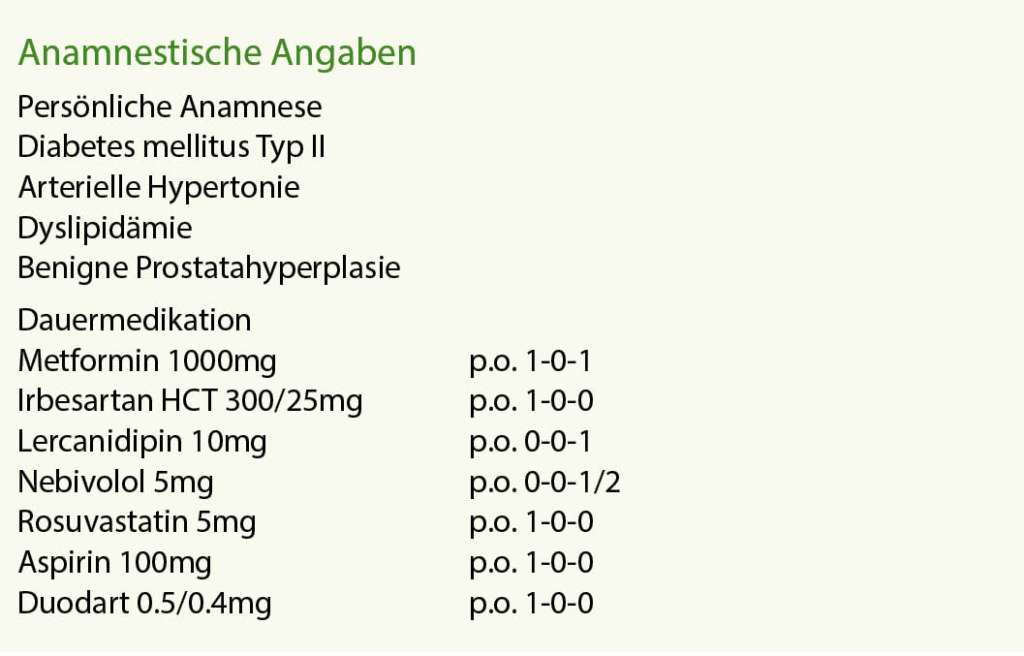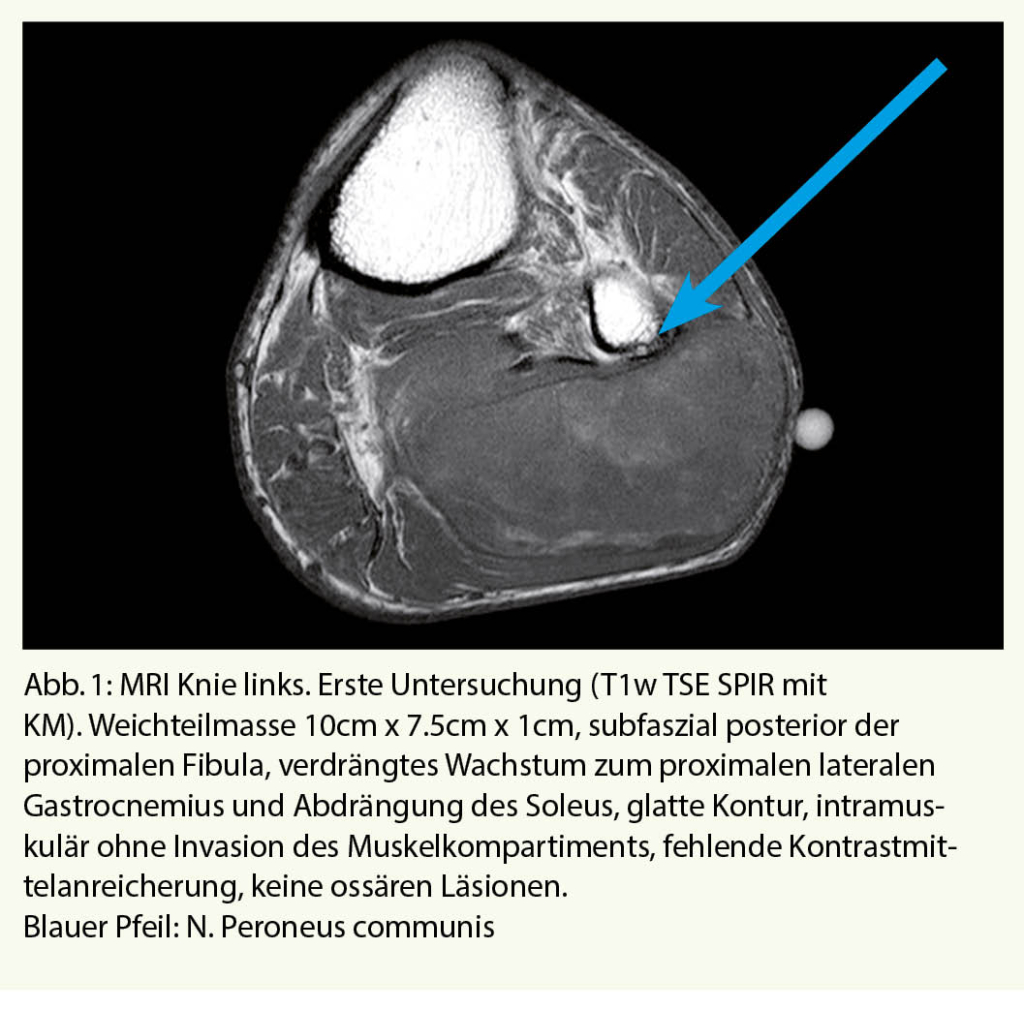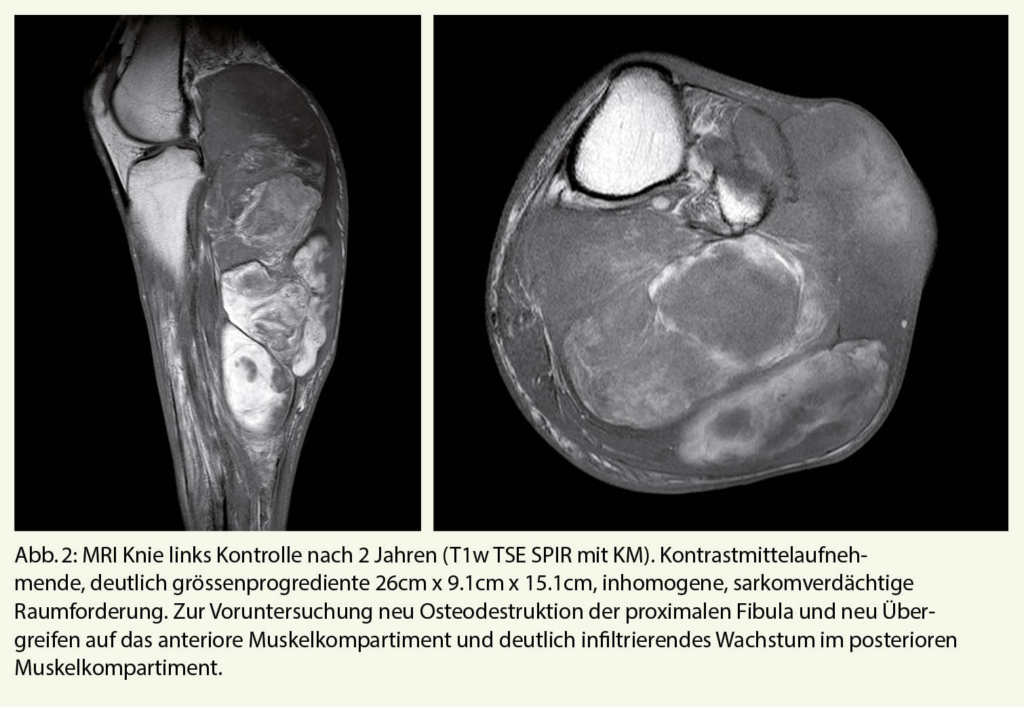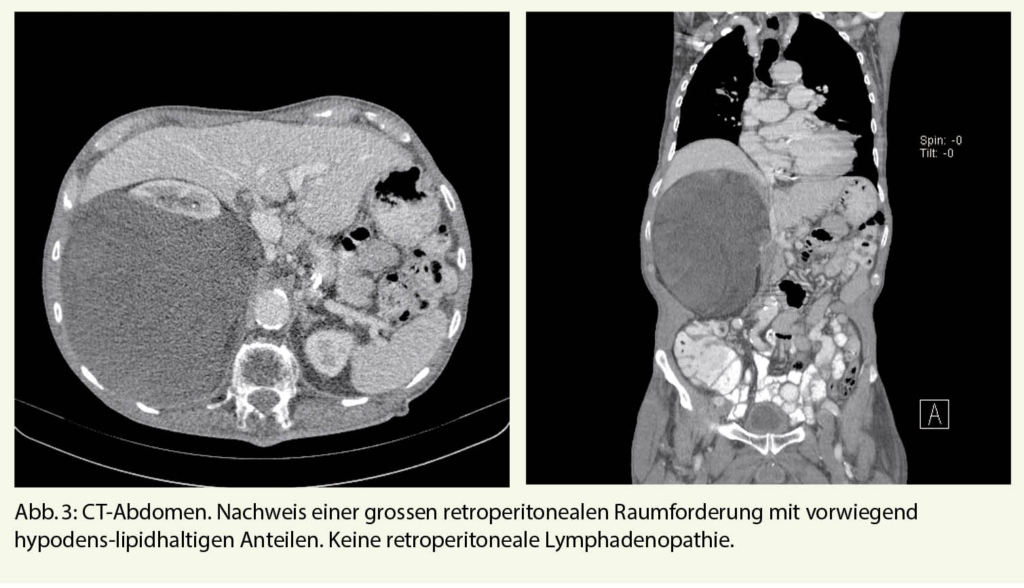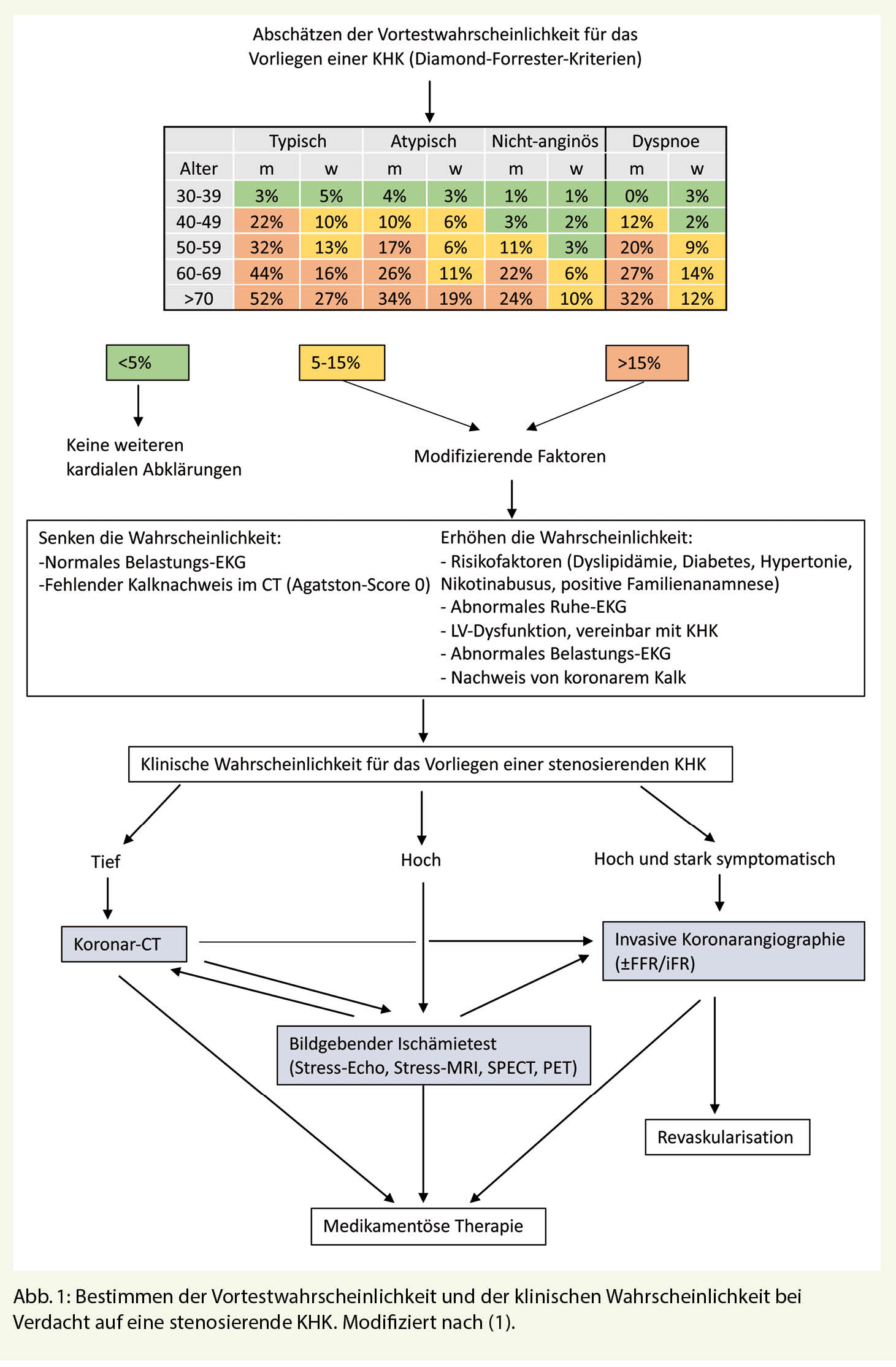La ritournelle de Robert Miville, tant chantée par les enfants à la fin de l’ année scolaire, est ici détournée par le sociologue Roland J. Campiche et le neurobiologiste Yves Dunant pour questionner l’ utilité de la formation lorsque c’ est tous les jours dimanche. « Faire du sport, s’ alimenter sainement c’ est bien. Mais en négligeant la formation, on ampute l’ individu de la capacité de comprendre ses choix et de fixer des priorités » (1).
« En vieillissant, je continue d’ apprendre » (2). Les deux amis, professeurs honoraires et codirecteurs de l’ ouvrage collectif « A la retraite, les cahiers au feu ? Apprendre tout au long de la vie : enjeux et défis » convient le lecteur et la lectrice à une réflexion argumentée. Il faut, selon eux, intégrer les adultes aînés dans une politique de formation cohérente qui les accompagnerait tout au long de leur vie. Et ce, quel que soit leurs âges et leurs formations antérieures. Les bénéfices sociaux et sanitaires d’ une telle démarche seraient nombreux, autant individuels que collectifs.
La retraite ne sonne en effet pas le glas de la curiosité, de l’ envie d’ apprendre, de découvrir de nouvelles choses et de réaliser de nouveaux projets. Cependant, force est de constater que malgré les études scientifiques qui corrèlent positivement formation et santé, la Suisse ne perçoit pas l’ utilité de former de gens « improductifs ». Cette limitation de la compréhension préventive de la formation sur la santé et le bien-être individuel – et donc collectif – est à terme délétère.
Magdalena R., une fiction réaliste
C’ est en suivant la fictive Magdalena R. dans les pérégrinations de ses premières années de retraite, au travers d’ un kaléidoscope d’ expériences et de témoignages, que le lecteur et la lectrice parcourent 8 chapitres articulant témoignages et données scientifiques sur les modalités et les bienfaits de la formation une fois à la retraite.
Pierre Lässer, secrétaire générale de la Fédération suisse des retraités, débute l’ ouvrage et fait, à partir de son expérience personnelle, un plaidoyer pour les conférences organisées par les Université des Seniors. Ces dernières permettent l’ acquisition et le maintien d’ une « culture générale ». Son récit montre que les adultes aînés peuvent, dans ce contexte et dans un monde de plus en plus connecté et changeant, maintenir leurs capacités d’ analyse critique, d’ identification et de mise en contexte des préjugés, nuisibles à la vie en collectivité.
Les Universités des seniors n’ ont rien de nouveau. Dès les années 70, plusieurs universités du 3ème âge voient le jour en Suisse. Dans la région lausannoise et ce, depuis 1997, Connaissance 3 offre chaque semaine à un public avide de savoirs, plusieurs conférences sur des thématiques variées (4). Ces dernières vont de la biologie à l’ histoire de l’ art et de la musique, en passant par la théorie des complots et leurs succès actuels. Toutefois, malgré ces enseignements et leur demi-siècle d’ existence, les Uni3 ne se sont pas vues intégrées dans la récente Loi sur la formation continue (LFCo). Elles ne bénéficient donc toujours pas d’ un réel soutien financier comme les autres institutions de formation et sont donc limitées dans leur accueil et leurs offres pour les adultes aînés.
Comme l’ expliquent Farinaz Fassa et Gabriel Noble de l’ Université de Lausanne, c’ est la preuve de l’ absence d’ une vision globale de la formation en Suisse. Après l’ analyse de la LFCo, ces chercheurs dénoncent une instrumentalisation économisciste et professionnelle de la notion de formation tout au long de la vie. Privilégiant une responsabilité individuelle, la Loi sur la Formation Continue de 2017 diminue en effet le rôle des pouvoirs publics. « L’ idéal éducatif et citoyen d’ un apprentissage pour tous la vie durant […] s’ est vue supplantée par la réussite, voire la survie professionnelle et individuelle » (4) concluent les deux chercheurs.
Face à cette réduction économisciste des savoirs et de la formation, Martine Ruchat, historienne de l’ éducation et Benoit Gaillard explorent, chacun à leur manière, la richesse et l’ utilité des rencontres intergénérationnelles. L’ historienne souligne les bienfaits de ce qu’ elle nomme la Gérontagogie (5). Ce n’ est plus « un inventaire de recettes, mais bien des démarches apprenantes pour maintenir le plus possible vivantes les connaissances, la capacité et les projets, ensemble » (6). S’ appuyant sur les travaux réalisés par ses étudiants, elle fait voir que le récit intergénérationnel devient le lieu d’ une rencontre entre générations et favorise la création d’ un sentiment d’ infini.
Benoit Gaillard, quant à lui, pointe au travers de son expérience personnelle, l’ importance de la qualité relationnelle dans les liens intergénérationnels, remède puissant contre un certain âgisme ambiant qui mine plus d’ un retraité et dont les conséquences sont parfois catastrophiques. Il n’ est plus question ici d’ apprentissage ou de formation stricto sensu, mais de co-apprentissage et de co-formation.
Devançant nos doutes, Jacques Lanarès, neuropsychologue, balaie l’ image un brin désuet du retraité ou de la retraitée aux capacités mnésiques déficientes, assistant depuis son banc à la marche du monde en spectateur et spectatrice. Il insiste sur leur souhait de rester des acteurs et actrices de leur quotidien et de leur apprentissage continu. Criant haro sur les idées reçues et autres stéréotypes concernant les capacités intellectuelles des adultes aînés, il esquisse les « quelques précautions » qu’ il suffirait de prendre pour leur restituer la direction de leur vie.
Prenant le relais, le spécialiste de la maladie d’ Alzheimer, Yves Dunant, nous rappelle que face aux maladies neurodégénératives, la prévention première consiste à « faire fonctionner ses neurones » (7). Mobilisant pour son argumentaire le célèbre exemple de Sœur Mary, morte à 101,7 ans avec une complète maîtrise intellectuelle, l’ auteur insiste sur le risque d’ une médicalisation abusive et d’ une compréhension encore partielle des mécanismes neurologiques en jeu. En spécialiste, il plaide ainsi pour que chaque adulte ait la possibilité de constituer une réserve cognitive, au même titre que de cotiser à l’ AVS.
Pour conclure ce volet médical, Roger Darioli, lui aussi médecin et spécialiste en prévention cardiovasculaire, rappelle l’ importance centrale de la santé comme ressource première pour le quotidien de chacun et chacune. Exit la vision de la santé comme une absence de maladie. Il précise, recherche scientifique à l’ appui, que la formation à la santé d’ une personne contribue à terme à 50 % de la qualité de cette dernière. Il plaide pour une vision préventive et non curative de la santé. Il introduit, dans « l’ optique de renforcer chez chaque individu son « pouvoir d’ agirv» afin de le rendre acteur responsable de sa santé » (8), la promotion de l’ éducation et de la formation tout au long de la vie. L’ auteur rappelle, à ce propos, que la stratégie pour un vieillissement en bonne santé de l’ OMS (2016) mentionne en 4ème objectif « l’ accès à toutes et à tous à une éducation de qualité, sur un pied d’ égalité entre hommes et femmes, et à promouvoir les possibilités d’ apprentissages tout au long de la vie » (9), et plus spécifiquement pour les personnes âgées.
Roland J. Campiche nous rappelle en fin d’ ouvrage que l’ entrée en retraite est une période charnière, et notamment en termes de sens. Loin d’ être un recul, c’ est au contraire l’ opportunité de s’ ouvrir à de nouveaux horizons, de (re-)découvrir son propre monde et les cultures qui le traversent, tout en contribuant pleinement au bien commun (par ex. garde des petits-enfants et activités associatives). Cet élan doit toutefois être soutenu par la collectivité et par la politique, mettant ainsi en pratique la théorie du don et du contre-don (10) de l’ anthropologue Marcel Mauss.
Claire comme de l’ eau de roche
Après ce tour d’ horizon, le propos est on ne peut plus clair : les auteurs appellent à une réelle concrétisation, à un niveau local et national, des discours supranationaux concernant l’ éducation et la formation. Ils militent pour la mise en place d’ une politique cohérente de formation la vie durant dont les adultes aînés, notamment, pourraient bénéficier. Leurs contributions laissent aussi entrevoir qu’ une telle réorientation serait utile à d’ autres catégories de personnes, actuellement laissés-pour-compte comme les migrants, les personnes souffrant d’ un handicap physique ou psychique important, etc. On peut regretter qu’ aucune place n’ ait été donnée dans cet ouvrage à la présentation d’ initiatives pédagogiques concrètes, comme celles permettant l’ acquisition, le maintien et la transmissions de savoirs (savoir-faire et savoir-être). Des réseaux de savoirs partagés, et autres associations, œuvrent en effet pour que le savoir – ce qui a du goût – circule le plus possible dans notre société. L’ on peut néanmoins noter que les auteurs de ce petit livre sont, pour une petite majorité d’ entre eux, des retraités. Ils font donc la preuve de la vigueur de la pensée chez les aînés qui continuent d’ apprendre.
Le renouveau des communs
Il est important de comprendre que poser la question de l’ accès à la formation des retraités, comme le fait cet ouvrage, c’ est aussi poser indirectement la question et l’ importance des communs – commons – (11) : « de ces choses qui nous sont communes » et dont notre vie quotidienne (économie comprise) ne saurait se passer. Faisant parti de ceux qui vont hériter d’ un monde en crise (crise financière et crise écologique entres autres), je nous encourage à prendre le temps de nous questionner sur ce qui rend possible notre vie quotidienne à toutes et à tous, mais aussi à protéger ces biens que nous avons en commun et à les rendre pleinement accessibles à l’ ensemble de notre collectivité. Pour moi le savoir fait partie de ces biens. Son accessibilité doit être garantie.
Assistant diplômé en sciences de l’ éducation
Institut des sciences sociales, Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis – Bureau 5525
1015 Lausanne
gabriel.noble@unil.ch
L’ auteur déclare n’ avoir aucun conflit d’ intérêt en relation avec l’ article soumis.
1. Cf. quatrième de couverture
2. Ce verbatim est attribué à Solon – philosophe grec (-640 à -558 av. notre ère). Il aurait adressé cette phrase au poète élégiaque Mimnerme de Colophon dans le cadre d’une querelle philosophique qui les opposait concernant les bienfaits (ou non) de la vieillesse.
3. Campiche, R. J., & Dunant, Y. (2018). À la retraite les cahiers au feu ? Apprendre tout au long de la vie : enjeux et défis. Lausanne : Éditons Antipodes.
4. https://wp.unil.ch/connaissance3/offre-de-cours/, consulté le 25 avril 2020.
5. Campiche & Dunant, 2018. p.101
6. Ruchat, M. (2013). De l’éducation permanente à la gérontagogie : Une éthique de la bienveillance. In D. Kern (Ed.), Formation et vieillissement. Apprendre et se former après 50 ans : Quels enjeux et quelles pertinences ?. Nancy : Presses universitaires de Nancy
7. Campiche & Dunant, 2018. p.35
8. Campiche & Dunant, 2018. P.11
9. Campiche & Dunant, 2018. p.87
10. Campiche & Dunant, 2018. p.85-86
11. Marcel Mauss (1923-1924)
12. Voir notamment Hardin, G. J. (1968). The tragedy of the commons. Science 162(3859), 1243–1248. 1968. doi:10.1126/science.162.3859.1243.Hardin, G. (2018). La tragédie des communs. Presses universitaires de France.