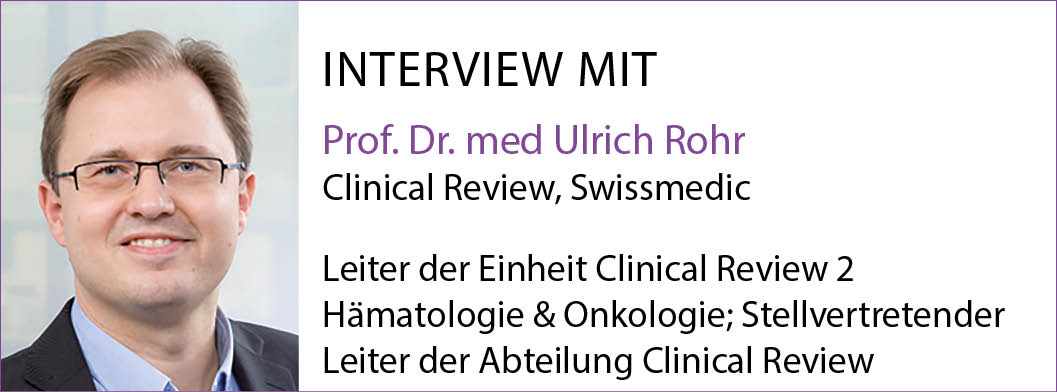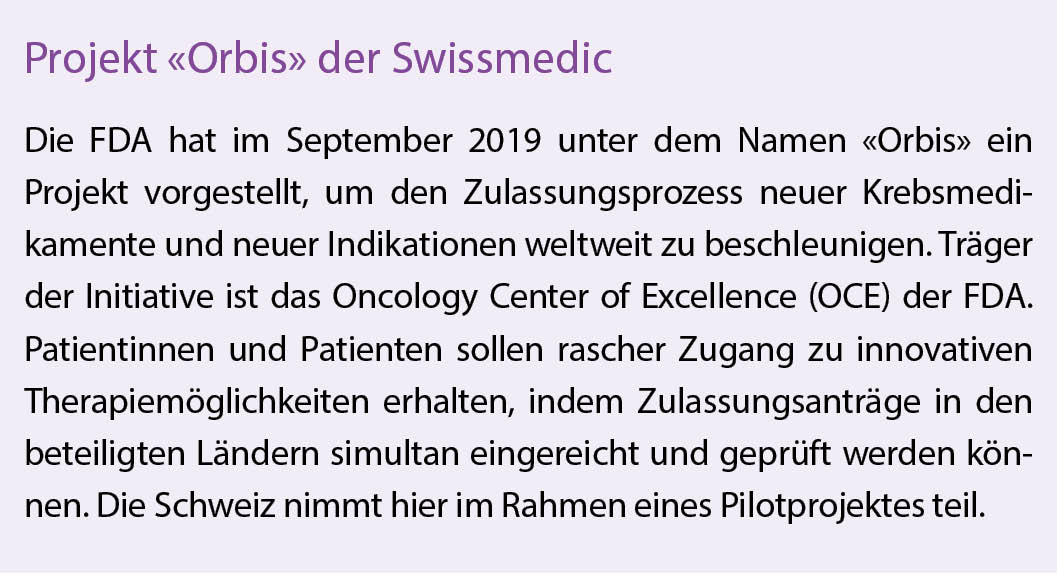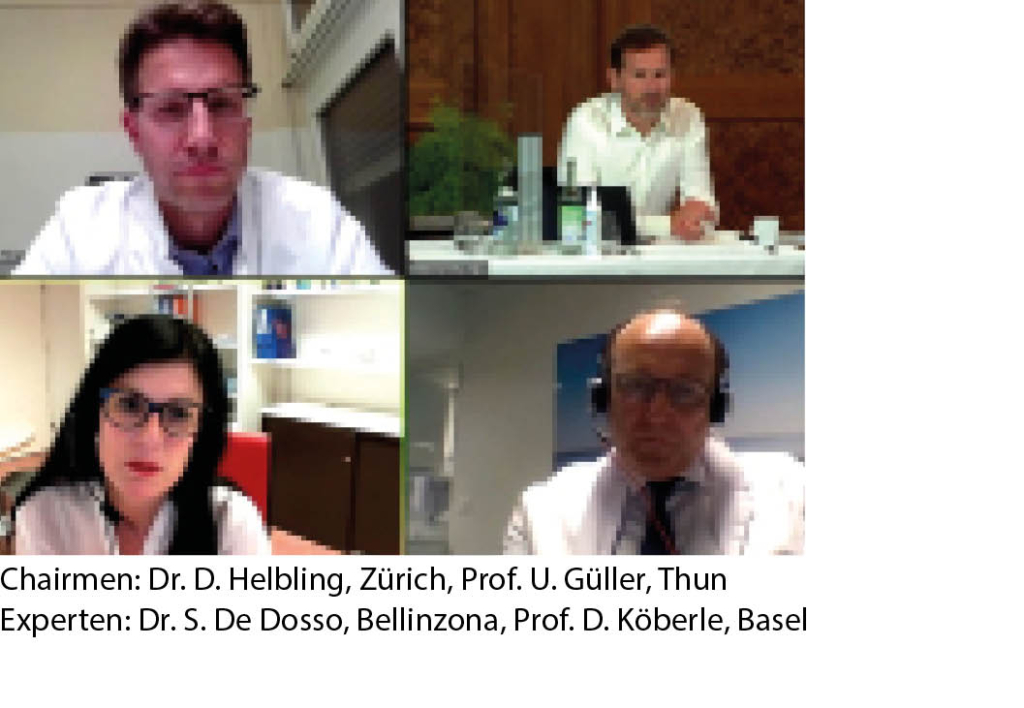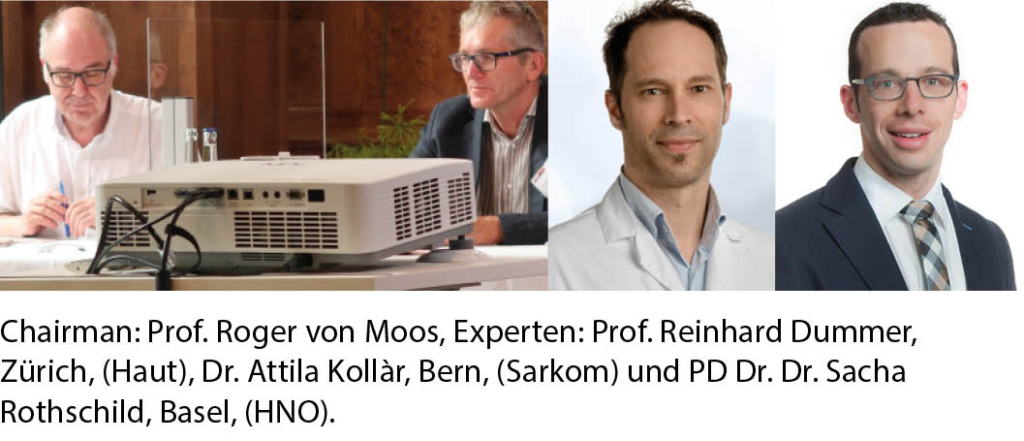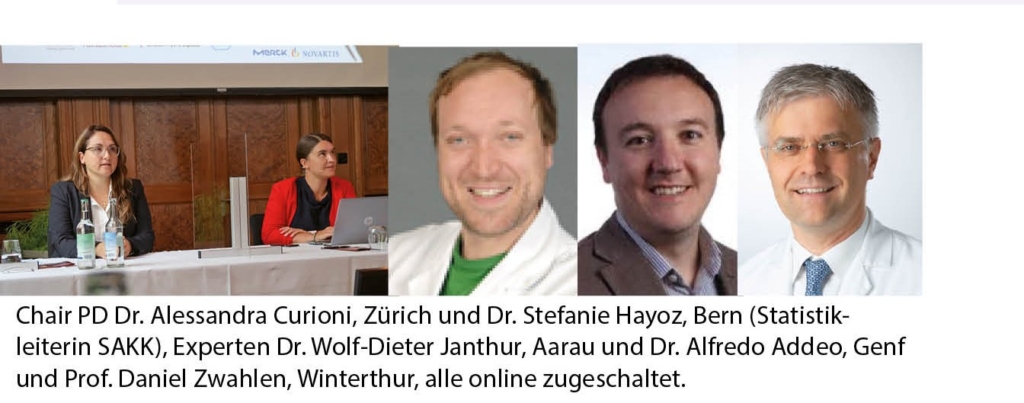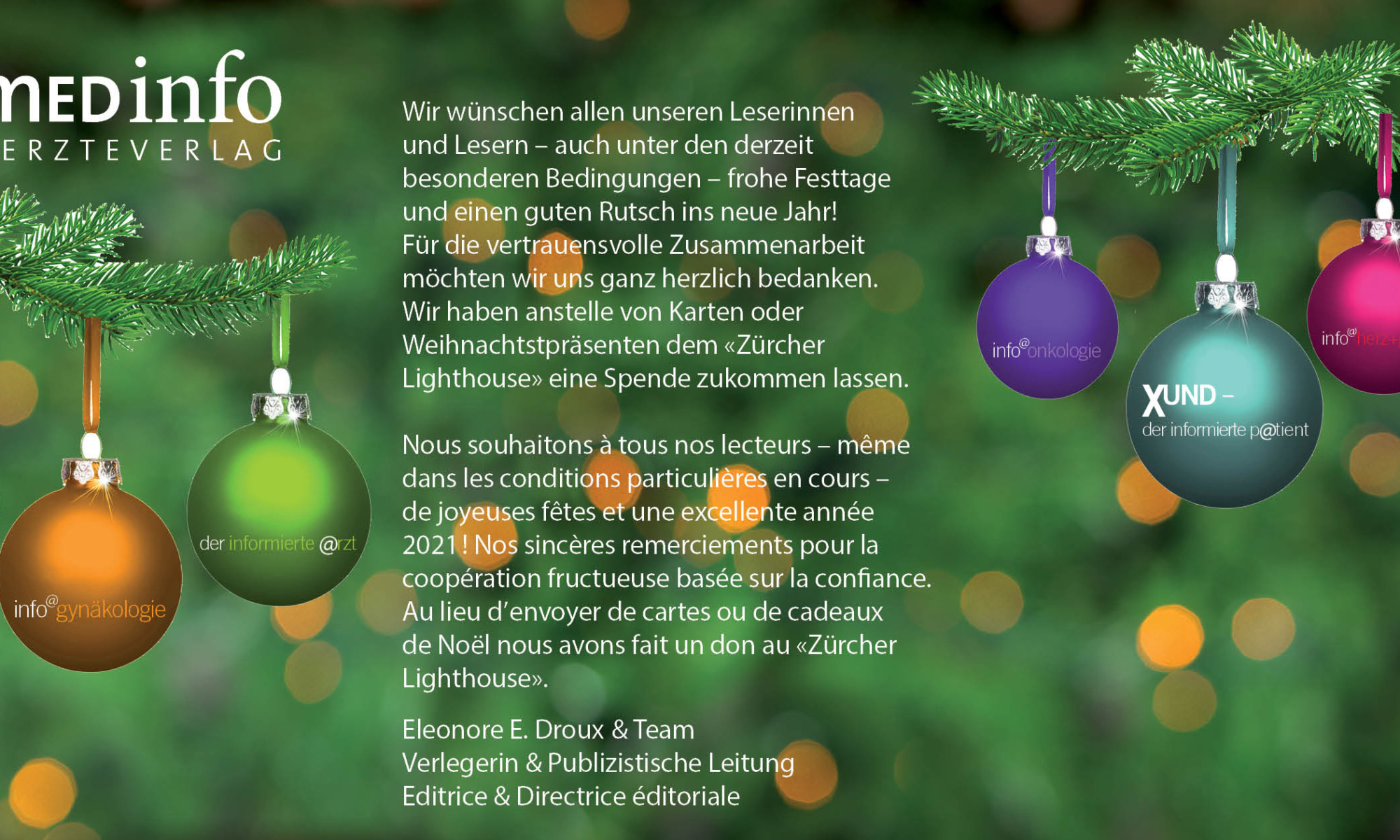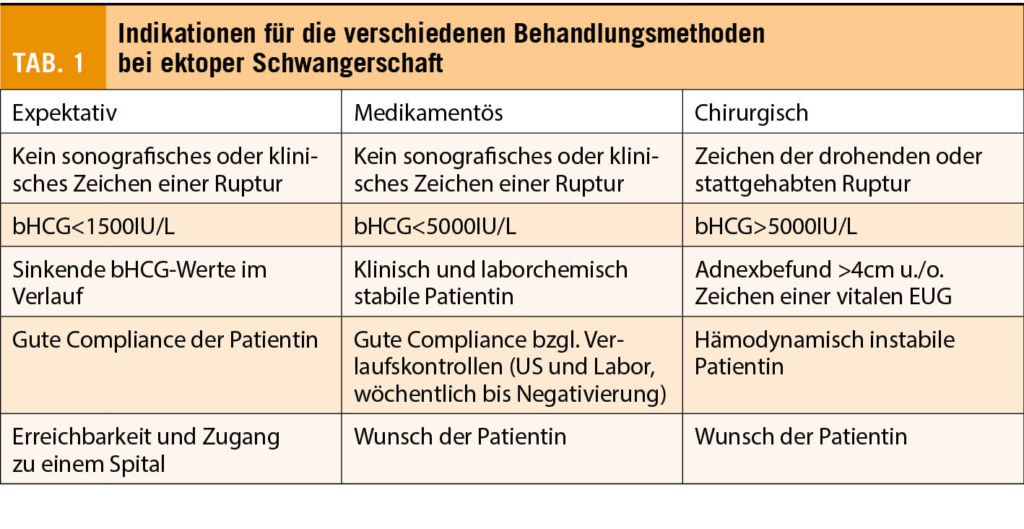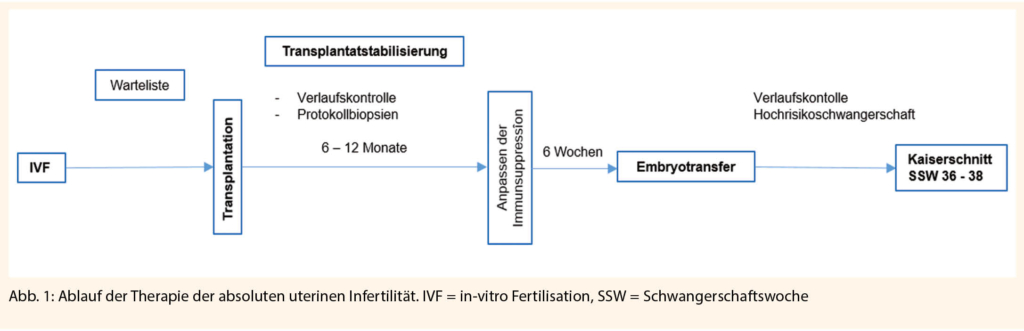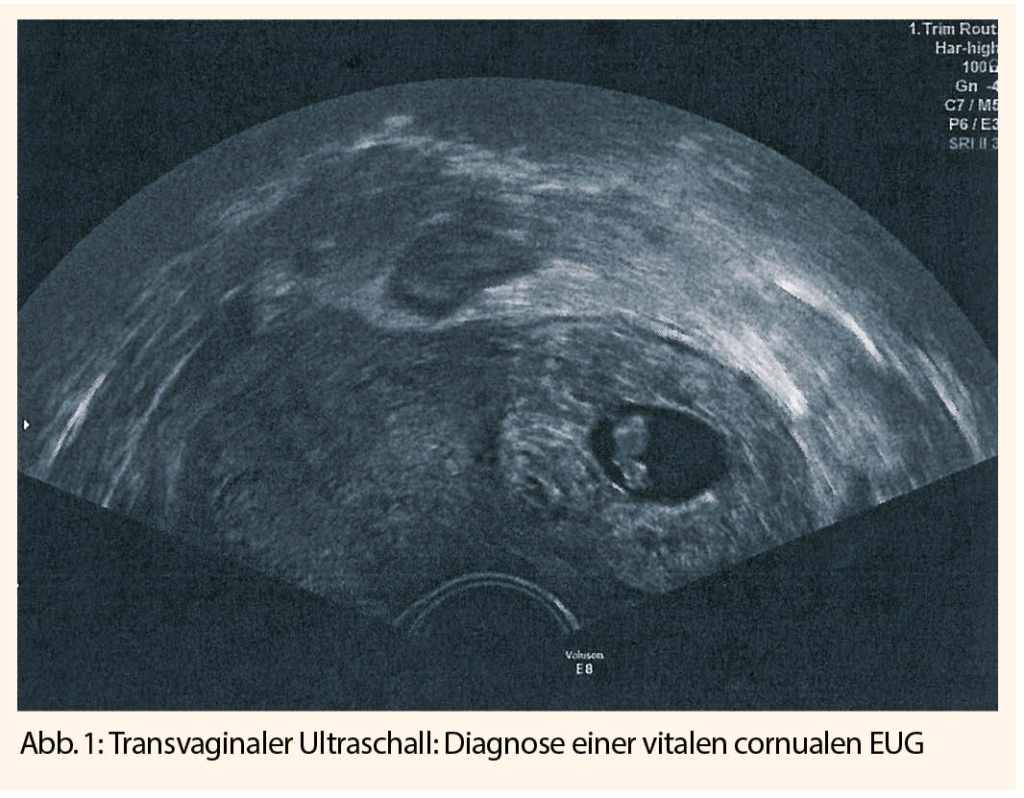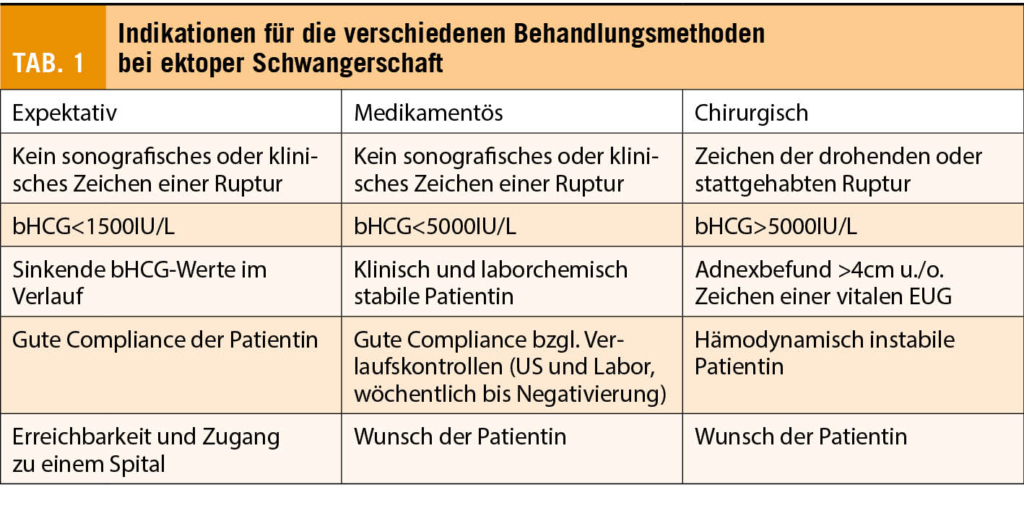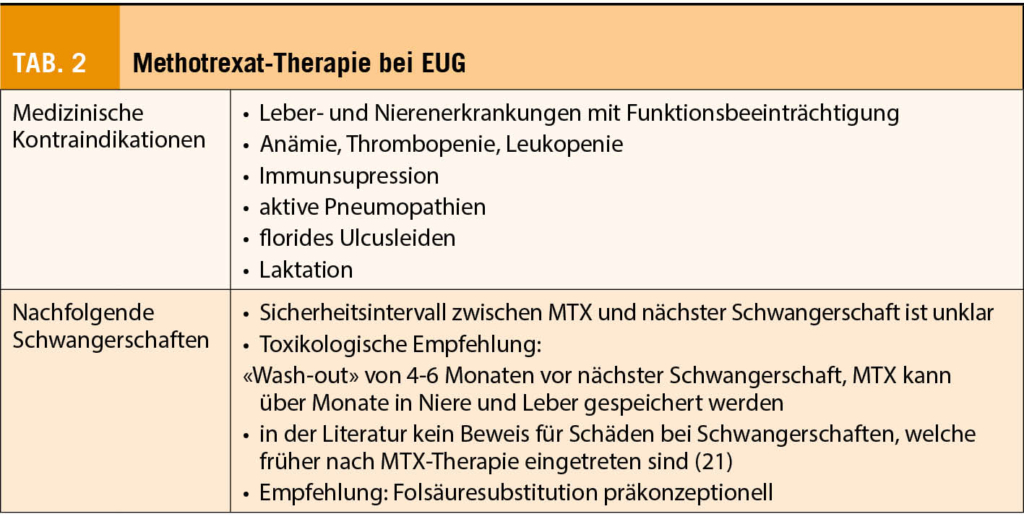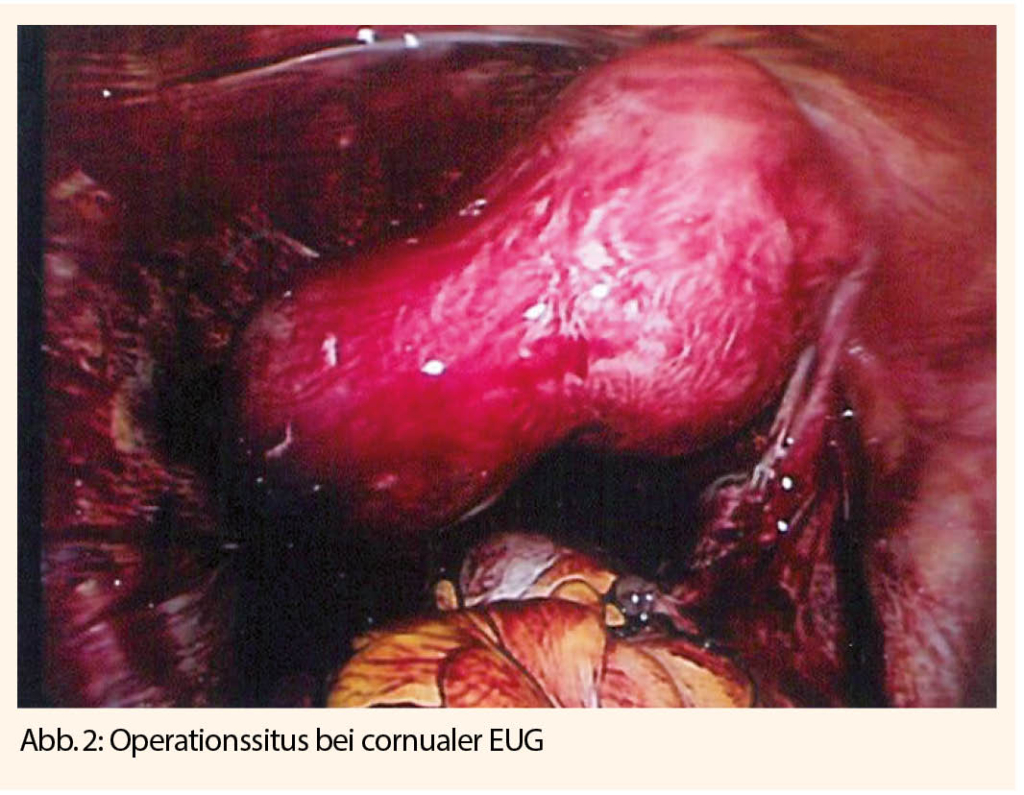Das Meeting ESMO in the Alps 2020, das gleichzeitig im Hotel Zürichberg und online stattfand, stellte eine globale Bühne für den Austausch und die Debatte herausragender translationaler Krebsforschung dar, mit ersten Ankündigungen von praxisverändernden Daten und multidisziplinären Must-have-Gesprächen, die zumindest zum Teil transformative Therapien gegen Krebs angeregt haben. Die Sessions wurden von 5 Chairmen moderiert und von 14 Experten kommentiert. Die folgende Übersicht berichtet über die Sessions I, II und IV und die präsidiale Präsentation. Die Sessions III und V wurden bereits in der ESMO-Kongresszeitung 2020 der «info@onkologie» vorgestellt.
Session I: GI Tumoren
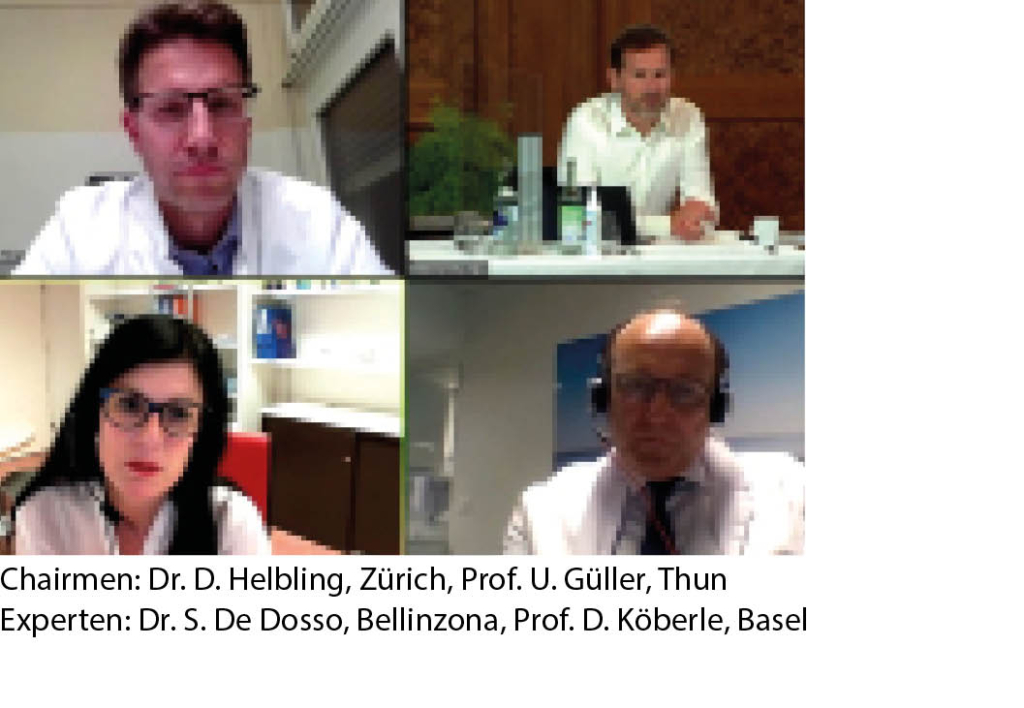
Oxaliplatin plus Fluoropyrimidine als adjuvante Therapie bei Dickdarmkrebs bei älteren Patienten: eine Subgruppenanalyse der TOSCA-Studie
Die TOSCA-Studie war Teil der IDEA-Metaanalyse, Stadium III Kolonkarzinom. Sie ist eine Phase-III-Non-Inferioritätsstudie, in der 3759 Patienten randomisiert wurden und in der die Dauer der adjuvanten Behandlung bei Kolonkarzinom untersucht wurde.
Frühere Studien legten nahe, dass die Standardbehandlungskombination von Oxaliplatin und Fluoropyrimidinen zur adjuvanten Therapie von Dickdarmkrebs im Stadium III einen verringerten Nutzen für Patienten über 70 Jahre zeigte.
Ziele und Endpunkt der nun von Dr. Sara Lonardi, Padova, präsentierten Ergebnisse waren die Untersuchung des Einflusses des Alters (<70 vs. ≥ 70-jährig) unabhängig vom Randomisierungsarm auf die Wirksamkeit von Oxaliplatin-basierter Therapie bei Patienten mit Kolonkarzinom im Stadium III, die an der TOSCA-Studie teilnahmen und die Beurteilung der Behandlungscompliance.
In der Studie konnte keine Non-Inferiorität von 3 gegenüber 6 Monaten Behandlung gegenüber der vordefinierten Marge von 20% relativer Zunahme gezeigt werden. Es wurde jedoch eine qualitative, nicht statistisch signifikante Wechselwirkung zwischen Behandlungsschema und Behandlungsdauer beobachtet: Bei CAPOX waren 3 Monate so gut wie 6 Monate; bei FOLFOX ergaben 6 Monate einen zusätzlichen Nutzen.
Die Ergebnisse der TOSCA-Studie stimmten mit denen der gepoolten Analyse IDEA bei mehr als 12800 Patienten, die in 6 Studien eingeschlossen waren, überein. Bei älteren Menschen wurde ein höherer Anteil von Rückfällen beobachtet als bei den unter 70-Jährigen (24,2% vs. 20,3%, p=0,033).
Die multivariate Analyse des rückfallfreien Intervalls deutete jedoch keinen statistisch signifikanten Alterseffekt an (HR 1,19, 95%CI 0,98-1,44, p=0,082). Unterschiedliche prognostische Faktoren und möglicherweise eine verringerte Compliance könnten dafür verantwortlich sein, dass bei älteren Menschen eine leichte Verringerung des Nutzens einer Chemotherapie beobachtet wurde.
Stellungnahme der Experten
Sollte man eine Doublettchemotherapie bei (>70 Jahre) Patienten mit Kolonkarzinom Stadium 3 geben? Die Diskussion unter den Experten ergab einhellig, dass die Schlussfolgerungen nicht korrekt sind und dass die Studie die gestellten Fragen nicht konklusiv beantworten konnte. Die Patienten wurden zu einer Dublettchemotherapie selektioniert. Zur Frage der Dublettchemotherapie müssten Patienten mit Dublettchemotherapie gegen eine Monotherapie randomisiert werden. Die Dublettchemotherapie ist höchstens für sehr fitte Patienten, die älter als 70 Jahre alt sind, geeignet.
Wirkung von 5 Jahren Bildgebung und CEA-Follow-up zur Erkennung eines Wiederauftretens von Darmkrebs in PRODIGE 13
Die intensive Nachsorge von Patienten nach kurativer Operation bei kolorektalem Karznom wird von verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften empfohlen. Diese Empfehlungen basieren hauptsächlich auf Expertenmeinungen, und die Ergebnisse der wenigen durchgeführten klinischen Studien sind umstritten. Zudem konnte kein Überlebensvorteil nachgewiesen werden.
Die von Prof. Côme Lepage, Dijon, vorgestellte Studie PRODIGE 13 ist eine prospektive, multizentrische, kontrollierte Studie, die durch doppelte Randomisierung die Auswirkungen 1. einer intensiven radiologischen Überwachung (CT-Scan/6m) im Vergleich zu einer Standardüberwachung (abdomineller Ultraschall/3m und Thoraxröntgen/6m) und 2. einer CEA-Bewertung im Vergleich zu keiner, bei der Nachbeobachtung von reseziertem kolorektalem Karzinom im Stadium II oder III ohne Anzeichen einer Resterkrankung bei der postoperativen Untersuchung bewertet. Die Ziele waren Verbesserung des Überlebens durch Nachweis von Wiederauftreten und/oder metachronen Krebsarten. Die Methoden umfassten körperliche Untersuchung, Biologie (CEA), Bildgebung: Thoraxröntgen, abdominaler Ultraschall, CT-Scan, Koloskopie. Es sollte bestimmt werden, welche Untersuchungen durchgeführt werden sollten und was die optimale Häufigkeit für die Rezidivüberwachung ist.
Die Studie zeigte für keinen der Überwachungsarme einen Unterschied hinsichtlich OS. Beim Kolonkarzinom zeigen die vorläufigen Ergebnisse, dass die Überwachung mittels CEA+/CT-Scan zu einer Zunahme der kurativen Resektionen führt. Dies hat aber keinen Einfluss auf das Gesamtüberleben. Die Richtlinien für die Überwachung des kolorektalen Karzinoms nach kurativer Resektion sollten geändert werden.
Der neue Standard könnte lauten: Regelmässige semiologische Untersuchungen von Patienten mit Hilfe von Ultraschall und Thorax-Röntgen. Die CEA-Überwachung ist nutzlos. CT-Scans sollten nur bei Verdacht auf ein Rezidiv durchgeführt werden (klinisch + / – Bildgebung). Weitere Entwicklungen dieser Studie sind bereits im Gange (Immunkontextur, cDNA, Heat Shock Proteine, neue anatomische Pathologie-Parameter. Die endgültige Analyse der sekundären Endpunkte wird 2021 verfügbar sein.
Stellungnahme der Experten
Die Experten sind sich einig, dass dies eine sehr gute und wichtige Studie ist. Die Resultate sind in Kontrast mit den Empfehlungen der SGG, die eine häufigere Kontrolle empfehlen. Manche Patienten wünschen zudem eine engmaschige Kontrolle. Der Expertenkonsens ist, dass die SGG-Guidelines revidiert werden sollten. Ein Risiko-adaptierter Follow-up der Guidelines wäre hilfreich.
Avelumab plus Cetuximab bei vorbehandelten RAS Wildtyp metastasierenden Patienten mit kolorektalem Karzinom als Rechallenge-Strategie: Die Phase II Studie CAVE /Cetuximab AVElumab) bei metastatischem KRK
Die Antikörper-abgängige Zellzytotoxizität (ADCC) wird durch monoklonale IgG1-Antikörper wie beispielsweise Cetuximab verstärkt und kann sowohl die angeborene wie die erworbene Immunantwort aktivieren. Die Induktion von ADCC in der Tumorumgebung könnte eine signifikante Rolle in der Verstärkung der Antitumor-Aktivität der Kombination spielen. Präklinische und klinische Evidenz zeigen, dass die Behandlung mit Cetuximab plus Avelumab bei NSCLC-Zelllinien in vitro selektiv ADCC induziert und Antitumoraktivität aufweist. Die Aktivierung der durch NK-Zellen getriebenen ADCC bei chemorefraktären NSCLC-Patienten wurde in einer kleinen Einzelarm-Proof of Concept-Studie vorhergesagt.
CAVE Colon ist eine einarmige, multizentrische Phase-II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit von Avelumab und Cetuximab bei vorbehandelten RAS WT-Patienten mit metastatischem Kolonkarzinom. Sie wurde von Dr. Erika Martinelli, Neapel, vorgestellt. Die Resultate der CAVE-Studie ergeben die erste klinische Evidenz, dass die Behandlung mit Cetuximab plus Avelumab als Rechallenge-Strategie effektiv ist, gut toleriert wird und bei vorbehandelten chemorefraktären RAS Wildtype-Patienten mit metastatischem Kolonkarzinom effektiv ist. Dieses Chemotherapie-freie Regime ist im Vergleich zu den derzeitigen Standarddrittlinientherapien in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit vorteilhaft.
Stellungnahme der Experten
Ansprechraten ungefähr 10%. Die Kombination ist nicht sehr effektiv. Die Meinung ist geteilt, DK ist nicht so negativ. Er setzt diese Kombination bei gewissen Patienten ein. Die Flüssigbiopsie, die in der Studie zum Nachweis einer RAS-Mutation verwendet wurde, wird empfohlen, um einer nutzlosen Therapie vorzubeugen. Insgesamt zeigen sich die Experten von den Studienresultaten eher enttäuscht.
Hepatische transarterielle Infusionschemotherapie (TACE) mit Oxaliplatin, Fluorouracil und Leucovorin versus transarterielle Chemoembolisierung bei inoperablem hepatozellulärem Karzinom (HCC)
Studienrationale: Chemoembolisation ist der Behandlungsstandard für Leberzellkarzinom im intermediären Stadium. Die Wirksamkeit von TACE auf grosse Leberzellkarzinome ist bei weitem nicht zufriedenstellend. Die Krankheitskontrollrate betrug in früheren Studien nur 50% und die mittlere Überlebenszeit nur 9-13 Monate. Die frühere Phase-II-Studie der Autoren deutete darauf hin, dass hepatische arterielle Infusionschemotherapie (HAIC) mit Oxaliplatin, Fluorouracil und Leucovorin (FOLFOX) ein signifikant besseres Therapieansprechen als TACE hat. Nun berichtete Dr. Ming Shi, Guangzhou, China, über Resultate einer Phase-III-Studie mit HAIC FOLFOX vs. TACE bei Patienten mit unresezierbarem HCC.
HAIC scheint eine höhere Wirksamkeit und Sicherheit im Vergleich zu TACE bei unresezierbarem HCC zu haben. HAIC mit FOLFOX verbesserte das OS signifikant im Vergleich zu TACE (23,1 vs. 16,07 Monate). HAIC mit FOLFOX erzielte signifikante Verbesserung in PFS und ORR und ergab weniger schwere unerwünschte Ereignisse als TACE.
Stellungnahme der Experten
Dies ist eine neue Behandlungsstrategie, die in China durchgeführt wurde und bestätigt werden muss. Die Resultate sind eher mager mit einem OS von 16 auf 24 Monate und einem ebenso kurzen PFS. TACE ist in unserer Region das Standardverfahren. Mit HAIC gibt es noch wenig Erfahrung. Es kam eine ungewöhnliche Zusammensetzung in TACE mit einer Mischung von Lobaplatin plus Epirubicin plus Lipiodol zur Anwendung, die hier nicht verwendet wird. TACE bleibt Standard of Care. Es wurden viele schlechte Resultate mit HAIC gesehen. Die Studie wird als nicht praxisändernd für unsere Länder beurteilt.
Metastatisches duktales Pankreaskarzinom:
Phase-II-Studie mit Gemcitabin und Nab-Paclitaxel vs. Gem, Nab-P, Durvalumab (D) und Tremelimumab (T) als 1st-Line-Therapie der Canadian Cancer Trial Group PA.7
Gemcitabine (Gem) + Nab-Paclitaxel (Nab-P) und FOLFIRINOX stellen die Standard-1st-Line-Therapieoption bei metastatischem duktalem Pankreaskarzinom (mPDAC) dar. Die Immuncheckpoint-Blockade hat bei mPDAC minimale Aktivität ausserhalb des dMMR-Settings gezeigt. Die Mechanismen der Immunresistenz könnten krebsassoziierte Fibroblasten und andere Tumormikroumgebungsfaktoren, die durch GEM + Nab-P vermindert sind, beinhalten.
Durvalumab ist ein selektiver IgG1 monoklonaler Antikörper gegen PD-L1. Tremelimumab ist ein selektiver Antikörper gegen CTLA-4. Eine Phase-Ib-Studie zeigte, dass Darvulumab und Tremelimumab sicher kombiniert werden können.
Der Sicherheits-Run-in von 11 Patienten mit mPDAC, die GEM+Nab-P + D + T erhielten, zeigte keine Toxizität.
Die Zugabe von Durvalumab und Tremelimumab zu Gemcitabin und Nab-Paclitaxel ergab keine signifikante Verbesserung des OS, PFS oder der ORR. Es zeigte sich ein Trend zu verbesserter DCR im experimentellen Arm. Es sind weitere Studien zur Untersuchung von Biomarkern unterwegs, die die Immunsensitivität in diesem Setting voraussagen können, berichtete Dr. Daniel Renaud, Vancouver, der die Studie vorstellte.
Stellungnahme der Experten
Die Experten befanden, dass es eine wichtige Studie ist, die aber negativ ausfiel. Es läuft derzeit nicht viel bezüglich Immuntherapie beim Pankreaskarzinom, obschon sich alle Patienten mit Pankreaskarzinom für eine Immuntherapie interessieren, wird festgestellt. Es wird aber betont, dass den Patienten erklärt werden muss, dass Immuncheck-inhibitoren beim Pankreaskarzinom keinen Stellenwert haben.
Session II: Sarkome, Varia (Haut-, ZNS-Tumoren, COVID-19)
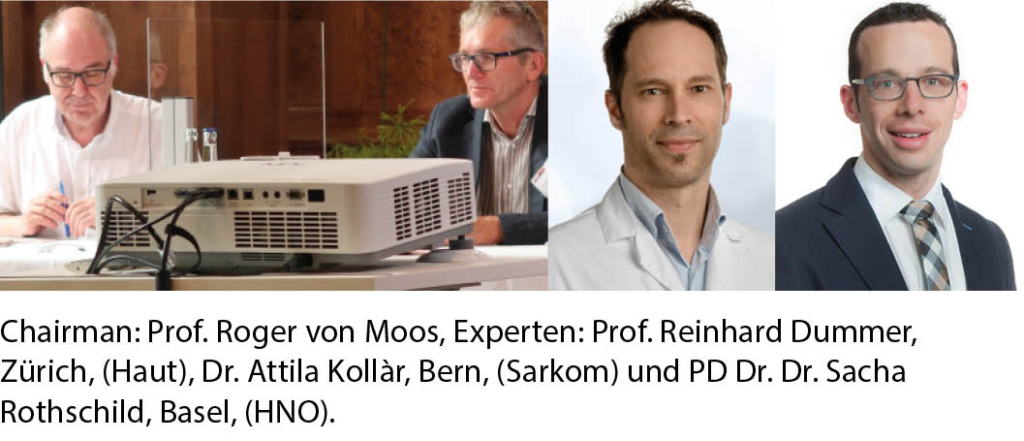
Die vier Studien JAVELIN Head and Neck, PembroRad (GORTEC), IMCISION und Xevinapant (DEBIO 1143) wurden von PD Dr. Dr. Sacha Rothschild zur Diskussion ausgewählt.
In JAVELIN-Phase 3 Head and Neck 100 zeigte der Vergleich von Avelumab plus Chemoradiotherapie (CRT) gefolgt von Avelumab-Erhaltungs- vs. CRT bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Plattenepithelzellkarzinom von Kopf und Hals (LA-SCCHN) in der Interimsanalyse keine signifikante Verbesserung durch die Zugabe von Avelumab, wie Dr. Ezra E. Cohen, La Jolla, USA berichtete. Hochdosierte Cisplatin-basierte CRT ist die derzeitige Standardtherapie bei unresezierbarem LA-SCCHN. Anti-PD-1 Immuncheckpoint-Inhibitoren haben sich als effektiv für die Behandlung von wiederkehrenden und/oder metastatischen SCCHN erwiesen. Die Daten über die Verwendung von Immuncheckpoint-Inhibitoren sind aber bei LA-SCCHN limitiert. Avelumab, ein anti-PD-L1 Immuncheckpoint-Inhibitor hat Antitumoraktivität gezeigt und hatte ein annehmbares Sicherheitsprofil bei einer Vielzahl von soliden Tumoren, inklusive wiederkehrende und/oder metastatische SCCHN. Die Autoren stellten die Hypothese auf, dass Avelumab mit CRT das Outcome bei Patienten mit
LA-SCCHN verbessern könnten.
Javelin Head and Neck 100 ist die erste randomisierte Phase-III-Studie mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor, kombiniert mit CRT bei irgendeinem Tumortyp. Die Studie wurde wegen Nutzlosigkeit gestoppt. Avelumab + CRT gefolgt von Avelumab-Erhaltungstherapie verbesserte das PFS nicht signifikant im Vergleich zu Placebo + CRT gefolgt von Erhaltungstherapie. Die CRT-Exposition war konsistent zwischen den Avelumab- und Placeboarmen, ein höherer Anteil Medikamenten-assoziierter unerwünschter Nebeneffekte von Grad 3/4 kamen im Avelumab-Arm (80%) vs. Placebo (74%) vor. Auf Grund der exploratorischen Analyse begünstigte die beobachtete Hazard Ratio für PFS numerisch Avelumab +CRT bei PD-L-1 starken Tumoren. In Anbetracht der starken Begründung, einen Immuncheckpoint-Inhibitor zu CRT in LA-SCCHN zu geben, war das Ausbleiben einer Verbesserung im PFS durch die Zugabe von Avelumab zur CRT unerwartet.
Eine Analyse zum besseren Verständnis dieser Resultate ist am Laufen. Diese Daten werden dazu beitragen, über das Design laufender und zukünftiger Studien zur Kombination von Immuncheckpoint-Inhibitoren und Strahlentherapie +/- Chemotherapie zu informieren. Künftige Studien könnten sequentielle vs. gleichzeitige Behandlungen, fraktionierte Radiotherapie plus anti-PD-1/PD-L1-Therapien oder Biomarker bestimmte Subgruppen untersuchen.
Stellungnahme der Experten
Die Daten sind unerwartet. In einer zweiten, auch am ESMO vorgestellten Studie PembroRad/GORTEC 2015-01, wurden die Resultate bestätigt. In dieser Studie wurde Cetuximab + Radiotherapie mit Pembrolizumab + Radiotherapie bei für Cisplatin unfitten Patienten (wegen Niereninsuffizienz) verglichen. Das primäre Outcome (lokale regionale Kontrolle, PFS und OS) war in dieser Studie ebenfalls negativ. Immuncheckpoint-Inhibitoren spielen demnach keine Rolle im Zusammenhang mit Radiochemotherapie oder Radiotherapie im kurativen Setting. Eine Subgruppe von Patienten mit hoher PD-L-1 Expression scheinen einen gewissen Benefit zu haben. PD-L-1 ist aber variabel und kann durch die Radiotherapie beeinflusst werden. Die Resultate sollten jedenfalls mit Vorsicht beurteilt werden. Eine weitere Studie zu diesem Thema ist Keynote-412, mit einem ähnlichen Design wie JAVELIN. Die entsprechenden Resultate sind aber noch nicht verfügbar, so Rothschild. Er erwähnte ferner die Phase-I/II-Studie IMCISION. In einer Phase I wurden im Arm A 6 Patienten mit Nivolumab vor der Chirurgie behandelt, im Arm B mit Novolumab + Ipilimumab, gefolgt von Nivolumab und darauf Chirurgie. Die Studie war nicht randomisiert, obschon es den Anschein macht. Nivolumab mit/ohne Ipilimumab induzierte bei 31% (beinahe) komplettes Ansprechen mit überlegenem RFS nach 14 Monate Follow-up. Die Resultate wurden als zumindest nicht inferior beurteilt. Die Statistikerin hielt dagegen, dass bei einer als superior definierten Studie die Resultate, auch wenn sie keinen Unterschied zwischen den Therapien zeigen, nicht als nicht inferior bezeichnet werden dürfen.
Gleichzeitige hochdosierte Cisplatin-Chemobestrahlung plus Xevinapant oder Placebo bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinomen: 3 Jahre Follow-up
Xevinapant ist ein neues Medikament mit dem neuartigen Mechanismus der Inhibition der Apoptose. Eine Phase-II-Studie zum Vergleich von Xevinapant plus hochdosierte Cisplatin-Therapie mit Placebo plus hochdosierte Cisplatin-Therapie bei LA-SCCHN wurde von Prof. Jean Bourhis, Lausanne vorgestellt.
≥50% der LA-SCCHN-Patienten werden einen Rückfall der Krankheit erfahren. Starke Raucher und HPV-negative OPC-Patienten haben eine schlechte Prognose und stellen ein unerfülltes Bedürfnis dar. Resistenz für Radiotherapie bleibt ein Hauptgrund für schlechte Überlebensraten. Apoptoseproteininhibitoren können die Apoptose negativ regulieren und die Immunantwort modulieren. Sie sind in einer Vielzahl von Tumoren inklusive SCCHN überexprimiert. Xevinapant ist ein neuer, oral verfügbarer Apoptoseproteininhibitor, welcher Chemo/Radio-Sensibilisierungseigenschaften bei SCCHN-Modellen gezeigt hat. Die Studie zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung im OS (HR 0,49; 0,25-0,92. p=0,026). Das mediane OS wurde im Xevinapant-Arm noch nicht erreicht. Der auf 5-Jahre verlängerte OS-Follow-up ist noch am Laufen. Xevinapant zeigte eine klinisch überzeugende PFS-Verbesserung (HR 0,34;0,17-0,68; p=0,0023). Die Xevinapant-Zugabe ging mit einem guten Sicherheitsprofil einher, welches die CRT Gabe nicht beeinträchtigte. TrilynX, eine Phase-III-Studie zur Bestätigung, ist derzeit am Laufen.
Stellungnahme der Experten
Die Experten bestätigen, dass dies eindrucksvolle Daten mit einem sehr interessanten Medikament sind. Die Resultate ermutigen im Hinblick auf PFS mit einem signifikanten und klinisch relevanten OS-Nutzen. Es muss aber festgehalten werden, dass es eine randomisierte Phase-II-Studie ist, mit nur 50 Patienten pro Arm, und somit ist es zu früh, definitive Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Medikament ist ausserhalb von klinischen Studien noch nicht verfügbar und eine Phase-III-Studie unabdingbar. Es bleibt zu hoffen, dass diese sehr positive Phase-II-Studie es zur Phase III schaffen wird. PD Rothschild ergänzte, dass Xevinapant nicht nur ein Apoptoseinhibitor ist, sondern auch ein Induktor der Immunantwort. Es ist bestimmt ein interessanter Partner für Immuncheckpoint-Inhibitoren. Die Frage stellt sich, ob in der Tat eine Chemotherapie in Kombination mit diesem Medikament notwendig ist.
Hohe klinische Benefitraten mit Pembrolizumab als Monotherapie bei ausgewählten seltenen Sarkomhistotypen: Erste Ergebnisse der AcSé Pembrolizumab-Studie. Immuntherapie bei Sarkomen?
Das AcSé Immunotherapieprogramm wurde vom französischen Nationalen Krebsinstitut lanciert und durch das französische Netzwerk der Krebszentren gesponsert. Es ist ein landesweites Untersuchungsprogramm, das den Zugang zu Anti-PD-1-Therapien ausserhalb ihrer derzeitigen Zulassung ermöglicht.
Immuncheckpoint-Inhibitoren haben bei unausgewählten Populationen mit Sarkom nur eine begrenzte Aktivität gezeigt. Sarkome umfassen aber mehr als 150 verschiedene Erkrankungen. Das Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Pembrolizumab bei Patienten mit seltenen Sarkomsubtypen zu untersuchen.
AcSé Pembrolizumab, die von Prof. Jean-Yves Blay, Lyon, vorgestellte Studie ist eine multizentrische, einarmige Phase-II-Studie. AcSé behandelte 81 Patienten mit seltenen fortgeschrittenen Sarkomen, die bis zu 2 Jahre lang gegen eine Standardbehandlung mit Pembrolizumab resistent waren. Der primäre Endpunkt war die objektive Ansprechrate (ORR) und die sekundären Endpunkte umfassten das progressionsfreie Überleben (PFS), die Gesamtüberlebenszeit (OS), die Dauer des Ansprechens (DOR), die klinische Nutzenrate und die Sicherheit.
Das ORR betrug 15%. Das beste Ansprechen war ein Teilansprechen (PR); es gab keine Fälle vollständigen Ansprechens. Die PR-Rate unterschied sich zwischen den Histotypen, wobei die PR-Rate bei ASPS mit 35,7% am höchsten war, gefolgt von SMBT mit 33,3%, dem Epithelsarkom mit 20%, der anderen Gruppe mit 9% und dem Chordom mit 8%.
Insgesamt lag der Median des PFS bei 7,9 Monaten. Das PFS variierte auch zwischen den Histotypen (P=.013) mit einem Median von 5,7, 14, 5 und 2,7 Monaten für Patienten mit Chordom, ASPS, DSCRCT und anderen. Der Median PFS wurde bei Patienten mit SMBT nicht erreicht. Die 1-Jahres-PFS-Raten betrugen 35%, 58%, 0%, 62,5% bzw. 8%.
Das mediane OS variierte auch je nach Histologie. Es betrug 20, 7,4 und 5,4 Monate für Chordom, DSRCT und andere. Bei den anderen Histo-
typen wurde das mediane OS noch nicht erreicht. Die 1-Jahres-OS-Rate betrug 72% für Chordom, 90% für ASPS, 50% für DSCRCT, 83% für SMBT und 40% für andere.
Diese Sarkome sind nicht konsistent mit PD L-1-Expression, hoher Tumorlast, Zellinfiltraten und tertiären Lymphoidstrukturen assoziiert: die translationale Forschung zum besseren Verständnis der verschiedenen Determinanten ist im Gange.
Stellungnahme der Experten
Es wurden ungewöhnliche Tumortypen eingeschlossen. Die Antwortrate war 50%. Es gibt einige Subtypen bei denen die Immuntherapie wirken könnte, es muss aber herausgefunden werden, welche dies sind. Die PFS-Daten können nicht unbedingt verwendet werden.
TRAMUNE: Eine Phase-Ib-Studie zur Kombination von Trabectedin und Durvalumab
Trabectedin ist für Weichteilsarkom und Ovarialkarzinom zugelassen. Präklinische Daten deuten darauf hin, dass die Aktivität von Trabectedin zum Teil gegen tumorassoziierte Makrophagen gerichtet ist. Die TRAMUNE-Studie untersuchte die Sicherheit und die präliminäre Wirksamkeit der Kombination von Trabectedin mit Durvalumab bei Patienten mit unresezierbarem oder metastatischem Weichteilsarkom oder rezidiviertem Ovarialkarzinom.
Immuncheckpoint-Inhibitoren wie anti-PD1/PD-L1 haben bei Weichteilkarzinomen Aktivität gezeigt.
Die von Dr. Joseph A. Ludwig, Houston präsentierte Studie hat gezeigt, dass Trabectedin in Kombination mit Durvalumab, einem anti PD-L1, beim fortgeschrittenen metastatischen vorbehandelten Weichteilsarkom durchführbar ist. Die maximal tolerierte Dosis von Trabectedin ist 1.2mg/m2 D1 bei Gabe mit 1120mg Durvalumab D2, alle 3 Wochen. Das Sicherheitsprofil war wie erwartet mit Zytolyse und Neutropenie als häufigste unerwünschte Ereignisse des Grades 3-4.
Trabectedin plus Durvalumab zeigte vorläufige Aktivität bei einer unselektierten Population von gemischten Weichteilsarkomen. PDL1- und CD8-Expression waren niedrig = Cold Weichteilsarkom?
Baseline CD 163 positive Zelldichte war mit der Tumorschrumpfung nicht korreliert. Der Trend für ein Tumorprofil «CD8 hoch/CD 163 niedrig» bei Baseline war mit längerem PFS mit Trabectedin + Durvalumab assoziiert. Ergänzende Studien sind im Gange.
Stellungnahme der Experten
Die Resultate dieser Studie an stark vorbehandelten Patienten sind ermutigend. Sie müssen indessen in grösseren Kohorten von Patienten noch bestätigt werden.
Outcome systemischer Krebsbehandlung bei Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion: eine CCC19-Registeranalyse
Krebs und COVID-19: Krebspatienten sind anfällig für SARS-CoV-2-Infektion und nachfolgende Komplikationen: Höhere Raten an Spitaleinweisungen (bis zu 40%), schwere Atemwegserkrankungen (20%) und eine Sterblichkeit zwischen 9-30%. Eine kürzlich erfolgte Behandlung (<4 Wochen) scheint mit einer höheren Rate an Komplikationen vergesellschaftet zu sein. Wenig ist über jüngste oder mittelfristig erfolgte Behandlungen bekannt, so Dr. Trisha M. Wise-Draper, Miami, USA.
Die Autoren identifizierten in einer Kohorte von 928 Patienten mehrere Faktoren, die mit der 30-Tage-Gesamtmortalität assoziiert sind: Alter, männliches Geschlecht, früheres Rauchen, Anzahl von Komorbiditäten, niedriger ECOG und aktive Krebserkrankung. Eine kürzlich erfolgte Behandlung war mit dem Outcome nicht assoziiert.
Diese Korrelation zwischen Timing der Anti-Krebstherapie und COVID-19-bezogene Komplikationen und 30-Tage-Mortalität wurde in einer Kohorte von >3000 Patienten untersucht.
Es wurde festgestellt, dass die 30-Tage-Mortalität am höchsten bei Krebspatienten war, die 1-3 Monate vor der COVID-19-Diagnose behandelt wurden: die Gesamtmortalität betrug 28%.
Die unadjustierte 30-Tage-Mortalität war am höchsten bei denjenigen, die mit einer Chemotherapie behandelt wurden.
Die Mortalität war bei denjenigen am höchsten, die eine anti-CD20-Behandlung 1-3 Monate vor der zeitlichen Periode, in der sich eine signifikante B-Zelldepletion entwickelt, erhalten hatten.
Die Mortalität war bei denen höher, die sich einer aktiven Behandlung (mit Ausnahme der endokrinen Therapie) unterzogen hatten, im Vergleich zu den Patienten, die innerhalb eines Jahres vor der COVID-19-Diagnose unbehandelt waren.
Die Limitationen dieser Studie sind, dass sie retrospektiv mit deskriptiven Statistiken ist und einige Daten fehlen.
Stellungnahme der Experten
Diese Studie ist nicht vom diagnostischen, aber vom Behandlungsstandpunkt aus interessant. Eine Kritik war, dass alle Arten von Krebspatienten zusammengetan wurden, solche mit vielen Komorbiditäten, mit schlechter Lungenfunktion und mit den verschiedensten Behandlungen. Ein Experte beurteilte die Daten als wertlos, während ein anderer mit dieser Beurteilung gar nicht einverstanden war. Krebspatienten haben ein erhöhtes Risiko an COVID-19 zu versterben, das Risiko ist aber weniger als zweifach. Die mit Immunchemotherapie behandelten Tumore sind meist Lungentumore und mit hohem Risiko behaftet. Diese Patienten sterben an COVID-19. Die Immuntherapie allein scheint keine höhere Sterblichkeit an COVID-19 aufzuweisen. Die CD20-Daten sind von grossem Interesse. Diese Patienten sind meistens fit, im gleichen Alter (ca. 60 J.) und haben oft Lymphome. Ein hämatologischer Tumor verdreifacht das Risiko, an COVID-19 zu versterben, im Vergleich zu einem soliden Tumor. Vermutlich ist es nicht die Immunchemotherapie, die mit höherer Mortalität verbunden ist, sondern es sind die Komorbiditäten, die die mit Immunchemotherapie behandelten Patienten aufweisen. Immunchemotherapie bedeutet Lungenkrebs, so ein Experte.
Insgesamt wurde festgehalten, dass das Risiko für Mortalität wegen Krebs grösser ist als für Mortalität wegen COVID-19 und deshalb sollte die Krebstherapie aufrechterhalten werden.
Outcome und prognostische Faktoren einer SARS CoV-2-Infektion bei Krebspatienten: Eine Querschnittsstudie (SAKK 80/20 CaSA)
Kontroverse herrscht bezüglich des Outcomes von COVID-19 bei Krebspatienten. Einige Studien fanden ein schlechteres Outcome bei Krebspatienten im Vergleich zu Patienten ohne Krebs. Negative Konsequenzen der Pandemie, inkl. weniger Krebsscreening, -diagnose, -behandlung wurden festgestellt. Die Schätzung der COVID-19-Mortalität bei Krebspatienten betrug zwischen 14,6% und 36,6% (Bronchuskarzinom).
In der Studie wurde das COVID-19-Outcome bei Krebspatienten in einem von der Pandemie schwer betroffenen Land untersucht. Die Studie wurde von Prof. Dr. Dr. med. Markus Jörger, St. Gallen, präsentiert.
Die COVID-19-Mortalität bei schweizerischen Krebspatienten war höher als bei der Gesamtpopulation (17,8 vs. 5%). Eine substantielle Rate von Hospitalisationen (64,5%) und Notfalleinweisungen (12,0%) wurde festgestellt. Alter über 65 Jahre, nicht kuratives Setting und Einweisung in die Notfallstation waren starke negative prognostische Faktoren. Derzeitige und kürzliche (<3 Monate) Chemo- oder Immuntherapie beeinflusste COVID-19 nicht nachteilig (noch taten dies die Hauptkategorien von Komorbiditäten) und ein dezentrales Gesundheitssystem wie in UK oder US.
Stellungnahme der Experten
Prof. Mikos Pless, Winterthur, gratulierte allen Teilnehmern zum grossen Effort, der fortgesetzt werden soll. Es wurden widersprüchliche Daten gesehen, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist: die Krankheit und deren Status und worüber meist nicht gesprochen wird, der Wunsch des Patienten. Viele ältere Patienten wollen nicht mehr in die Notfallstation eingewiesen werden. Zudem stellt sich das Problem der Ressourcen, wie beispielsweise in Grossbritannien, wo anfänglich nicht genügend Intensivbetten zur Verfügung standen. Er wies ferner darauf hin, dass eine Pneumonitis der COVID-19-Infektion sehr ähnlich ist und oft kaum unterschieden werden kann. Das grösste Problem laut Prof. Pless ist der gemeinsame Nenner. Von welchen Patienten sprechen wir eigentlich? Er nennt dabei eine Registerstudie, die in England durchgeführt wurde (Williamson E et al. Nature 2020; 584: 430-436). Darin wurden die Primärversorgungsdaten von insgesamt 172878392 Erwachsenen pseudonym mit 10926 COVID-19-bezogenen Todesfällen in Verbindung gebracht. Es zeigte sich dabei, dass die HR 1,72 war, wenn die Krebsdiagnose vor weniger als einem Jahr erfolgte, und dass die HR auf 1,15 abnimmt, wenn die Krebsdiagnose 5 Jahre alt war. Bei hämatologischen Erkrankungen ist die HR grösser, beinahe 3, bei CD20 ist sie sehr hoch.
Insgesamt stellten die Experten fest, dass die Krebspatienten im Allgemeinen an Krebs sterben und nicht an COVID-19.
Spartalizumab plus Dabrafenib und Trametinib bei Patienten mit früher unbehandeltem BRAFV600-mutiertem unresezierbarem oder metastatischem Melanom
Dr. Paul D. Nathan, Mount Vernon Cancer Centre, UK, präsentierte die Resultate des randomisierten dritten Teils der Phase-III-COMBI i-Studie, einer multizentrischen internationalen Studie mit Beteiligung der Klinik für Dermatologie des Universitätsspitals Zürich (Prof. Reinhard Dummer).
Das Auftauchen von BRAFi- und MEKi-gerichteten Therapien zusammen mit Checkpoint-Blockade hat die Behandlung des metastatischen Melanoms geändert. Trotz dieser Fortschritte erleiden viele Patienten eine Krankheitsprogression und neue Strategien sind notwendig.
COMBI-i ist eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase-III-Studie, die den anti-PD1-Antikörper Spartalizumab plus Dabrafenib und Trametinib (Sparta-DabTram) vs. Placebo-DabTram untersuchte. Über die Resultate der Sicherheits-Run-in-Phase (Teil 1; N=9) und die Biomarker-Kohorte (Teil 2; N=27) wurde früher berichtet. Der dritte Teil von COMBI-i verfehlte den primären Endpunkt und Spart-DabTram verbesserte das Untersucher-bewertete PFS im Vergleich zu Placebo DabTram nicht signifikant. Die HR betrug 0,820 (p=0,042, einseitig) entsprechend einem medianen PFS von 16,2 Monaten bei Patienten, die mit Sparta-DabTram behandelt wurden vs. 12.0 Monate bei solchen, die Placebo-DabTram erhielten. Der Kontrollarm schnitt besser ab als erwartet.
Obschon das OS nicht formell untersucht wurde, war eine HR von 0,785 zu Gunsten von Sparta-DabTram zu beobachten und das mediane Überleben wurde in keinem der beiden Behandlungsarme erreicht.
Eine grössere Anzahl von Dosisänderungen (Reduktionen/Unterbrüche) und Abbrüchen wurden bei mit Sparta-DabTram behandelten Patienten beobachtet, was auf eine erhöhte Toxizität hinweist.
Zusätzliche Analysen sind am Laufen und für ein besseres Verständnis dieser Resultate geplant. Der weitere Überlebens-Follow-up könnte zusätzliche Einblicke vermitteln.
Stellungnahme der Experten
Warum erreichte die Studie das Ziel nicht? Die Patientenselektion und die Dosierung waren nicht optimal. Zu viele Patienten mit guter Prognose. Diese Art von Therapie sollte bei Hochrisikopatienten angewendet werden. Die Patienten im DabTram-Arm zeigten eine gute Performance, was schwierig zu toppen ist. Zudem gab es Dosierungsprobleme. Wenn eine Dosis reduziert wurde, konnte sie nicht wieder erhöht werden, was unter Umständen äusserst ungünstig war. So wurde konstant unterdosiert. Unterdosierung mit Kinaseinhibitoren ist indessen schlecht. Eine Diskussion zur Statistik ergab, dass immer mehr einseitige Tests zur Anwendung kommen. Dr. Hayoz stellt fest, dass einseitige Tests bei Vergleichen mit Placebo angewandt werden können und dass bei der Untersuchung zweier Behandlungsmethoden zweiseitige Tests zur Anwendung kommen sollten.
Phase-II-Studie SECOMBIT (SEquential COMbo Immuno und gezielte Therapie Studie): Erster Bericht über Wirksamkeit und Sicherheit
Gezielte Therapie (TT) und Immunotherapie (IO) revolutionierten die Behandlung von Patienten mit metastatischem Melanom. Dank der Immuntherapie (anti-PD-1s ± anti CTLA-4) und BRAF/MEK-Inhibitoren können bei mehr als 50% der MM-Patienten einen Langzeitnutzen erreichen. Es herrscht indessen kein Konsens über die richtige Sequenz zwischen gezielter Therapie und Immuntherapie und es gibt nur retrospektive Analysen ohne Daten von randomisierten kontrollierten Studien. Derzeit ist die Wahl der Behandlung eher durch die Patientencharakteristik geprägt als durch die Evidenz von Studien zur Sequenz. Secombit, eine Phase-II–Studie, randomisierte Patienten mit behandlungsnaivem BRAFV600E/K-mutiertem fortgeschrittenem Melanom zu BRAF-Inhibitor Dabrafenib und dem MEK-Inhibitor Trametinib zusammen mit dem PD-1-blockierenden Antikörper Pembrolizumab (Triplett; n = 60) oder zu Placebo (Dublett; n = 60).
69 Patienten wurden in Arm A (Combo T, Encorafenib, Binimetinib, 71 in Arm B (Combo I, Ipilimumab, Nivolumab) und 69 in Arm C (Sandwich Encorafenib Binimetinib) während 8 Wochen behandelt. Prof. Paolo Antonio Ascierto, Neapel, berichtete über vorläufige Daten zu PFS, ORR und Sicherheit.
Infolge der Stratifikationskriterien ergab sich ein leichtes Ungleichgewicht in Bezug auf LDH-Patienten und Anzahl metastatische Organe in den verschiedenen Studienarmen. Patienten mit LDH >2ULN und M1c waren eher gut ausgewogen. Bei der ersten Analyse waren ORR, mPFS und PFS 1- und -2-Jahresraten konsistent mit den in den Schlüsselstudien berichteten. Der erste Bericht des Gesamt-PFS zeigt einen interessanten Trend in Arm C (kurze Behandlung mit TT und Switch zu IO bei Ansprechen). Ein längerer Follow-up mit mehr reifen Daten zur Bestätigung dieser Resultate ist notwendig. In der zweiten Hälfte von 2021 werden zusätzliche Daten zu Gesamt-PFS und der erste Bericht zu OS (Hauptendpunkt) vorliegen. Eine parallele Biomarkerstudie, die zusätzliche Information über Ansprechen und Resistenzmechanismen vermitteln wird, ist ebenfalls unterwegs.
Stellungnahme der Experten
Der Ansatz wird als vorbildlich beurteilt. Dies ist wirklich ein Design, das unser Denken beeinflusst.
Wir glauben alle, dass Immunotherapie am besten wirkt, wenn wir minimale Tumorlast haben. Für BRAF-Mutationen steht eine sehr verlässliche Medikation zur Verfügung. Warum verbessern wir den Startpunkt für die Immuntherapie nicht artifiziell durch Start mit zielgerichteter Therapie statt mit Immuntherapie. Der Sandwich Approach sollte zunächst eingesetzt werden, obschon dies formell nie getestet wurde. Der Ansatz ist aber vorbildlich. Der 8-Wochenansatz wurde ebenfalls diskutiert. Man sollte nicht über der maximalen Aktivität sein. Bei sehr aggressiven Tumoren ist das Maximum nach 8 Wochen erreicht. Hilfreich wäre ein Biomarkeransatz.
Nivolumab plus Cabozantinib versus Sunitinib in der 1st-Line-Behandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms: Erste Resultate der randomisierten Phase-III-Studie Checkmate 9ER
Die Studie brachte eine neue Erstlinienoption für Patienten mit fortgeschrittenem Klarzell-Nierenzellkarzinom.
Nivolumab und Cabozantinib haben beide Verbesserungen im OS als Einzelagentien in Phase-III-Studien gezeigt. Nivolumab vermittelt Antitumorantworten durch Hinderung des Tumors an der Umgehung der Immunerkennung. Cabozantinib hat anti-angiogene und immunmodulatorische Eigenschaften, die der tumorinduzierten Immunsuppression entgegenwirken können. Nivolumab + Cabotantinib zeigte vielversprechende vorläufige Antitumor-Aktivität in einer Phase-I-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenen urogenitalen Malignitäten und schaffte eine Rationale für die Kombination.
Prof. Toni K Choueiri, Boston, stellte erste Resultate der Phase-III Checkmate 9ER-Studie mit Nivolumab + Cabozantinib versus Sunitinib in der 1st-Line Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Klarzell Nierenzellkarzinom vor.
Die erstere erfüllte alle Wirksamkeitsendpunkte und zeigte Überlegenheit der 1st-Line-Behandlung Nivolumab + Cabozantinib gegenüber Sunitinib. Reduktion des Risikos für Krankheitsprogression oder Tod um 49%. Reduktion des Risikos für Tod um 40% und eine absolute ORR-Zunahme von 29%. Nivolumab plus Cabozantinib zeigten konsistente PFS-, OS- und ORR-Vorteile gegenüber Sunitinib über die wichtigsten Ausgangsmerkmale hinweg, einschliesslich IMDC-Risikostatus, Tumor PD-L1-Expression und Knochenmetastasen. Die Kombination wurde im Allgemeinen gut vertragen mit einer geringen Rate von behandlungsbezogenen Abbrüchen. Die Patienten hatten eine signifikant bessere Lebensqualität mit Nivolumab + Cabozantinib als mit Sunitinib.
Diese Resultate unterstützen Nivolumab plus Cabozantinib als eine potentielle 1st-Line-Option für Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom.
Session IV: Lungenkrebs
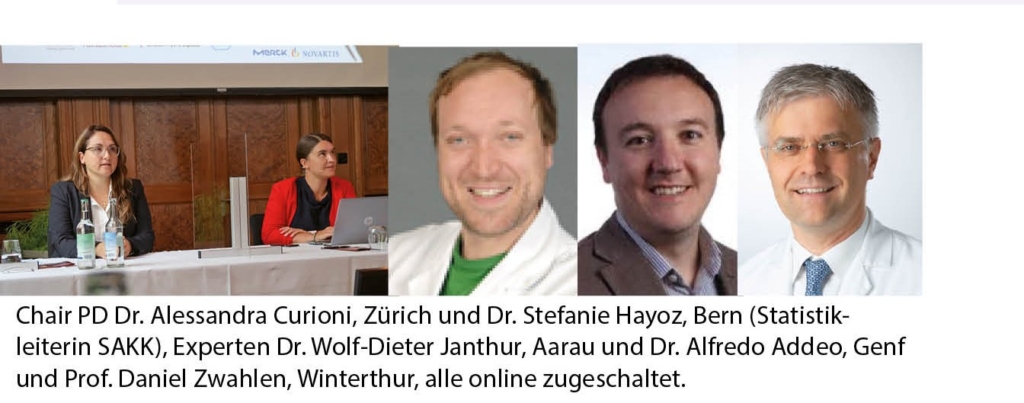
Konsolidierung von Nivolumab und Ipilimumab vs. Beobachtung bei SCLC in begrenztem Stadium nach Chemo-Stahlentherapie.
Die gleichzeitige Chemotherapie und Thoraxbestrahlung, gefolgt von einer prophylaktischen Schädelbestrahlung, ist die radikale Standardstrategie bei SLCLC in begrenztem Stadium (LS-SCLC). CTLA-4- und PD-1-exprimierende T-Zellen spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Selbsttoleranz, sind jedoch für eine unzureichende Immunantwort auf Tumorantigene verantwortlich. Die Kombination von Ipilimumab und Nivolumab hat sich bei verschiedenen metastasierenden Krebsarten, darunter Nierenzellkarzinom, NSCLC, Mesotheliom und Melanom, zu einem Standardtherapeutikum der ersten Wahl entwickelt.
Die Nivolumab-Monotherapie bietet ein dauerhaftes Ansprechen und ist als Dritt- oder Spätbehandlung bei rezidivierendem SCLC gut verträglich. Die Kombination von Nivolumab (1mg/kg) plus Ipilimumab (3mg(kg)) verbesserte den primären Endpunkt ORR im Vergleich zur Nivolumab-Monotherapie bei Checkmate 032 signifikant, was nicht zu einer längeren PFS oder OS führte, sondern die Toxizität erhöhte. Alle Ergebnisse waren in der explorativen Kohorte mit hohem TMB klinisch signifikant verbessert. STIMULI ist eine 1:1 randomisierte internationale Phase-II-Studie mit dem Ziel, die Überlegenheit der Konsolidierungsbehandlung mit Nivolumab und Ipilimumab gegenüber der Beobachtung nach Standard-CRT und PCI bei Patienten mit LS-SCLC nachzuweisen. Der primäre Endpunkt der STIMULI-Studie ist PFS, wie vom Prüfer bewertet. Die Ergebnisse der randomisierten Phase II Studie ETOP/IFCT 4-12 STIMULI wurde von Prof. Solange Peters, Lausanne vorgetragen.
STIMULI erreichte seinen primären Endpunkt, die Verbesserung des PFS mit Nivolumab und Ipilimumab-Konsolidierung nach Standard-Radiochemotherapie bei LS-SCLC-Patienten, nicht. Ein in der Studie beobachteter kurzer Zeitraum aktiver Behandlung im Zusammenhang mit der Toxizität und dem Abbruch der Behandlung hat sich sicherlich auf die Wirksamkeitsergebnisse ausgewirkt. Ein längeres Follow-up der Studie ermöglicht die Untersuchung möglicher Spätfolgen der Immuntherapie-Konsolidierung auf das Überleben, die sich bereits beim aktuellen kurzen Follow-up zeigen (Nichtproportionalitätstrend bei OS, p=0,059). Der OS-Nutzen der Immuntherapie-Konsolidierung unterscheidet zwischen dem Niveau der RT-Fraktion, dem Geschlecht und der PS. Ein höherer Nutzen wurde für die zweimal täglich auftretende RT-Fraktion, das weibliche Geschlecht und PS1 festgestellt, wo er auch statistisch signifikant war. Derzeit laufen exploratorische translationale Arbeiten zur Identifizierung von Untergruppen mit Biomarker-definierten Subgruppen, die von der Konsolidierung der Immuntherapie profitieren könnten.
Stellungnahme der Experten
Es handelt sich um eine zwar negative aber wichtige Studie, denn es ist eine der ersten Studien, die die Rolle der Immuntherapie bei dieser sehr schwer zu behandelnden Krankheit untersucht. Man weiss bereits, dass die Immuntherapie bei metastasierendem kleinzelligem Lungenkarzinom in Kombination mit einer Chemotherapie wirksam ist. Die Immuntherapie sollte zusammen mit der Radiotherapie gestartet werden. Der gewählte Plan war damals richtig, würde heute aber geändert. Die Statistikerin moniert, dass die Studie zu ambitiös ist, es gab keine Überlegenheit im Behandlungsarm und die Schlussfolgerung ist irreführend.
Adjuvante Therapie mit Osimartinib bei Patienten mit reseziertem EGFR mutiertem NSCLC (AUDAURA): Rezidiv der ZNS Erkrankung
Die Ergebnisse bei resektablem NSCLC müssen verbessert werden. Ungefähr 30% der Patienten mit NSCLC weisen bei der Diagnose eine resektable Erkrankung auf. Chirurgie mit kurativer Absicht ist die primäre Behandlung für diese Patienten. Eine adjuvante Chemotherapie auf Cisplatin Basis wird für Patienten mit reseziertem NSCLC im Stadium II-IIIA und ausgewählte Patienten im Stadium IB empfohlen. Die Raten des Wiederauftretens der Krankheit nach der Operation bleiben jedoch unabhängig von der postoperativen Chemotherapie in allen Krankheitsstadien hoch. EGFR-TKI gehören zur Standardbetreuung von Patienten mit EGFRm fortgeschrittenem NSCLC, und frühere Studien deuten darauf hin, dass EGFR-TKI im resezierten Setting eine Rolle spielen könnten.
In der von Dr. Masahiro Tsuboi, Kashiwa, Chiba, Japan, vorgestellten Phase-III-Studie ADAURA zeigte das Adjuvans Osimertinib (ein EGFR-TKI der dritten Generation) eine statistisch hoch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des DFS bei Patienten mit resektablem (Stadium IB-IIIA) EGFRm NSCLC.
Das verringerte Risiko eines lokalen und entfernten Rezidivs und ein verbessertes DFS des ZNS stärken adjuvantes Osimertinib als eine hochwirksame, praxisverändernde Behandlung für Patienten mit EGFRm NSCLC im Stadium IB/II/IIIA EGFRm nach vollständiger Tumorresektion.
Stellungnahme der Experten
Die Daten werden als zu unfertig betrachtet. OS Daten fehlen. Eine bessere Patientenselektion wäre wünschenswert. Vier Ereignisse im Osimertinib-Arm sind zu wenig. Es müsste länger gewartet werden. Die Daten werden in der vorliegenden Form als nicht sehr wissenschaftlich beurteilt.
Eine internationale, randomisierte Studie zum Vergleich von postoperativer Radiotherapie (PORT) gegen kein PORT bei Patienten mit total reseziertem NSCLC und mediastinaler N2-Beteiligung. LUNG ART, eine Phase III Studie
PORT bei Patienten mit total reseziertem NSCLC ist seit Jahren ein Thema für Diskussionen. Bei pN0 und pN1 Patienten ist PORT seit der Publikation der PORT Metaanalyse (Lancet 1998) keine Standardbehandlung. Bei nP2 Patienten sollte PORT Gegenstand weiterer Forschung sein.
Seit 1998 gab es viele Veränderungen: bessere Selektion, (neo)-ajuvante Chemotheraie als Standard of Care bei Stage III resezierten Patienten, bessere Chirurgie, bessere Radiotherapie. Neue retrospektive Studien oder grosse Datenbank-Studien favorisieren PORT, aber robuste Daten fehlen. Grosse randomisierte Studien sind notwendig, um die Rolle des modernen mediastinalen PORT zu untersuchen.
LungART ist die erste europäische, randomisierte Studie zur Evaluierung der modernen PORT nach vollständiger Resektion bei Patienten, die vorwiegend mit einem PET-Scan ausgewählt wurden und ein (neo)adjuvantes CT erhalten haben. Das dreijährige DFS (43,8% im Kontrollarm und 47,1% im PORT-Arm) war in beiden Armen höher als erwartet. Die Anzahl der Mediastinalrezidive war reduziert (48% in der CA gegenüber 25% in der PORT-Gruppe). PORT war mit einer nicht statistisch signifikanten 15%igen Zunahme des DFS bei Patienten im Stadium III und II assoziiert. Es wurden mehr Toxizitäten im PORT-Arm beobachtet, insbesondere im kardiopulmonalen Bereich, die noch weiter untersucht werden müssen. Weitere Analysen sind geplant (QA-Chirurgie und PORT, Versagensmuster etc.), berichtete Priv.-Doz. Dr. Barbara Kiesewetter-Wiederkehr, Wien.
Stellungnahme der Experten
PORT kann nicht für alle Patienten mit NSCLC Stadium 2 oder 3 empfohlen werden. Die Toxizität wird entscheiden.
Aktualisierte Ergebnisse der Phase 1/2 – Studie mit Mobocertinib (TAK-788) bei NSCLC mit EGFR Exon-20-Insertionen
Ca. 6% der EGFR-mutierten NSCLC-Tumoren weisen EGFR-Exon20 Insertionen auf. Es gibt keine zugelassenen gezielten Behandlungen für diese Patienten; zugelassene EGFR-TKI sind unwirksam, mit niedrigen Ansprechraten und PFS von ca. 2 Monaten. Mobocertinib ist ein oraler EGFR-TKI, der für die Behandlung von NSCLC mit EGFR-Exon20 Insertionen untersucht wird. In einer Phase-1/2-Studie bei zuvor mit EGFR-Exon20 Insertionen behandeltem NSCLC zeigte Mobocertinib mit 160 mg qd eine Antitumoraktivität mit einem bestätigten ORR-Wert von 43%, einem mPFS-Wert von 7,3 Monaten und einem überschaubaren Nebenwirkungsprofil, das anderen EGFR-TKI ähnlich ist. In der EXCLAIM-2-Studie (NCT04129502) wird die Wirksamkeit der Erstlinien-Kombinations-Chemotherapie von Mobocertinib gegenüber einer Chemotherapie auf Platinbasis bei NSCLC mit EGFR-Exon20 Insertionen verglichen.
Die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse (TRAEs; >25%) nach Einschätzung des Prüfarztes waren Durchfall (82%), Hautausschlag (46%), Übelkeit (39%), verminderter Appetit (39%), Erbrechen (36%), Paronychie (29%); Grad ≥3 TRAEs (≥5%): Durchfall (32%), Übelkeit (11%), erhöhte Lipase (7%), erhöhte Amylase (7%), Stomatitis (7%), Erbrechen (7%).
Mobocertinib zeigte Antitumor-Aktivität bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon20-Insertionen. Das Sicherheitsprofil
von Mobocertinib war konsistent mit anderen EGFR-TKI, wie Dr. Pasi A. Jänne, Boston, feststellte.
Stellungnahme der Experten
Es handelt sich um eine Patientenpopulation, die sehr schwierig zu behandeln ist. Die neue Therapie, die vorderhand in Winterthur und Lausanne verfügbar ist, ist daher sehr willkommen. Die Diarrhoe wird als kritisch betrachtet.
Lorlatinib vs. Crizotinib in der 1st Line Therapie von Patienten mit fortgeschrittenem ALK-positivem NSCLC − Resultate der Phase 3 CROWN Studie
ALK-Rearrangements treten in einer Untergruppe von NSCLCs auf und führen zu einer Empfindlichkeit gegenüber kleinmolekularen ALK-TKIs. Oft entwickelt sich eine Resistenz gegen ALK-TKI, die oft eine ZNS-Progression einschliesst. Lorlatinib ist ein hochpotenter ALKTKI der dritten Generation mit allgemeiner und intrakranialer Aktivität bei fortgeschrittenem ALK-positivem NSCLC. Die von Dr. Christine Lovly, Nashville, USA, präsentierte CROWN-Studie ist eine randomisierte Phase-3-Studie zum Vergleich von Lorlatinib vs. Crizotinib als Erstlinienbehandlung bei ALK-positivem NSCLC.
Die Ergebnisse einer geplanten Zwischenanalyse wurden vorgestellt.
Lorlatinib führte zu einer signifikant längeren PFS, signifikant höheren Gesamt- und IC-Ansprechraten und einer verbesserten globalen Lebensqualität, im Vergleich zu Crizotinib bei der Erstlinienbehandlung bei ALK-NSCLC. Die IC-Ansprechrate von Lorlatinib betrug 82% bei Patienten mit messbaren Hirnmetastasen, mit einer vollständigen Ansprechrate von 71% und einer signifikant längeren Zeit bis zur IC-Progression.
Das Sicherheitsprofil von Lorlatinib entsprach in etwa dem in früheren Studien berichteten. AEs vom Grad 3/4 waren häufiger mit Lorlatinib als mit Crizotinib, jedoch handelte es sich bei der Mehrheit um Laboranomalien, die asymptomatisch und leicht zu behandeln waren.
Diese Ergebnisse unterstützen den Einsatz von Lorlatinib als Erstlinientherapie für Patienten mit fortgeschrittenem ALK positivem NSCLC-wirksam.
Stellungnahme der Experten
Die Therapie wird als eine sehr gute Salvage-Therapie beurteilt. Das OS ist noch unreif und wurde trotzdem gezeigt. Ein noch unreifes OS sollte nicht gezeigt werden, so die Statistikerin, weil die Daten sonst fälschlicherweise interpretiert werden. Die kognitive Verschlechterung ist neu und wichtig und wird bei anderen ALK-Inhibitoren nicht gesehen. Sie ist nicht sehr häufig. Die Hypercholesterinämie ist ebenfalls ein Problem, das aber beherrschbar ist. Insgesamt weist die Behandlung zu viele unerwünschte Nebenwirkungen auf. Sie würde deshalb nicht als 1st Line Therapie eingesetzt werden.
R07122290 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit Atezolizumab bei soliden Tumoren.
Die erste humane Phase-I-Studie mit R07122290 (R0), einem neuartigen FAP-gerichteten 4-1BB Agonisten, wurde von Dr. Ignacio Melero, Pamplona, vorgestellt. R0 bindet an Tumorstroma über Fibroblasten aktiviertes Protein und aktiviert T-Zellen über den 4-1BB Liganden.
Die Tumor-abhängige Quervernetzung liefert starke FogR-unabhängige Signalisierung, grössere agonistische Aktivität bei Tumoren und reduzierte Aktivität ausserhalb des Tumors sowie eine zielgerichtete Toxizität im Vergleich zu ungezielten 1st Generation Fc gammaR abhängigen agonistischen mAbs. R0 ist ein 4-1BB-Agonist der 2. Generation mit zielgerichteter Tumor-Aktivität durch Bindung an tumorassoziiertes FAP. R0+/-Azetolizumab weist ein akzeptables Sicherheits-/Verträglichkeitsprofil über einen breiten getesteten Dosisbereich auf. Keine MTD, Inzidenz von unerwünschten Nebenwirkungen mässig erhöht für die Kombination mit ATZ vs. Einzelmedikament, inkl. Pneumonitis.
Die PD-Aktivität bestätigt die FAP-4-1BBL Wirkungsweise, die eine CD8+ T-Zell-Aktivierung/Proliferation im Blut und CD8+ T-Zell-Proliferation (Infiltration im Tumor) nachweist.
Objektives Ansprechen wurde vor allem in Kombination mit ATZ und bei CPI-naiven entzündeten Tumortypen beobachtet. Die empfohlene sichere Dosis für die Expansion (in Teil C) von R0 + ATZ beträgt 250 mg QW, die mehrere Faktoren einschliesslich PK, PD-Wirkungen gegen Tumoraktivität und präklinische Daten berücksichtigt.
Die klinische Entwicklung (Teil C) zielt darauf ab, ein vorläufiges Proof of Concept für R0 in Kombination mit ATZ +/- nab-Paclitaxel bei 2L+ Thymom/Thymuskarzinom, 2Ll+ Mesotheliom und 1L PDL1+TNBC Stadium IV zu demonstrieren.
Stellungnahme der Experten
R0 ist ein interessanter neuer Ansatz zur Behandlung solider Tumore. Es weist ein akzeptables Sicherheitsprofil sowohl als Einzelagens als auch in Kombination mit Azetolizumab auf. Die Daten werden aber noch als zu früh für eine endgültig Beurteilung angesehen. Es wäre sicher interessant, Studien mit diesem Approach auch in der Schweiz durchzuführen.
Dauerhaftigkeit des klinischen Nutzens und von Biomarkern bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC, die mit AMG 510 (Sotorasib) behandelt wurden; CodeBreak 100
Sotorasib ist ein Klassenerster KRASG12C Inhibitor. KRAS p.G12C Mutation wird bei ungefähr 13% NSCLC, 3-5% Kolonkarzinomen und 1-3% anderen soliden Tumoren gefunden. Sotorasib (für AMG 510 vorgeschlagener INN) ist ein neuer, hoch-selektiver, Klassenerster KRASG12C Inhibitor, welcher Antikrebs Aktivität und ein beherrschbares Sicherheitsprofil bei Patienten mit soliden Tumoren mit KRASG12C Mutation gezeigt hat.
Sotorasib zeigte ein günstiges Sicherheitsprofil. Keine Dosis-limitierenden Toxizitäten, keine therapiebedingten tödlichen Ereignisse, Grad 3 oder 4 behandlungsbezogene unerwünschte Ereignisse kamen bei 18.6% der Patienten vor.
Sorasib zeigte dauerhafte Krankheitskontrolle bei stark vorbehandelten Patienten mit NSCLC. Bestätigte ORR 32.2% für alle Patienten, 35.3% für die 960mg Kohorte, wie Dr. David S. Hong, Houston, zeigte.
Das mediane PFS betrug 6.3 Monate bei allen Patienten mit einer medianen Ansprechdauer von 10.9 Monaten.
Die 960mg Dosierung wurde als die Phase II Dosis für NSCLC identifiziert. Sorasib zeigt klinische Aktivität bei NSCLC über eine Reihe von KRASpG12C MAFs, PD-L1 Expressionsniveaux, TMB Plasmawerten und und Co-Mutationsprofile.
Zusätzliche CodeBreak Studien, die Sorasib als Monotherapie oder in Kombination mit andern Antikrebs Agentien sind derzeit am Laufen (CodeBreak100, CodeBreak200, CodeBreak 101, CodeBreak 105).
Stellungnahme der Experten
Ein interessantes Medikament und eine weitere Option mit guter Perspektive für Patienten mit stark behandeltem fortgeschrittenem NSCLC.
Präsidiale Präsentation – oberer Gastrointestinaltrakt

Erste Resultate der Checkmate 649 Studie
Nivolumab plus Chemotherapie vs. Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei fortgeschrittenem Magenkrebs (GC)/Gastrooesophagus- Übergangskarzinom (GEJC), Oesophagus-Adenokarzinom (EAC)
Die Standarderstlinientherapie bei fortgeschrittenem oder metastatischem, HER2- Magenkarzinom/Gastrooesophagus- Übergangskarzinom resultiert in einem schlechten OS (median < 1 Jahr). Nivolumab ergab ein überlegenes OS gegenüber Placebo bei stark vorbehandeltem fortgeschrittenem GC/GEJC. Nivolumab +Chemotherapie zeigte vielversprechende Antitumor-Aktivität bei 1L fortgeschrittenem /wiederkehrendem GC/GEJC. PD-L1 Expression durch CPS bei Cutoff ≥5 hat eine bessere Wirksamkeit von Checkpoint-Inhibitoren gezeigt als die PD-L1-Expression von Tumorzellen bei GC/GEJC/EAC. Checkmate 649 ist die grösste randomisierte, globale Phase 3 Studie mit PD-1 Inhibitor basierten Therapien im 1st Line Setting bei Patienten mit fortgeschrittenem GC/GEJC/EAC. Prof. Markus Moehler, Mainz, und Koautoren berichteten über die ersten Resultate mit Nivolumab + Chemotherapie vs. Chemotherapie von Checkmate 649.
Nivolumab ist der erste PD-1 Inhibitor, der überlegenes OS und PFS in Kombination mit Chemotherapie vs. Chemotherapie allein bei vorher unbehandelten Patienten mit fortgeschrittenem GC/GEJC/EAC gezeigt hat. Statistisch signifikanter und klinisch bedeutsamer OS Benefit bei Patienten mit Tumoren die PD-L1 CPS ≥5 und ≥1 exprimieren und in allen randomisierten Patienten. Überlebensbenefit über multiple präspezifizierte Subgruppen. PFS Benefit in PD-L1 CPS ≥5 (statistisch signifikant), PD-L1 CPS ≥1, und in allen randomisierten Patienten.
Es gab keine neuen Sicherheitssignale mit Nivolumab + Chemotherapie. Nivolumab + Chemotherapie stellt eine neue potentielle Standard -Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem GC/GEJC/EAC dar.
Immuncheckpoint Blockade als Erstlinientherapie bei Gastroösophus-Adenokarzinom: eine neue Tür öffnet sich
Magen- und Gastroösophagus-Adenokarzinom (GEA) sind für > 800 000 Todesfälle/Jahr verantwortlich. Das mediane OS in gegenwärtigen 1st Line klinischen Studien bei Nicht-Asiaten mit HER2- GEA- Patienten beträgt weniger als ein Jahr. Inkrementelle Gewinne beim OS wurden durch Trastuzumab (1L HER2+, 2010), Ramucinumab (2L, 2014), Nivolumab (3L, 2017) und Influridin-Tipiracil (3L, 2018) erzielt. Ausserhalb Asiens erhält die Mehrheit der GEA-Patienten nur eine Behandlungslinie (40% 2L, 20% 3L+). Bei HER2neg. GEA Patienten blieb die Erstlinientherapie seit den 1990igern unverändert.
Die Schlüsselfragen bei CheckMate-649 und ATTRACTION-4 (ähnlich CheckMate-649 aber ausserhalb Asiens, Endpunkt für alle CPS) waren:
1. Ist Chemotherapie plus Nivolumab ein neuer Behandlungsstandard für Patienten mit therapienaivem fortgeschrittenem Magen- und Gastroösophus Karzinom?
2. Wie sind diese Resultate durch den Biomarkerstatus beeinflusst?
3. Die letzte Studie mit Chemotherapie plus anti-PD-1 bei Erstlinien GEA (Keynote 062) war negativ. Warum sind die Resultate von Checkmate 649 verschieden?
Die Resultate von Checkmate-649 und ATTRACTION-4 werden wahrscheinlich zu einem Paradigmenwechsel in der 1L Behandlung des fortgeschrittenen Gastroösophagus-Adenokarzinoms führen. Patienten mit PD-L1 CPS ≥5 Magenkarzinom, die mit Oxaliplatinfluoropyrimidin und Nivolumab behandelt werden, können ein medianes OS von >14 Monaten erwarten, ein Meilenstein für nicht-asiatische Patienten.
Die folgenden weiteren Analysen sind erforderlich: Checkmate-649 Biomarker-Subgruppen zum Verständnis von Nivolumab für alle Pateinten, ATTRACTION-4 zum Verständnis der Gründe für den fehlenden OS Benefit.
Pembrolizumab plus Chemotherapie vs. Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patiente mit fortgeschrittenem Oesophagus Karzinom. Die Phase 3 Keynote-590 Studie
Die derzeit empfohlenen Therapieoptionen beim fortgeschrittenen Oesophagus Karzinom sind in der Erstlinie Fluoropyrimidin plus Platin-basierte Chemotherapie. In der Zweitlinie Docetaxel, Paclitaxel, Irinotecan und Ramucinumab ±Paclitaxel (für Adenokarzinom).
Pembrolizumab Monotherapie hat Antitumoraktivität mit einem akzeptablen Sicherheitsprofil bei fortgeschrittenem/metastatischem Oesophaguskarzinom gezeigt. Keynote-180 (3L+): ORR 14%, medianes DOR nicht erreicht sowohl bei Oesophagus-Plattenepithelzellkarzinom als auch bei PD-L1 CPS ≥ 10 Tumoren. Keynote-181 (2L): Medianes OS 10.3 Monate vs. 6.7 Monate (HR 0.64) mit Pembrolizumab vs. Chemotherapie. ORR 22% vs. 7% mit medianem DOR von 9.3 Monaten vs. 7.7 Monate bei Oesophagusplattenepithelzellkarzinom mit PD-L1 CPS ≥10. FDA zugelassen für Behandlung von rekurrentem lokal fortgeschrittenem oder metastatischem Plattenepithelzellkarzinom mit PD-L1 CPS ≥10, mit Krankheitsürogression nach ≥1 vorherigen Linie Systemtherapie. Keynote-590 eine Phase 3, randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie zur Evaluation von Pembrolizumab plus Chemotherapie vs. Placebo plus Chemotherapie bei fortgeschrittenem Oesophaguskarzinom in der Erstlinie wurde von PD Dr. Aysegül Ilhan-Mutlu, Wien, präsentiert. Pembrolizumab plus Chemotherapie in der Erstlinie vs. Chemotherapie plus Placebo ergab eine statistische signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung in OS, PFS und ORR bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem und metastatischem Oesophaguskarzinom inklusive Oesophagusübergangskarzinom: Überlegenes OS: Oesophagusplattenepithelzellkarzinom CPS ≥10 (HR0.57; p<0.001), alle Patienten (HR 0.73, p<0.001). Überlegens PFS: Oesophagusplattenepithelzellkarzinom (HR 0.65, CPS ≥10 (HR0.51), alle Patienten (HR 0.65) alle p<0.001. Überlegenes ORR: alle Patienten (45% vs 29.3%, p<0.001).
Vergleichbares Sicherheitsprofil den beiden Behandlungsgruppen, keine neuen Sicherheitssignale aufgetreten. Pembrolizumab plus Chemotherapie sollte ein neuer Behandlungsstandard als Erstlinientherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem und metastatischem Oesophaguskarzinom inklusive Oesophagusübergangsadenokarzinom werden.
Immuntherapie für Oesophaguskarzinome: Wann und für wen?
Keynote-590: Die Zugabe von Pembrolizumab zur Platin-basierten Chemotherapie erhöhte RR, PFS und OS signifikant bei Patienten mit fortgeschrittenen Oesophagus Karzinomen gegenüber der alleinigen Chemotherapie. Dies ist ein neuer Behandlungsstandard. keine Bedenken wegen Toxizitätssignalen. Diese Resultate waren unabhängig vom CPS Status, obschon Plattenepithelhistologie und CPS ≥10 maximalen Nutzen erzielen können. Die Auswirkungen für Adenokarzinome können umstritten sein.
Checkmate 577: Nivolumab reduzierte das Risiko für Rückfall bei Patienten mit Oesophagus- oder Übergangsadenokarzinomen, welche nach vorheriger neodajuvanter Chemotherapie reseziert wurden und ein pCR oder eine ähnliche Situation danach nicht erreichten. Diese Resultate waren unabhängig vom PD-L1 Status. Dies trifft für Patienten, die nur mit neoadjuvanter Chemotherapie behandelt wurden, möglicherweise nicht zu. Ausgereifte Daten zu OS werden von grosser Relevanz sein. Alle Studien mit Checkpoint-Inhibitoren bei lokalisierten Gastroösophaguskarzinomen:
Keynote MK3475: Perioperatives Pembrolizumab +SFU / Cisplatin bei Magen- und Oesophagusübergangskarzinomen.
EORTC 1707 -VESTIGE: Adjuvantes Nivolumab + Ipilimumab nach nCTx + Chirurgie bei Hochrisiko ypT N+ oder R1 reseziertem Magen- und Oesophagusübergangskarzinom.
AIO-STO 0317 DANTE: Perioperatives FLOT +/- Atezolizumab bei Magen- und Oesophagusübergangskarzinom.
Wrap up
Insgesamt sind 6 Studien als praxisändernd oder unterstützend erwähnenswert. Bei den gastrointestinalen Tumoren sind die Studie Keynote 590 und Checkemate 577 von besonderer Bedeutung. Die Immuncheckpoint Blockade als Erstlinientherapie beim Gastroösophagus-Adenokarzinom könnte auf Grund der Resultate von Checkmate-649 zu einem Paradigmenwechsel in der Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Gastroösophagus-Adenokarzinoms führen.
Beim Brustkrebs wird die Studie ASCENT mit Sacituzumab Govitecan praxisändernd sein. Sacituzumab Govitecan ist ein klassenerstes Trop-2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, welches sich bei der Behandlung des TNBC als hochwirksam erwiesen hat. Vermutlich wird sich dieses Medikament auch bei anderen Biologien bewähren.
Bei Urogenitalkarzinomen ist die PROfound Studie erwähnenswert. Sie ist die erste positive Phase-III- Studie mit dem PARP Inhibitor Olaparib bei mCRPC, die ihren primären Endpunkt bei BRCA1 und BRCA2 positiven mCRPC erreicht hat. Olaparib sollte deshalb beim mCRPC eingesetzt werden, war die erste Botschaft. Die zweite Botschaft auf Grund von PROfound war, dass die Durchführung von Gen-Testung für BRCA1 und BRCA2 und möglicherweise auch für Pten empfohlen ist. Dies jedenfalls wenn die Patienten kastrationsresistent werden.
Auf dem Gebiet der Lungenkarzinome ist die Studie LUNG ART bedeutend. Sie stellte die postoperative Radiotherapie (PORT) einer kein PORT Strategie bei Patienten mit total reseziertem NSCLC und mediastinalem N2-Beteiligung gegenüber. Die Studienresultate sprechen dafür, dass PORT als Standard of Care bei vollständig resezierten NSCLC-Patienten im Stadium IIIAN2 nicht mehr empfohlen werden kann. Ferner ist die STIMULI-Studie bei den Lungenkarzinomen erwähnenswert, eine Studie die bezüglich PFS negativ war, dies wegen der möglichen Toxizität dieser Medikamente.
Insgesamt war ESMO ein sehr gelungenes und bedeutendes Meeting, an welchem mehrere wichtige Studien präsentiert wurden. Die Anzahl von 6 praxisändernden oder unterstützenden Studien wird als bedeutend betrachtet. Das Meeting ESMO in the Alps stellte einen perfekt gewählten Auszug aus den wichtigsten am ESMO 2020 präsentierten Studien dar. Es war sowohl als virtuelles als auch live stattfindendes Meeting ausgezeichnet organisiert, von den Chairmen hervorragend geleitet und von ausgewiesenen Experten kompetent diskutiert.
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen
riesen@medinfo-verlag.ch