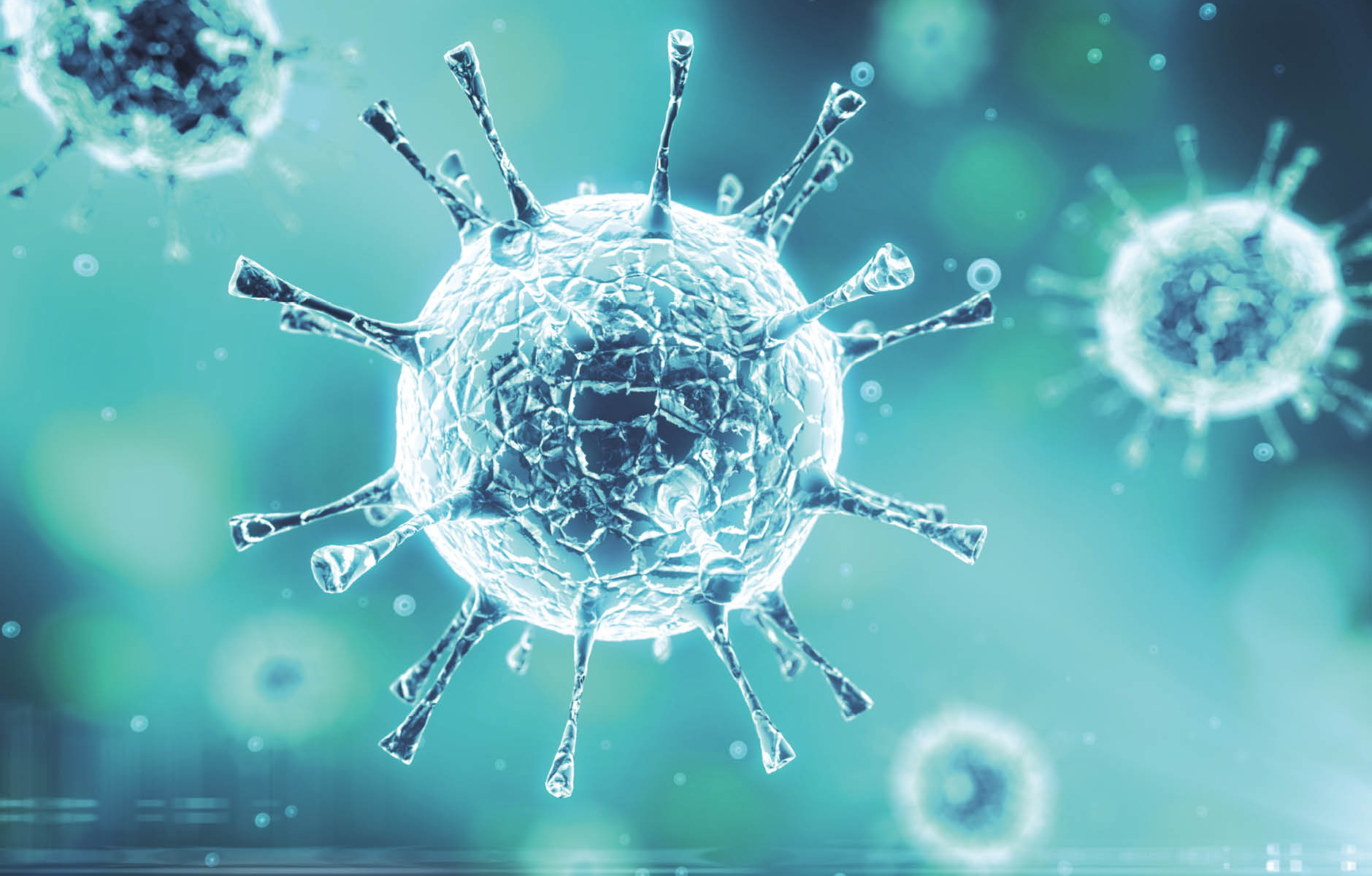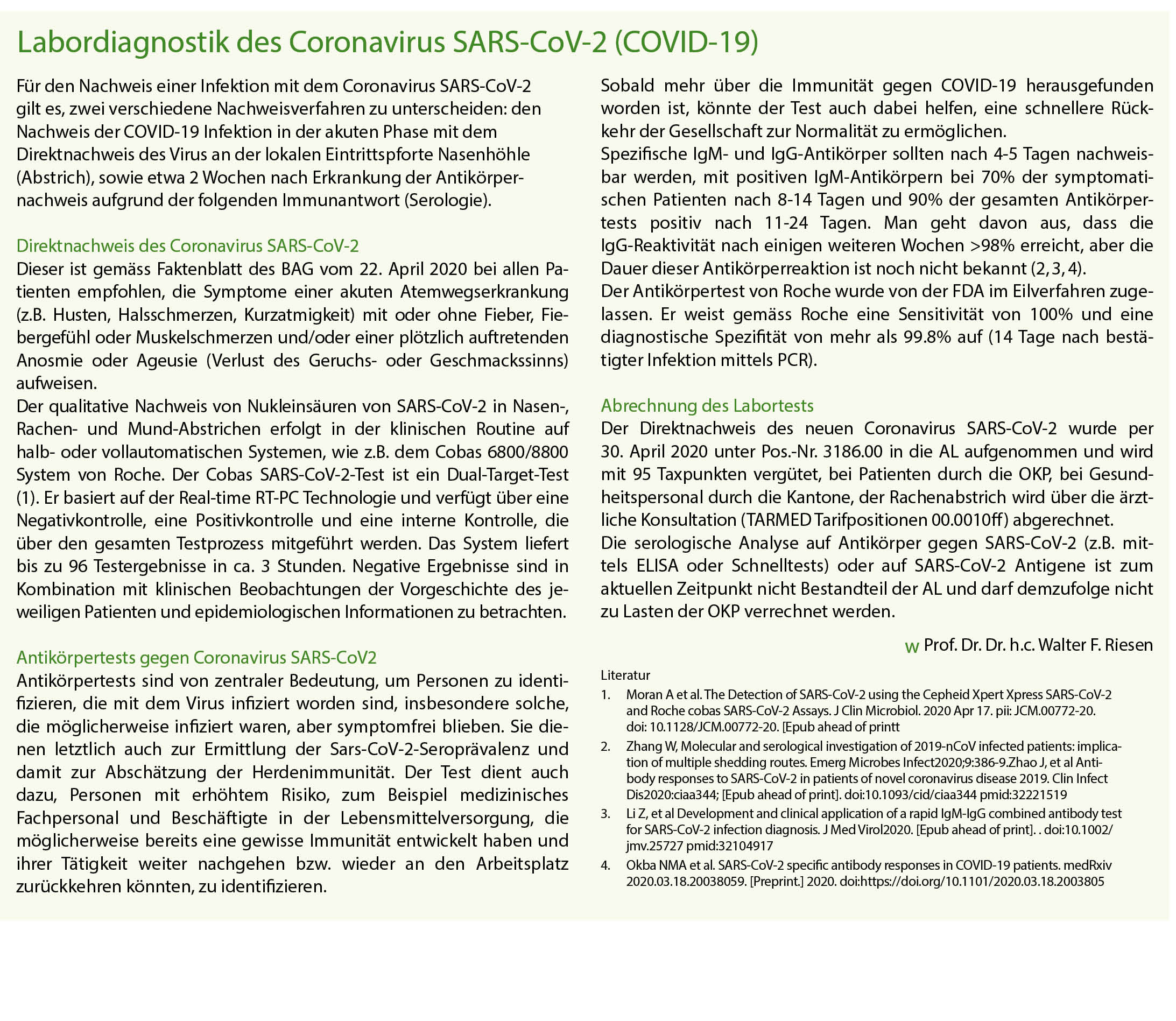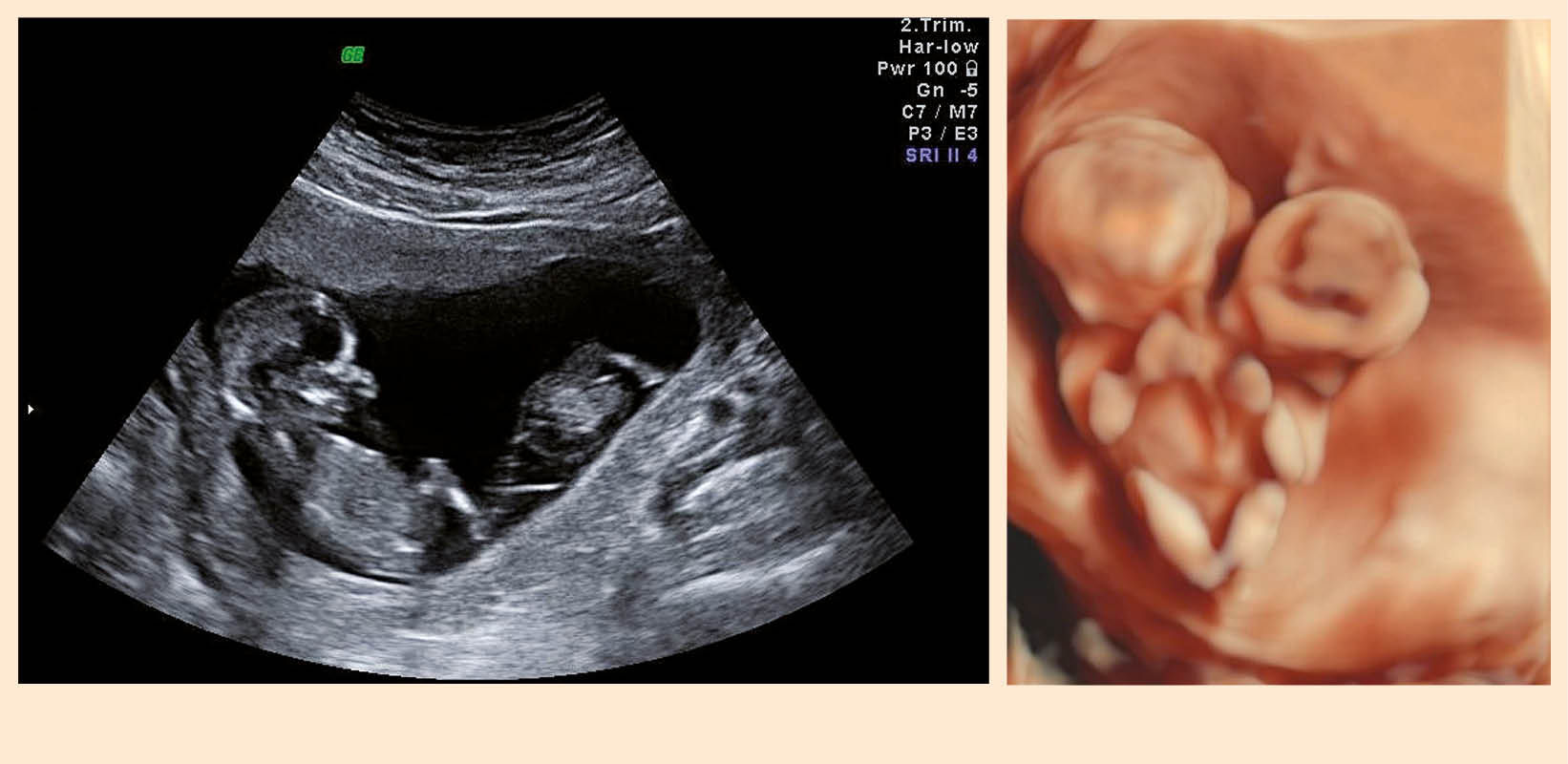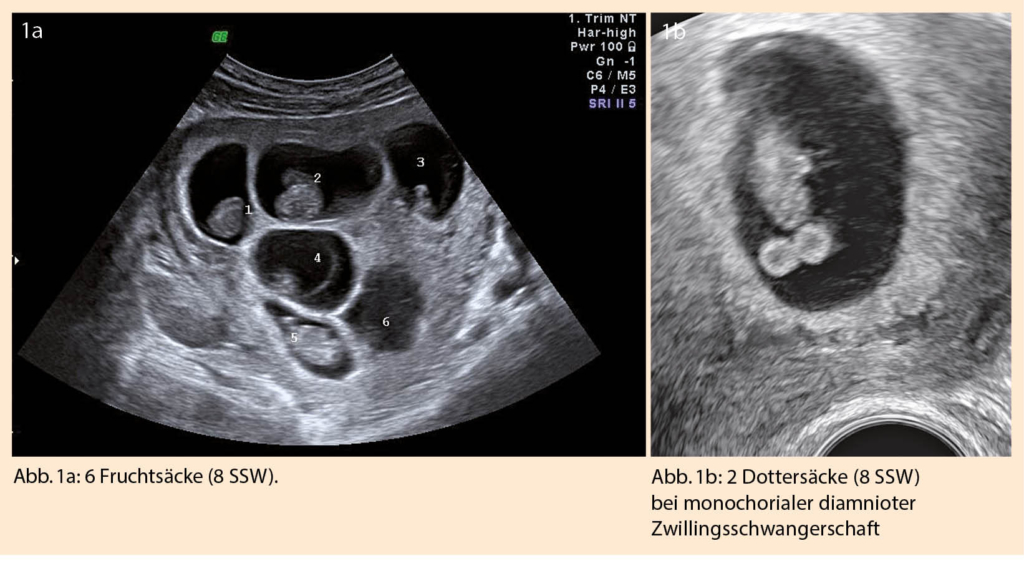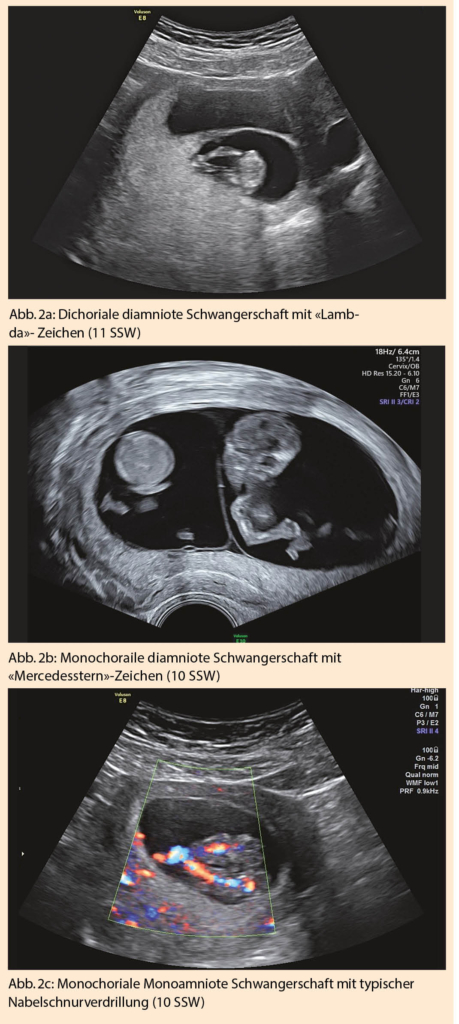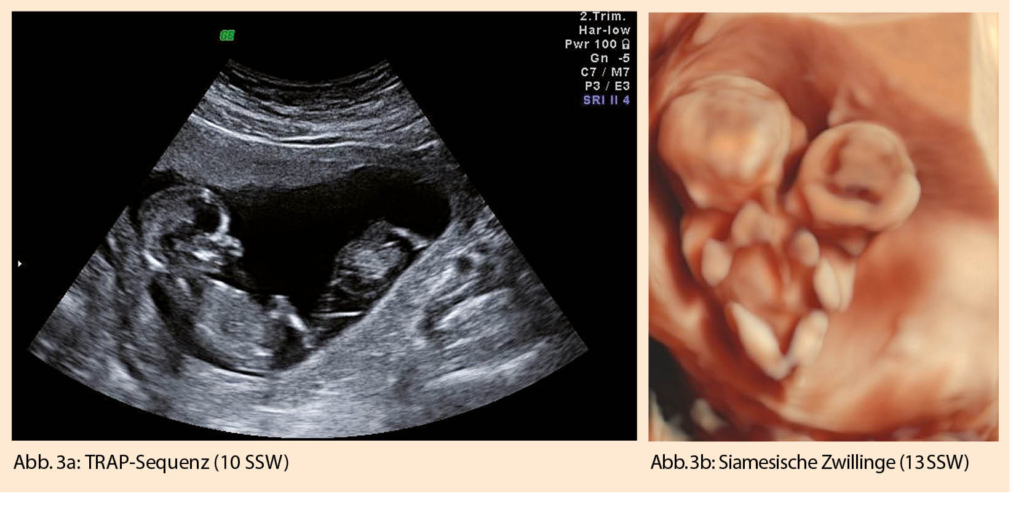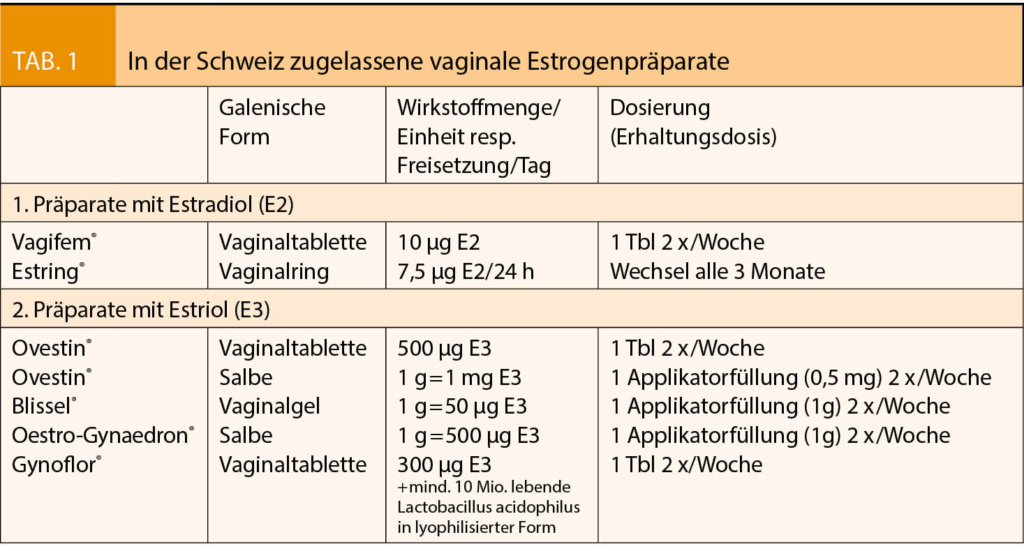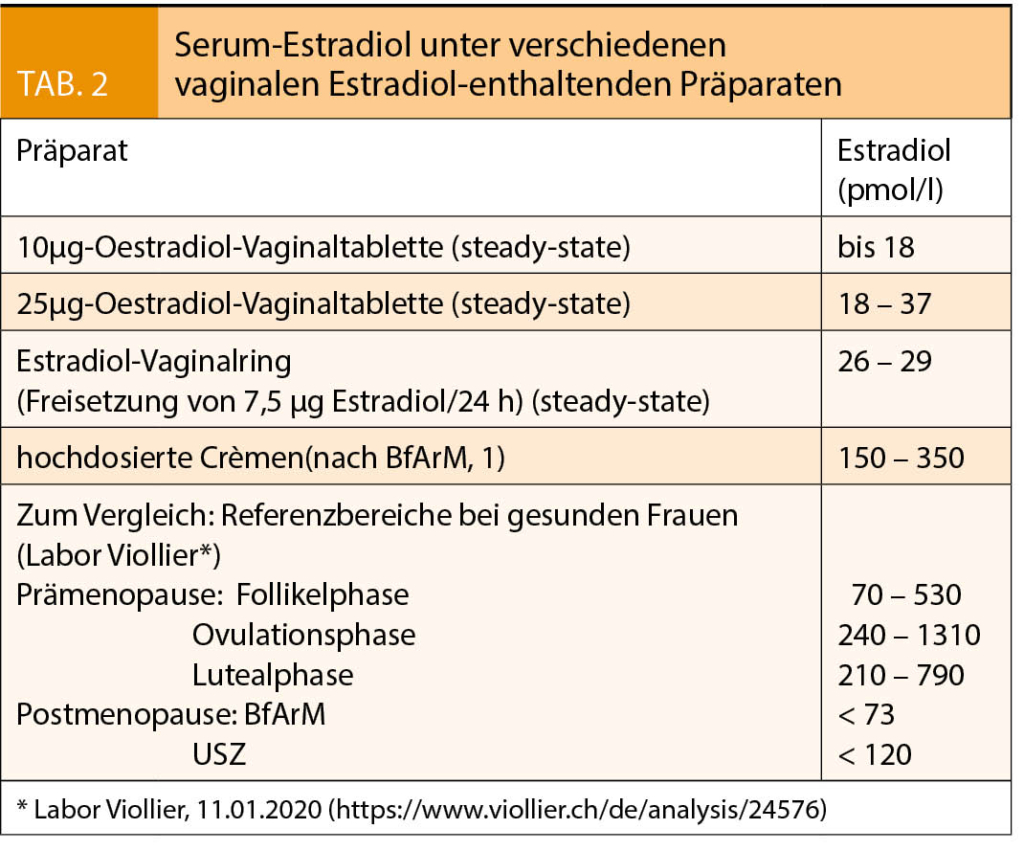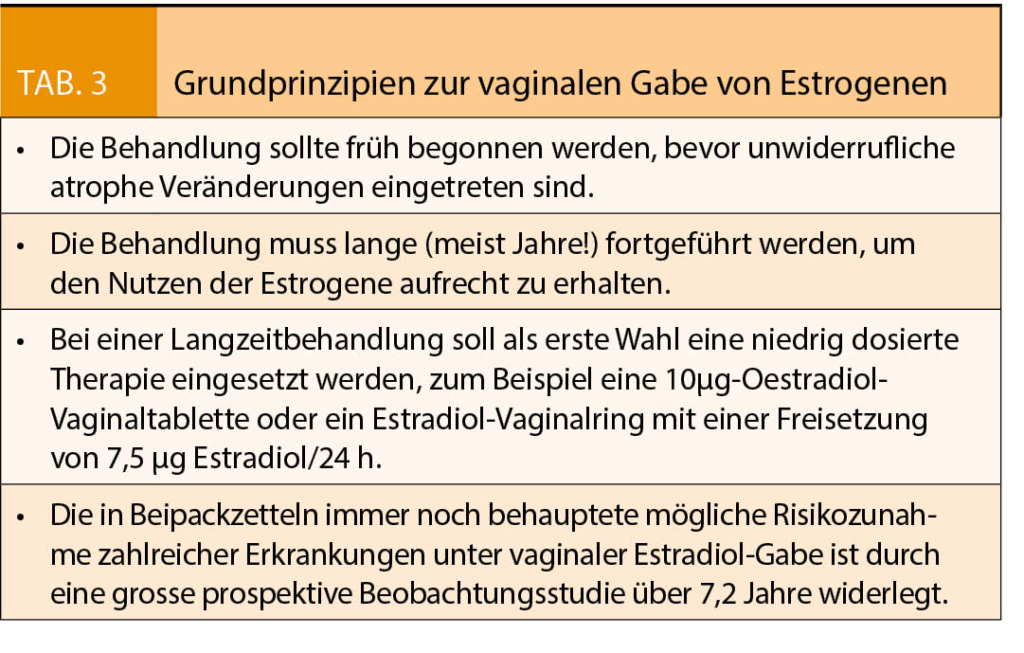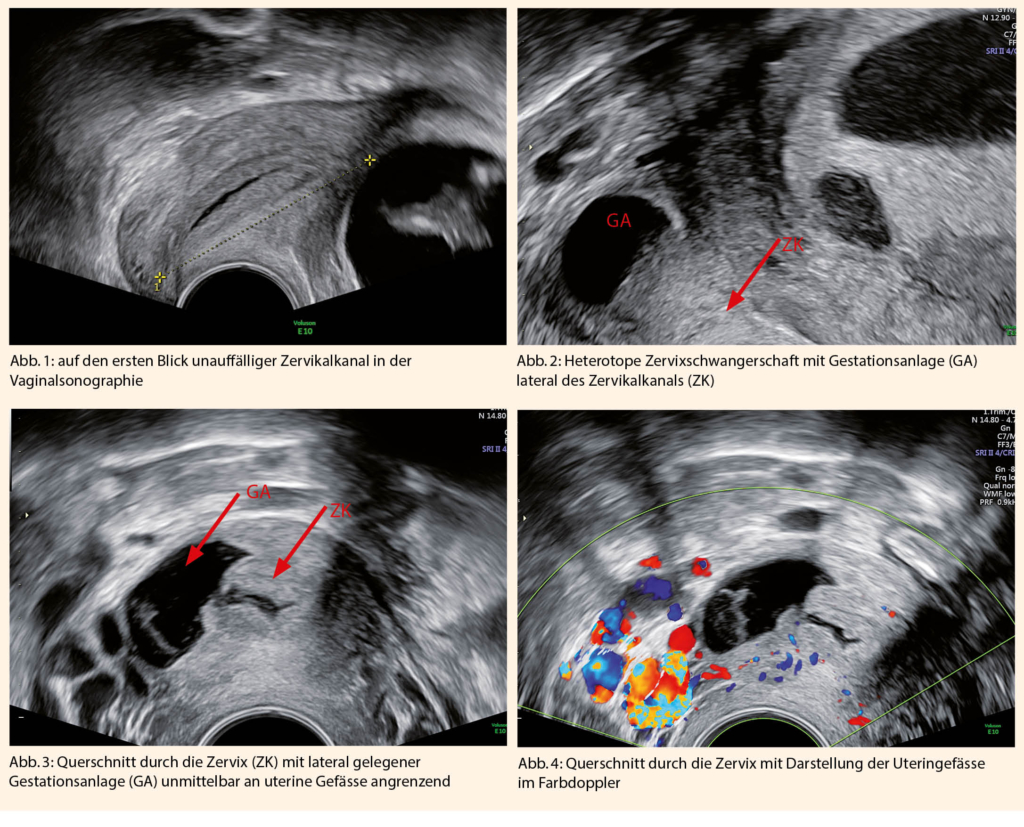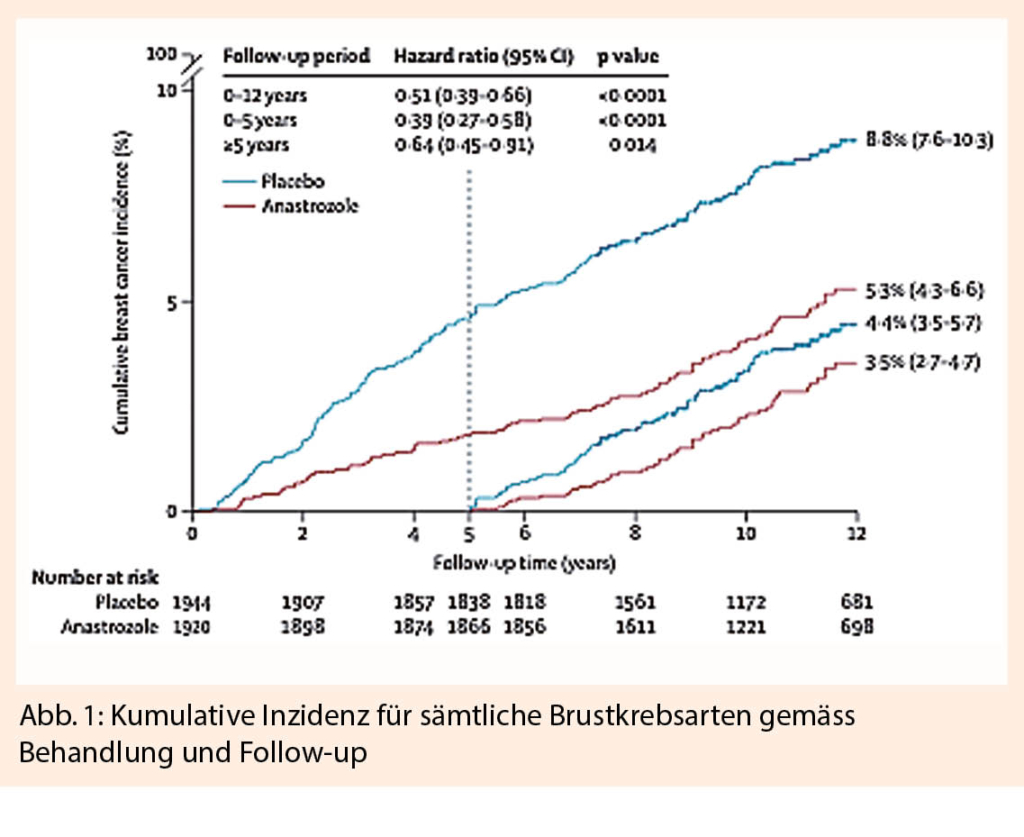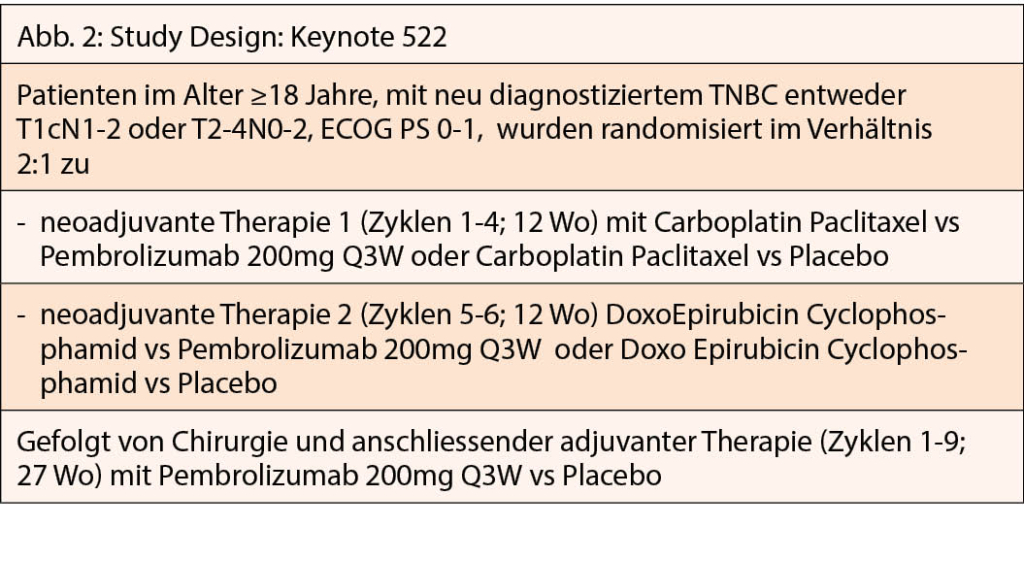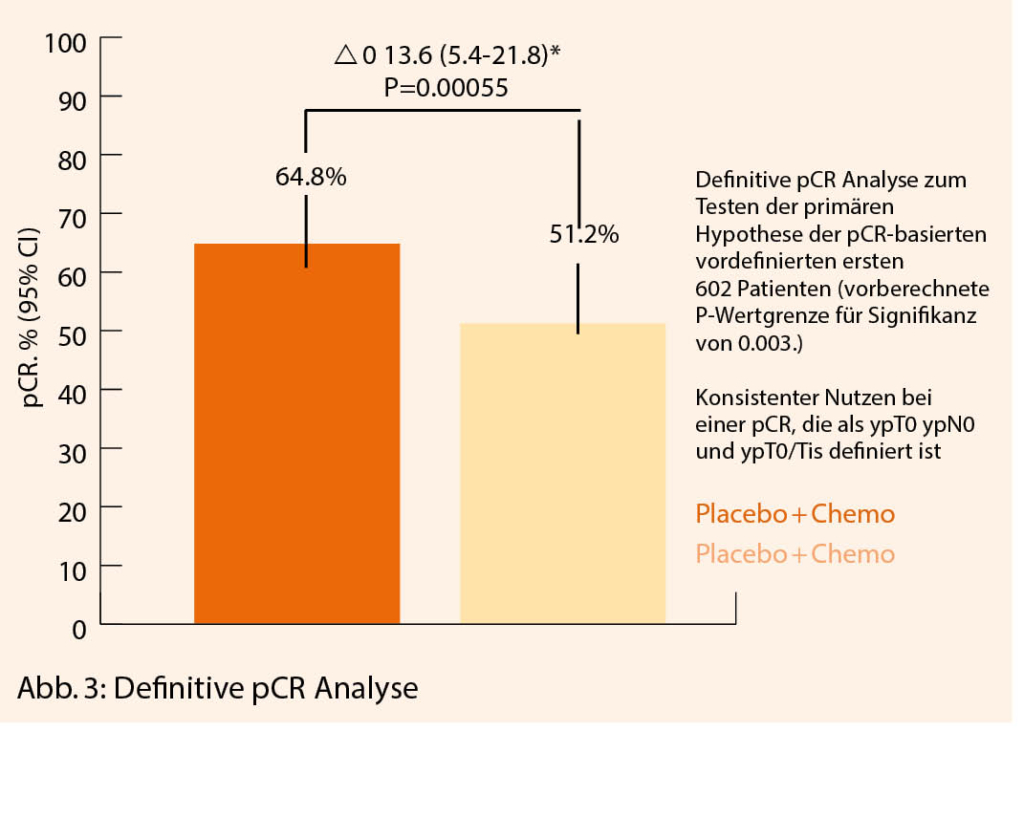Der erste «Corona-Patient» in der Schweiz wurde in Lugano in eurem Spital Moncucco behandelt. Wie seid ihr auf die Diagnose gekommen und wie war der Verlauf?

D. Hagara: Der erste Coronavirus-Patient war ein 70-jähriger Zahnarzt, der sich wahrscheinlich bei einem Ärztesymposium in Mailand angesteckt hat. Die Diagnose wurde am 25.2.2020 gestellt, da bei uns im Spital Moncucco bereits ab 24.2.2020, also 3 Tage nach den alarmierenden Nachrichten der Lombardei, eine Notfalltriage auf Covid errichtet worden war. Dieser Patient wurde regelhaft isoliert und hatte in der Folge einen guten Krankheitsverlauf. Seine durchgemachten sozialen Kontakte wurden in Zusammenarbeit mit dem Kantonsarzt zurückverfolgt.

A. Cerny: Am 7.2. hatten wir schon einen jungen Patienten auf dem Notfall gesehen, welcher seit kurzem aus China zurückgekehrt war. Gottlob waren seine Grippesymptome nicht auf das SARS CoV-2 zurückzuführen. Diese Erfahrung half uns, das interne Dispositiv zu verbessern. Obschon wir täglich von den Ereignissen in den italienischen Medien informiert worden waren, traf uns die Epidemie mental unvorbereitet. Es ist die enorme Geschwindigkeit der Ausbreitung, welche wir alle unterschätzten.
Was waren die unmittelbaren Konsequenzen aus diesem ersten Fall fürs Personal, Spital und den Kanton?
D. Hagara: Bereits in dieser ersten Woche nach den Ereignissen in der Lombardei wurden in unserem Spital wie auch im Kanton Krisenstäbe täglich abgehalten. Meiner Meinung nach war die Tragweite der Geschehnisse allen Akteuren des Gesundheitswesens wie auch den politischen Kräften klar. Die ersten Entscheidungen waren aber zunächst sehr umstritten: so wurde der Karneval von Bellinzona noch abgehalten und Grossanlässe wie z.B. Sportanlässe wurden durchgeführt. Am 26.2.2020 wurden dann Karneval und Grossanlässe verboten. Die Schulen aber blieben weiterhin geöffnet und wurden dann erst am 11.3.2020 (post-obligatorische Schulen) und 16.3.2020 (alle) geschlossen.
In unserer Klinik wurden bereits nach 2 Tagen Massnahmen auf der Notfallstation ergriffen, die dem Covid-Verdacht Rechnung trugen. Nach einer Woche wurden stationäre Betten errichtet für die Covid-Verdachtsfälle. Es wurde erst nach 10 Tagen eine allgemeine Maskentragpflicht des Personals eingeführt.
Wie konnte der ambulante und stationäre Spitalbetrieb aufrechterhalten werden, auch um Schaden bei Patienten mit anderen Problemen abzuwenden?
D. Hagara: Wie das Tessin stark mit der Lombardei verknüpft ist, zeigt folgende Anekdote: eine 80-jährige Frau wurde am 2.3.2020 (also in einer Zeit, als die Klinik die Sicherheitsmassnahmen hochfuhr) bei uns wegen einer Synkope aufgenommen. Beim Eintritt klagte sie über keinerlei Beschwerden, die auf Covid hingewiesen hätten. Erst nach 2 Tagen stellte sich heraus, dass diese Frau, die ihre Angehörigen im Tessin hat und sich oft im Tessin aufhält und auch in der Schweiz versichert ist, am 22.2.2020 von der roten Zone in Lodi (Lombardei) «geflüchtet» ist, um bei ihren Kindern im Tessin zu verweilen. Unmittelbar auf Covid positiv getestet, zeigte sie einen akut sich verschlechternden Verlauf mit intensivmedizinischer Beatmung. Diese Episode führte in der Folge dazu, dass sich 5 Mitarbeiter und 1 Patientin auf dieser Abteilung mit dem Covid infiziert haben.
Wie hat diese Corona-Pandemie euren beruflichen Alltag verändert? (z.B. wie habt ihr die vielen Coronapatienten betreut, welche nicht, beziehungsweise nicht mehr, intensivmedizinisch behandelt werden mussten? Zusammenarbeit mit niederge-lassenen Kollegen etc.)
D. Hagara: In unserer Gemeinschaftspraxis haben wir sofort täglich einen Krisenstab durchgeführt. Ambulante Patienten wurden ab sofort einen Tag vor der geplanten Visite telefonisch auf eventuelle grippeähnliche Symptome befragt. Wir haben auch sofort hygienische Massnahmen erarbeitet und umgesetzt für Covidverdachtsfälle. Dies trifft ebenfalls auf Niveau der Klinik zu. Mitte März wurde die gesamte Klinik in eine Klinik verwandelt, welche ausschliesslich Covid-Patienten aufnimmt mit max. 180 Spitalbetten und 40 Intensivplätzen.
Die niedergelassenen Ärzte waren am Anfang überfordert, v.a. aufgrund von mangelndem Schutzmaterial. Letzteres wurde dann durch die Tessiner Ärztegesellschaft den niedergelassenen Ärzten zu Verfügung gestellt. Ebenfalls hat die Ärztegesellschaft in der Folge sogenannte Checkpoints errichtet, wo die Covid-Beurteilung und Diagnose mittels Nasenabstrich durchgeführt werden konnte.
Wie hat diese Corona-Pandemie euren persönlichen Alltag verändert?
D. Hagara: Mir erscheint diese relativ kurze Zeit von 2 Monaten wie gefühlte durchgemachte 3 Jahre. Dies aufgrund von einer Vielzahl von neuen Anforderungen, wie unzählige Telefonate, Kommunikation und Kollaboration mit Ärzten, Hygienemassnahmen, etc.
Am 4.4.2020 habe ich mich mit dem Coronavirus angesteckt: Die Krankheit ist bei mir relativ glimpflich verlaufen, vielleicht gerade, weil ich sofort mit Plaquenil 3x200mg, Azithromycin 1x500mg und Clexane 80 U s.c.1×1 angefangen habe (mit prompter EKG-Kontrolle). Nach ein paar Tagen mit deutlichen Grippesymptomen wurde ich von einem trockenen Husten eingeholt, der über 3 Wochen anhielt. Für meine Familie bedeutete diese Krankheit, dass ich währende 4 ganzen Wochen komplett isoliert in einem Zimmer blieb (zum Glück mit einem separaten WC), sodass sich niemand meiner Familie angesteckt hat.
A. Cerny: Es ging alles viel schneller, sehr viele Kommunikationen auf allen Kanälen, oft wusste ich gar nicht mehr, welchen Wochentag wir hatten, wenig Schlaf und stressige Träume.
Wie habt ihr euch lokal und international ausgetauscht, um die Diagnostik und Behandlung zu optimieren?
A. Cerny: Ja, wir hatten enge Kontakte mit unseren Kollegen in Mailand, Pavia, Bergamo und Parma und hatten so Zugang zu vielen Informationen wie dem Thromboserisiko, den ersten Erfahrungen mit antiviralen Substanzen und Immunsuppressiva und bekamen regelmässig die letzten Versionen ihrer Guidelines. Wir erfuhren auch vom stark erhöhten Risiko, sich bei der Arbeit mit dem Virus zu infizieren. Wir tauschten diese Erfahrungen regelmässig mit Kollegen in der Deutschschweiz und im Welschland aus, welche initial etwas skeptisch waren.
Was kam von wissenschaftlicher Seite dazu, wie z.B. Studienteilnahme, Compassionate use Programme, Patienten-Register oder Biobanking etc.
A. Cerny: Die neuesten Studienresultate wurden rasch untereinander ausgetauscht und in unserer WhatsApp-Gruppe rege diskutiert. Bei uns und auch im Ente Ospedaliero wurden das Compassionate-use Programm für Remdesivir regelmässig benützt und es wurden verschiedene Studien begonnen. Dank grosszügiger und unkomplizierter Unterstützung von Privaten konnten wir eine Biobank für COVID-19 Patienten aufbauen, welche gekoppelt mit einer klinischen Datenbank helfen wird, diese heimtückische Erkrankung in Zukunft besser zu verstehen.
Wie hat sich die mediale und kommunikative Begleitung angesichts der Bedrohungslage abgespielt?
A. Cerny: Da ich die Landessprachen spreche und meine Infektiologen-Kollegen im Krisenstab eingebunden waren und somit weniger frei waren, über die Ereignisse zu berichten, wurde ich oft von den Medien im Tessin und anderswo in der Schweiz angefragt. Mir war es wichtig, vor allem in der Anfangsphase, als der Rest der Schweiz noch keine konkrete Erfahrung mit der Krankheit und deren Gefährlichkeit hatte, darüber zu berichten.
Wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden und Medien? (Haben die Behörden in dieser Notlage zeitgerecht und angemessen gehandelt, sowohl gegenüber der Bevölkerung wie auch gegenüber den Ärzte-Pflegenden etc?)
D. Hagara: Im Nachhinein ist es immer leicht zu kritisieren. Denn es musste schnell gehandelt werden. Für einige wichtige Massnahmen, wie zum Beispiel Contact Tracing, fehlte es sowohl an Zeit als auch Personal. Der grosse Fehler allerdings war in der Anfangsphase die Zulassung des Bellinzoneser Karnevals, welche meiner Meinung nach der breiten Ansteckung der Bevölkerung Vorschub leistete. In der folgenden Phase hat man auch den Altersheimen zu wenig Beachtung geschenkt, was man an der sehr grossen Zahl der Toten in Altersheimen ersehen kann (fast 50% der Toten im Tessin).
Wie seht ihr die Rolle der WHO und der internationalen politischen Zusammenarbeit in dieser und auch kommenden Pandemien?
A. Cerny: In der Anfangsphase war die Mensch-zu-Mensch-Übertragung noch in Frage gestellt und die Gefährlichkeit der Krankheit unterschätzt worden. Wie sehr politische Einflüsse den raschen Austausch vitaler Informationen behinderte, wird sicher Teil der Aufarbeitung dieser katastrophalen globalen Krise sein. Der Ende Februar publizierte Report, der von Experten der WHO und des chinesischen CDC verfasst worden war, war trotzdem sehr hilfreich. Leider hat sich ausser Italien kaum ein Land daran gehalten. Ich denke, wir hätten uns auch auf Nationaler Ebene mehr mit italienischen Experten und Behörden austauschen sollen.
Welches sind für euch die wesentlichsten Erkenntnisse für eine zukünftige Pandemie für unser Land?
D. Hagara: Ich sehe keine einzeln eruierbare Erkenntnis, aber bin der Überzeugung, dass diese Pandemie global äusserst viel verändern wird. Die Menschheit hat vor allem erfahren, dass das, was als selbstverständlich galt, in einem Augenblick nicht mehr sicher sein kann. Und: Händewaschen wird nicht mehr nur eine Frage der Hygiene sein, sondern eine Frage des Überlebens.
A. Cerny: Das Pandemiekonzept wird sicher überarbeitet werden müssen, dieses muss raschere Entscheidungsprozesse vorsehen, die Reserven an persönlichem Schutzmaterial und Desinfektionsmaterial müssen angepasst werden. Das Kommunikationskonzept von Bund und Kantonen muss verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf Klarheit und Koordination. Die rasche wissenschaftliche Aufarbeitung neuer Erkenntnisse muss verbessert werden, insbesondere sollte die Task Force in eine ständige Beratungseinheit übergeführt werden, welche sich vermehrt mit WHO und ECDC austauscht und auch im Inland offene Kanäle mit den wichtigen Stakeholdern wie z.B. der forschenden Pharmaindustrie, den Universitäten und Swissmedic etabliert.
Nun werden zunehmend Lockerungen wirksam: seid ihr auf eine weitere Welle gefasst und was ist die persönliche Erwartung in die nahe Zukunft (z.B. Stichwort: Neue Normalität, Medikamente und Impfung?)
A. Cerny: Ich erwarte eine erneute Zunahme der Fälle Ende Juni anfangs Juli. Die Lockerungs-Massnahmen betreffen zu rasch gleichzeitig weite Bereiche des öffentlichen Lebens und ich befürchte, dass das «contact tracing» bei einem erneuten Anstieg der Fälle rasch dekompensiert. Die nächsten Wochen im Mai und Juni, wo wir weiterhin wenig neue Fälle sehen werden, könnten für viele als Zeichen missgedeutet werden, dass der «böse Traum» vorbei sei und dass wir unsere normalen Sommeraktivitäten wieder aufnehmen dürfen. Es wird vermehrt Stimmen geben, welche den Lockdown als unnötig bezeichnen und Verantwortlichkeiten fordern. Unser Spital und Ambulatorium werden die Achtsamkeit bestimmt nicht vermindern und sicherstellen, dass wir nicht wieder auf dem linken Fuss erwischt werden.
Zur Bewältigung der zweiten Welle hoffen wir auf neue Medikamente, die Resultate der vielen z.T. schon abgeschlossenen und z.T. noch laufenden Studien sollten uns neue Informationen zur Pathogenese und Impulse für die Behandlungen geben. Ich zweifle, dass wir im Juli schon soweit sind. Die Impfung scheint noch weit weg.
medinfo bedankt sich ganz herzlich bei Prof. Dr. med. Thomas Cerny, der dieses Interview organisiert und geführt hat.