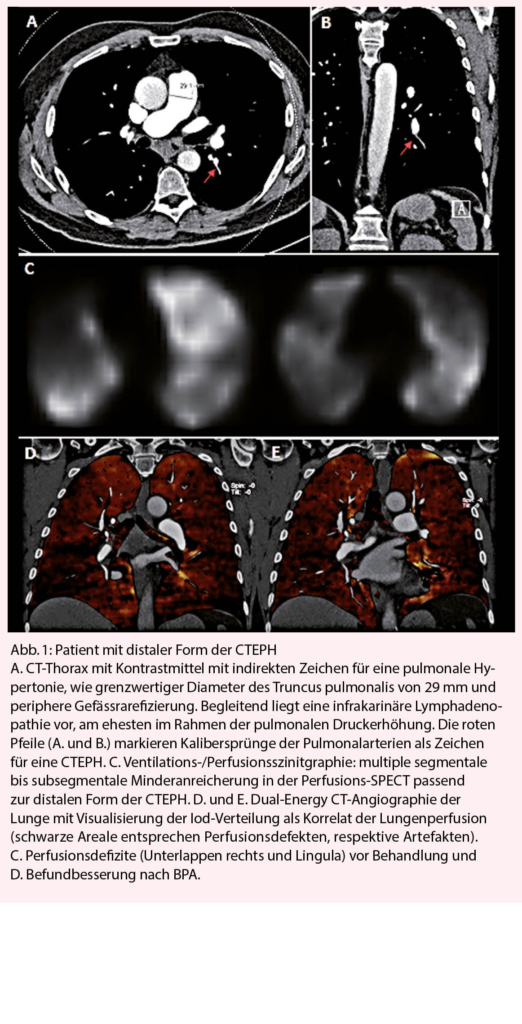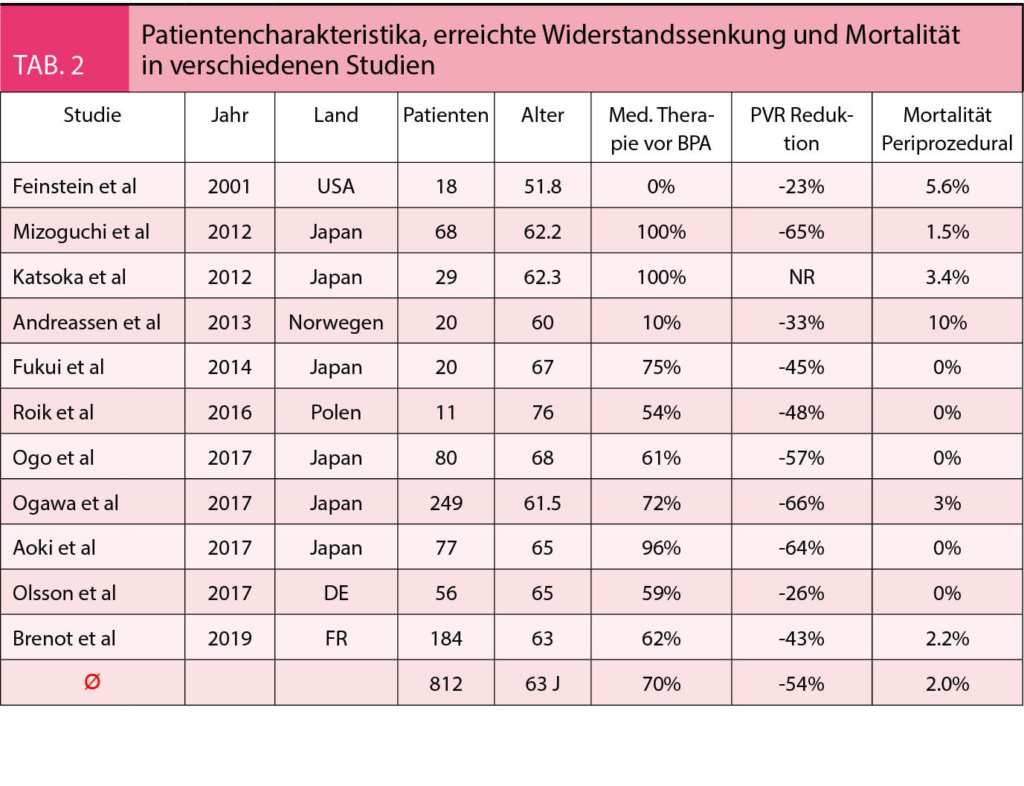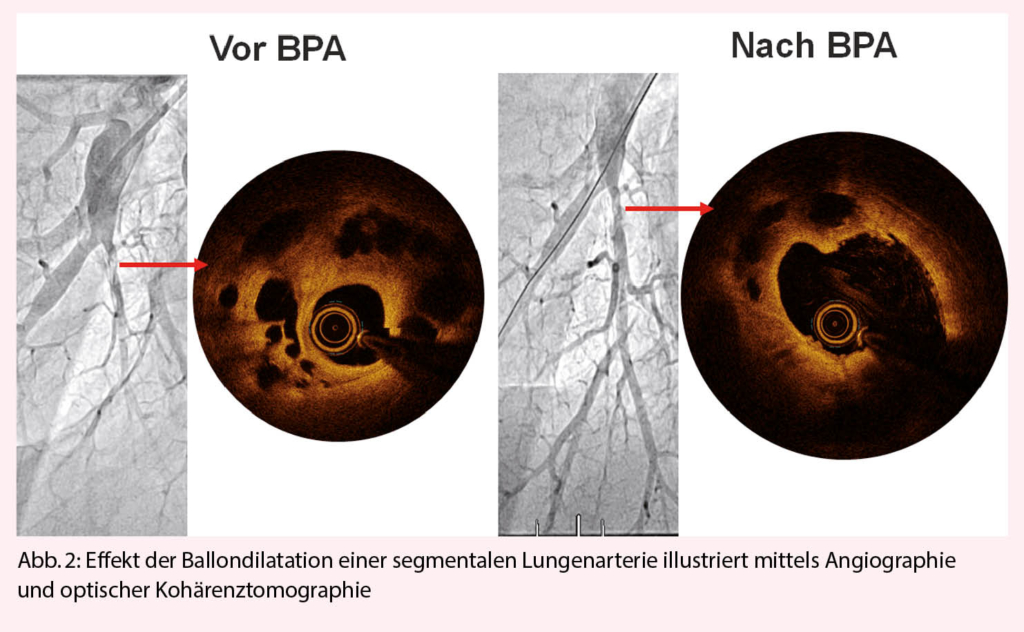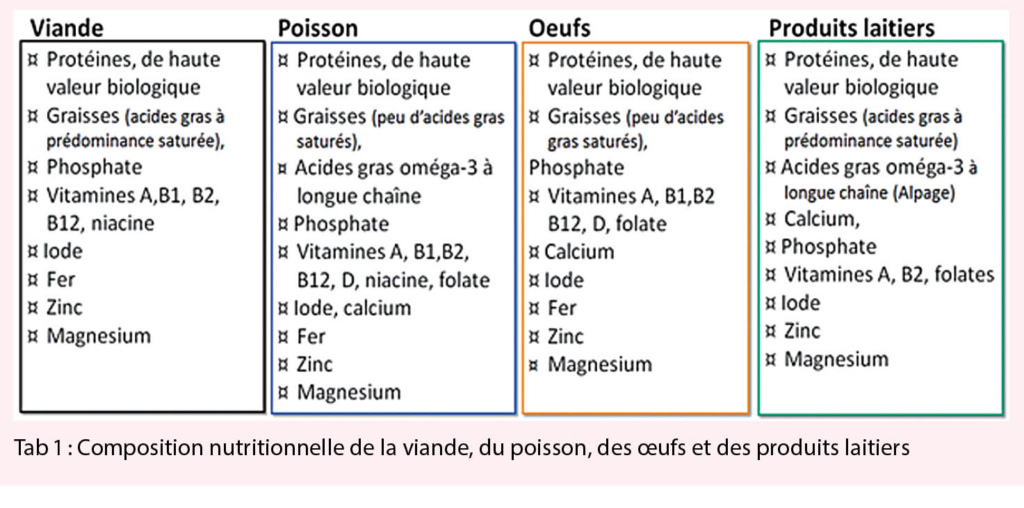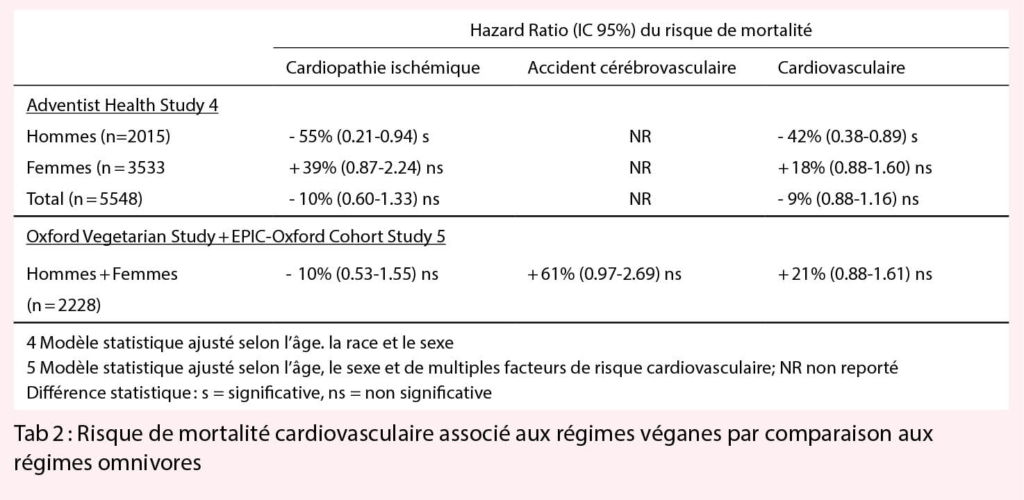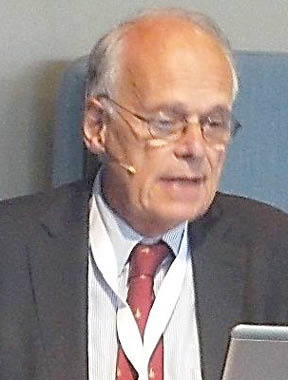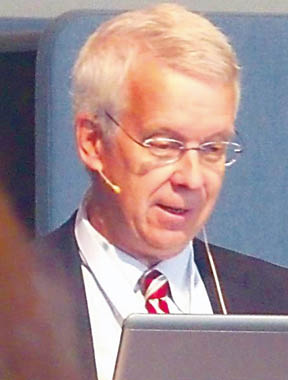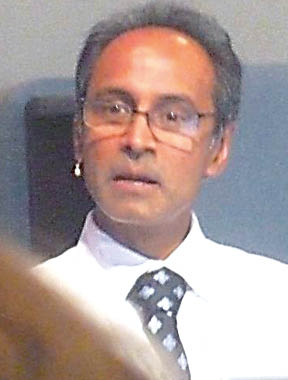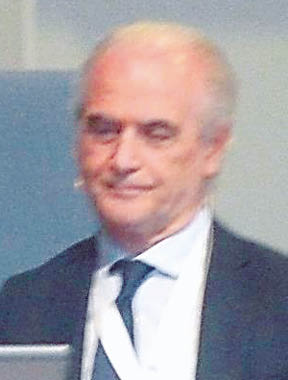Am traditionellen 22. Kongress für praktische Gynäkologie und Geburtshilfe in Näfels widmete sich Frau Dr. med. Nina Manz, Triemlispital Zürich, dem Thema Kontrazeption in der Adoleszenz.
Der heranwachsende Mensch macht in der Adoleszenz wichtige psychische und physische Entwicklungsprozesse durch u.a. die Entwicklung der Geschlechtsreife. Diese Phase umfasst die Pubertät und dauert ungefähr vom 10-20-Lebensjahr, gemäss Wikipedia. In der frühen Adoleszenz besteht ein egozentrischer Umgang mit Sexualität, in der mittleren Adoleszenz folgen erste romantische und beginnende monogame Beziehungen, während die späte Adoleszenz mit emotionaler Reife, Verantwortungsbewusstsein einhergeht, so die Referentin.
Das Verhütungsverhalten von Jugendlichen
Gemäss einer Studie des BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, eine deutsche Bundesbehörde) aus dem Jahre 2015 zum Verhütungsverhalten, ersten sexuellen Erfahrungen und Aufklärung ergibt sich, dass 6% der weniger als 14-Jährigen sexuelle Aktivitäten haben!! (die Jungen: 2-3 Jahre später). Bei den 17-Jährigen haben mehr als 50% sexuelle Erfahrungen und bei den 19-Jährigen hatten 90% «das erste Mal». Die These, dass Jugendliche immer früher sexuell aktiv werden, bewahrheitet sich nicht. Was die Verhütung betrifft, verwendeten 1980 20% der Mädchen keine Verhütung beim ersten Mal. Im Jahr 2015 waren es noch 8%. Aus den Schweizer Zahlen aus «Fact Sheet Sucht.ch» 2016 (1) geht hervor, dass 80% der 14-25-Jährigen Mädchen und 82% der Jungen ein Kondom beim «ersten Mal» benutzten. Aber 1/5 der Jugendlichen weist keinen Schutz durch Kondom auf.
Geschlechtsverkehr und Verhütung bei den Jugendlichen in der Schweiz gemäss Fact Sheet
Im internationalen Vergleich sind die Zahlen in der Schweiz niedrig: Zw. 15-19 Jahren: 3,3/1000 Jugendliche. Zum Vergleich sind es 16/1000 Jugendliche in Deutschland und 84/1000 Jugendliche in USA (Zahlen vom Schweizer Bundesamt für Statistik, Via Meldung an den Kantonsarzt und Profamilia).
Formen der Kontrazeption – alles geht ausser Sterilisation
Diese umfassen die Barrieremethode (Kondom, Femidom), die hormonelle Kontrazeption (komb. vs rein Gestagen), IUDs (Kupfer vs. LNG-haltige), Notfallkontrazeption (Norlevo vs. Ulipristalacetat). Das Kondom hat einen besonderen Stellenwert: Es ist das einzige Kontrazeptivum mit Schutz gegen sexuell übertragene Krankheiten, es ist nebenwirkungsfrei und es ermöglicht die «Vaterschaftsverhütung». CAVE Nachteile: es weist einen schlechten Pearl Index auf wegen Anwendungsfehlern und es besteht das Problem der Latexallergie.
Kontrazeption durch hormonelle Methoden
Kombinationen von Östrogen/Gestagen: – Komb. (östrogen/gestagen), Ovulationshemmer: – «Pille», – Mikropille (20 vs. 30μg EE), – Langzyklus, – Patch, – Ring.
Rein Gestagen haltige Methode: – «Pille», – Minipille (LNG vs. Desogestrel), – Depot (s.c. vs. i.m.) (Medroxyprogesteronacetat), – Implantat subdermal (Etonogestrel).
Die Vorteile der kombinierten Ovulationshemmer sind:
Zusatznutzen aufgrund der Kombination Östrogen/Gestagen und bei Verwendung eines Gestagens mit spez. Wirkung, z.B. antiandrogen wirkendes Gestagen zur Verbesserung des Hautbildes,
Zyklusabhängige Beschwerden werden vermindert (Dysmenorrhoe, Hypermenorrhoe), Hoher Pearl Index bes. im Langzyklus, Günstiger Einfluss bei Anämie und/oder Blutungsneigung, Senkung des Risikos für Ovarialkarzinom. Der wichtigste Nachteil der Kombinationspräparate ist das seltene Thromboserisiko (Jugendliche <18 Jahre mit LNG-haltigen Kombinationspillen: <1:1’000 Frauenjahre). Die Kontraindikationen müssen beachtet werden (Migräne, Nikotin, positive thromboembolische FA) und die WHO-Klassifikation «Elegibility criteria forcontraception»: Spotting, Gewichtszunahme durch Appetitzunahme, Kopfschmerzen, unzureichende Compliance/Adhärenz (generell ist die Adhärenz bei chronischer Medikamenteneinnahme schlecht, bei der Kontrazeption unregelmässige Einnahme bis zu 70%), unzureichende Zunahme der Knochendichte.
Die Vorteile der rein gestagenhaltigen Kontrazeption sind:
Sie sind auch bei Kontraindikation gegen Östrogene einsetzbar (z.B. Migräne mit Aura), sie sind vorteilhaft bei Dys- u. Hypermenorrhoe und sie haben einen guten Pearl Index.
Die Nachteile der rein gestagenhaltigen Kontrazeption sind schlechte Zykluskontrolle, keine positive Wirkung auf die Haut, Gewichtssteigerung unklar (evtl. bei Medroxyprogesteronacetat) und möglicherweise negative Wirkung auf die Psyche.
Die WHO-Medical Elegibility Criteria, CDC bedeuten:
- Kategorie 1: keine Einschränkungen (A always usable)
- Kategorie 2: Vorteil überwiegt (B broadly usable)
- Kategorie 3: Nachteil überwiegt meist (C counseling/caution)
- Kategorie 4: absolut kontraindiziert, Aufklärung bei Anwendung (Do not use)
- www.who.int/reproductivehealth/publications/family…/Ex…/en/
Kontrazeption mit IUDs
Die IUDs gehören zur long acting reversible contraception (LARC). Sie sind 100% reversibel. Es gibt keine Complianceprobleme. Die IUDs haben einen optimalen Pearl-Index. Sie sind kostengünstig (bei Langzeitanwendung) und sicher auch bei Adoleszentinnen und Nullipara einsetzbar. Es wird eine leicht erhöhte Rate an Dislokationen festgestellt. Die Zervixdysplasie stellt keine Kontraindikation dar und es gibt keine höheren Raten für pelvic inflammatory disease und EUG. Wenn allerdings unter einem IUD einer Schwangerschaft eintritt, muss aktiv eine EUG ausgeschlossen werden. Die Cu-haltigen (> 300 mm2) und die LNG-haltigen gelten im klinischen Alltag als gleich sicher. Kupfer PI 0,2-1 Mona Lisa Cu380 enthält 380 mm2.
(ML Cu375S mit 29,4×19,5 mm, ML Cu380Mini 30×24 mm)
- Levonogestrel PI 0,1-0,2 Jaydess 13,5 mg, Kayleena 19,5 mg (30×29 mm) Mirena 52mg (32×32 mm)
- Rahmenlose IUD PI 0,2-1 Gynefix, IUB
Bei Jugendlichen nicht empfohlen: IUB: da Expulsionsrate hoch, Gynefix: unnötige «Invasivität», Mindestdicke des Myometrium muss 10mm sein. - Gold PI 0,3-0,7 Goldluna®: kein klarer Vorteil zu Cu-IUD, Preishöher.
Für alle IUDs gilt: Einlage erst nach Geschlechtsverkehr, Cavumlänge mit transvaginalem Ultraschall und Hysterometer bestimmen.
Notfallkontrazeption
Norlevo® (Levonogestrel 1,5 mg) bis nach 72 h einsetzbar.
Ella-One® (Ulipristalacetat 30 mg) bis nach 120 h einsetzbar.
Ella-One® = Progesteronrezeptormodulator: verschiebt die Ovulation, beeinträchtigt die Tubenmotilität, führt zu asynchroner Endometriumproliferation.
Achtung: Nach Ella-One®-Einnahme die KOH-Einnahme während 5 Tagen pausieren. Auch der Progesteroneffekt der KOH wird durch Ella-One® gehemmt: Zusätzlich 14 Tage Kondom, keine Teratogenität, Mehrfachanwendung in einem Zyklus möglich (ist allerdings nicht empfohlen).
Besondere Aspekte in der Adoleszenz
Knochendichte
«Peak bone mass»: bis zum 25.-30. LJ kommt es zum Wachstum und Dichtezuwachs des Knochens.
Positiver Einfluss auf «peak bone mass»:
Östrogen, Ca-reiche Ernährung, Vitamin D, belastende Bewegung
Negativer Einfluss auf «peak bone mass»:
Depot Gestagene und Mikropillen (<20 mg), Nikotin, tiefer BMI
Bei KOH-Einnahme wird die eigene Östrogenproduktion gehemmt, daher bei unter 18 Jahren möglichst 30µg EE (z.B. Mikrogyn 30®).
Krebsrisiko und hormonhaltige Antikonzeption
Mamma-Karzinom: leicht erhöht bei hormonhaltigen AK (nicht CU-IUD). Eine retrospektive Cohortenstudie im NEJM März 2018 bei insgesamt 19,6 Millionen Frauenjahre ergab ein höheres Risiko für BC bei Frauen, welche zurzeit oder kürzlich hormonale Empfängnisverhütung verwendet hatten, im Vergleich zu Frauen, welche niemals hormonelle Verhütungsmethoden angewandt haben. Je länger die Anwendung desto höher das Risiko, jedoch insgesamt war die absolute Erhöhung des Risikos sehr niedrig (2). Ein zusätzlicher Fall von Mamma-Ca auf 7690 Frauen, die ein Jahr hormonell verhütet haben. Beim Ovarial-Karzinom ergibt sich eine Risikoreduktion im 2-stelligen Prozentbereich bei KOH (3), beim Endometrium-Karzinom eine Risikoreduktion bei KOH und Gestagenen/IUD und beim Zervix-Karzinom eine leichte Risikoerhöhung bei KOH (HPV-assoziiert).
Kontrazeption in Spezialsituationen: Epilepsie
Die geschätzte Prävalenz der Epilepsie beträgt 0,3-0,7%. 50% der Schwangerschaften von Frauen mit Epilepsie sind ungeplant. Schwangerschaften bei Epilepsie sind Risikoschwangerschaften (Hypertonie, Präeklampsie, small for gest. age, Frühgeburtlichkeit…). Nur 7% der Frauen mit Epilepsie erhalten eine ausreichende Beratung über Antikonzeption. Grundsätzlich sind alle Methoden der Kontrazeption möglich.
CAVE: Hormonelle Kontrazeption u. Antiepileptika: Bidirektionale Arzneimittelinteraktion (Enzyminduktion über CYP450, Uridin-Diphosphat-Glucuronosyltransferase) (4). Hormonelle Antikonzeptiva senken den Antiepileptika-Spiegel (Anfallsdurchbruch). Dabei sind Senkungen bis zu 60% möglich. Der Effekt kommt vom EE. Gestagen wirkt nicht auf die Spiegel von Antiepileptika. Auf der anderen Seite senken Antiepileptika den Spiegel der hormonellen Antikonzeptiva (Versagen der AK). Es wird daher eine rein gestagenhaltige Kontrazeption empfohlen, falls KOH: Langzyklus, Spiegelkontrolle.
Effekt von Hormonen auf Epilepsie: Östrogene wirken prokonvulsiv, Gestagene antikonvulsiv. Zu KOH gibt es keine Studien, trotz >50 Jahre Gebrauch von KOH.
Weitere Spezialsituationen sind Anorexie und Adipositas
Die Anorexie ist eine schwere chron. psychiatrische Erkrankung. Sie ist gekennzeichnet durch starkes Untergewicht (15% unter erwartetem Normalgewicht), signifikanten Gewichtsverlust, selbst herbeigeführt, Körperschemastörungen, umfassende hormonelle Funktionsstörungen (z.B. Amenorrhoe, verzögerte Pubertät, Osteoporose), Häufigkeit 0,2-1% (Frauen zw. 15-25LJ), peak 14-15 LJ. Häufig psychiatr. Komorbiditäten (Depression, Angst-Zwang).
Alle Methoden der Kontrazeption sind möglich (ausser Depot-Gestagen), KOH nur bei sexuell aktiven Mädchen, nicht als Therapie (häufig schlechte Compliance) sonst Hormontherapie mit Estradiol (günstig auf Knochen) (5).
Von Adipositas spricht man ab einem Übergewicht mit BMI > 30 kg/ m2. Sie führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und erhöht das Risiko von Folgeerkrankungen, wie das metabolische Syndrom.
Es wird unterschieden zwischen milder Adipositas (30-35 kg/m2), mittlerer Adipositas (35-40 kg/m2), schwerer Adipositas (> 40 kg/m2).
Alle Methoden der Kontrazeption sind möglich. Mittlere und schwere Adipositas gelten allerdings bei den KOH als relative KI. Speziell zu beachten sind bei KOH: keine weiteren KI, positive Wirkung bei PCOS, Akne, Hirsutismus, bei zusätzlicher unbehandelter Hypertonie: KI für KOH, Patch: unsicher ab > 90 kg, Desogestrel und Medroxyprogesteronacetat sicher, Implanonwechsel schon nach 24 Monaten. CAVE: Thromboserisiko steigt bei Adipositas (24fach ab BMI > 30) (5).
Fazit
Die Referentin schloss ihre Ausführungen mit der folgenden Take Home Message ab.
- Adoleszentinnen befinden sich in einer sensiblen Lebensphase
- Aspekte wie Risikoverhalten, Adhärenz u. Compliance bei medikamentöser Therapie und Bedarf nach hoher Sicherheit müssen berücksichtigt werden
- Es steht eine grosse Palette von sicheren Kontrazeptiva zur Auswahl mit wenigen Einschränkungen (z.B. Grösse des Uterus bei IUD, Effekt auf Knochendichte bei jungen Adoleszentinnen)
- Adoleszentinnen mit chron. Erkrankungen (z.B. Epilepsie, Anorexie) benötigen im besonderen Mass eingehende Beratung und Aufklärung bezüglich Kontrazeption
Quelle: 22. Kongress für praktische Gynäkologie und Geburtshilfe, Näfels 2019, 7. Nov. bis 8. Nov.
riesen@medinfo-verlag.ch
1. K1. Archimi, A ., Windlin, B ., & Delgrande Jordan, M. (2016).
2. Nachtigall, L et al. Contemporary Horm onal Contraception and the Risk of Breast Cancer. NEJM, 2018. 378: 1265
3. La Vecchia, C et al.Ovarian cancer: epidemiology and risk factors. Eur J Cancer Prev. 2017; 26:55-62
4. Arne Reimers Contraception for women with epilepsy: counseling, choices, and concerns. J Contracept. 2016; 7: 69–7
5. Thomas Römer, Gunther Göretzlehner, Kontrazeption m it OC, P roblemsituationen