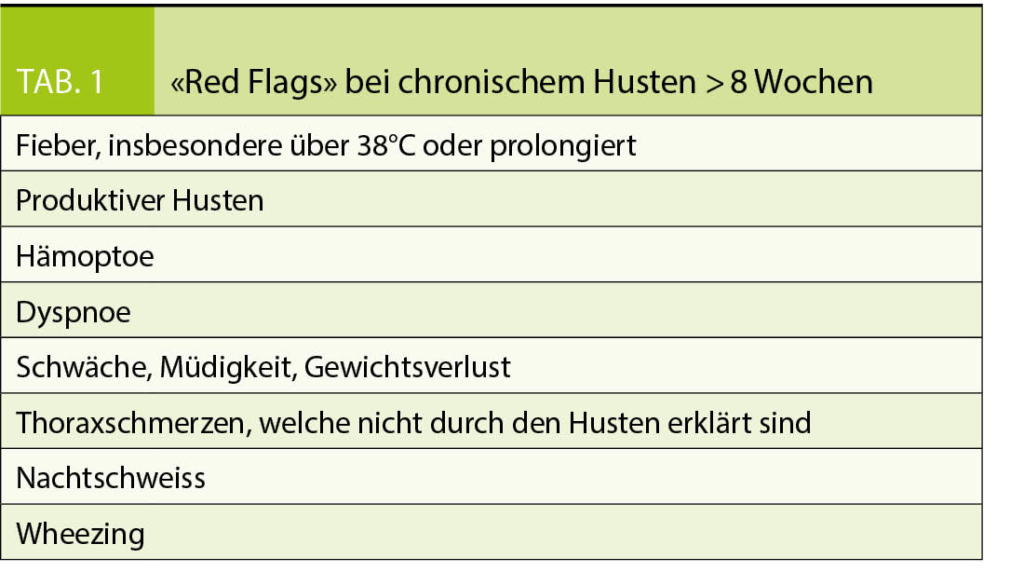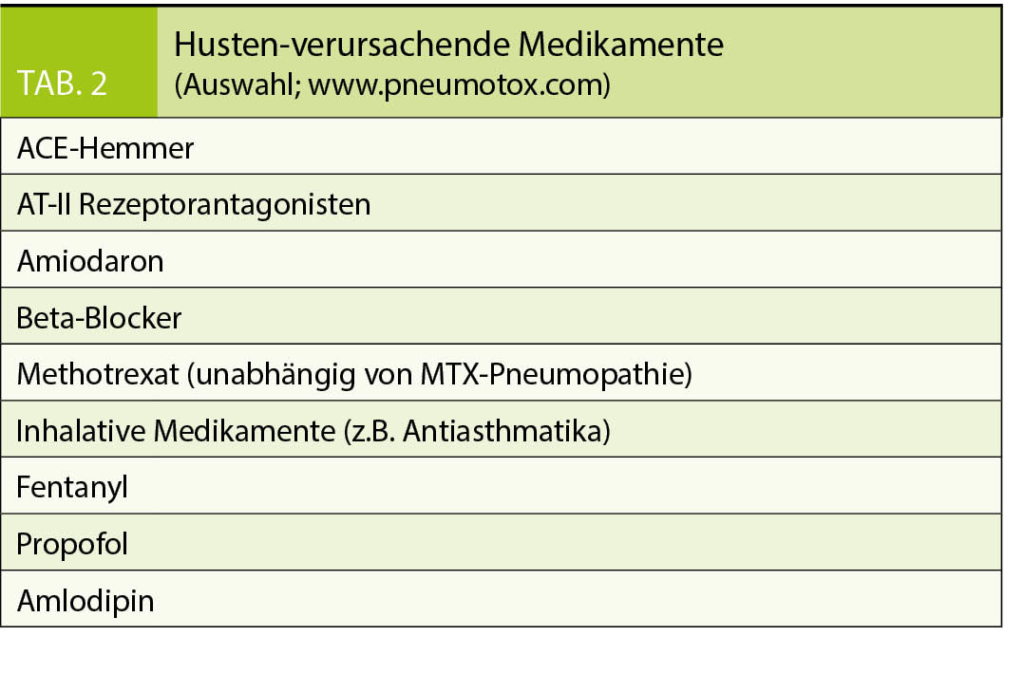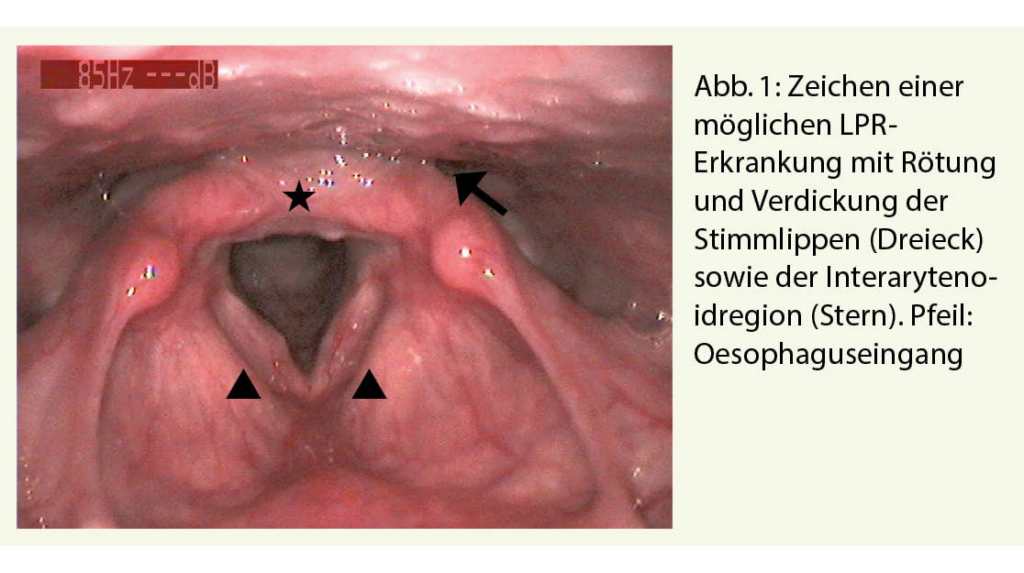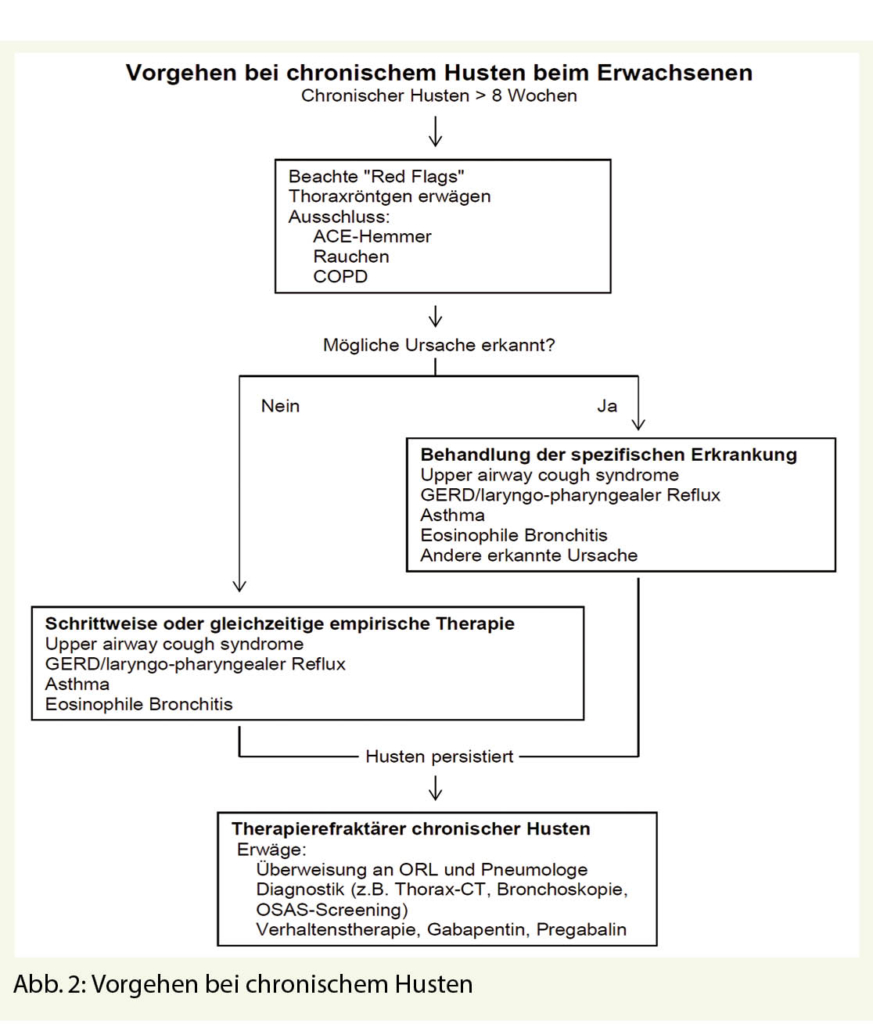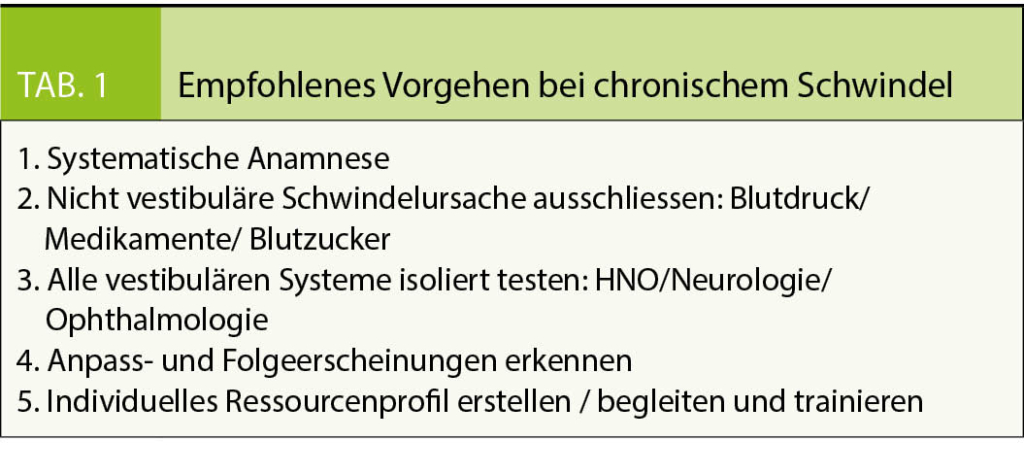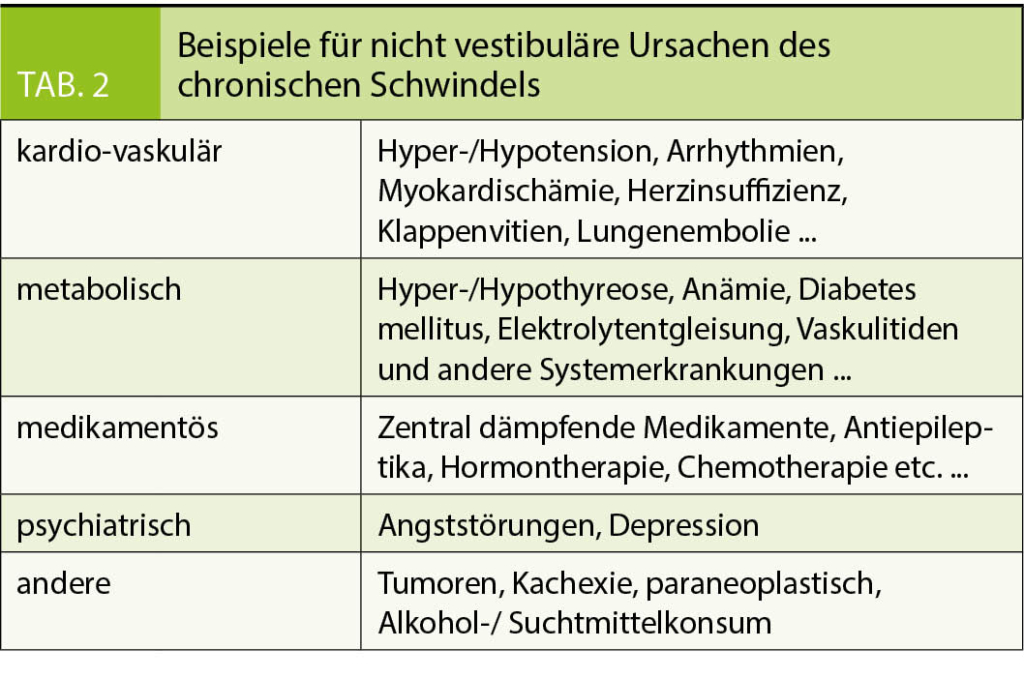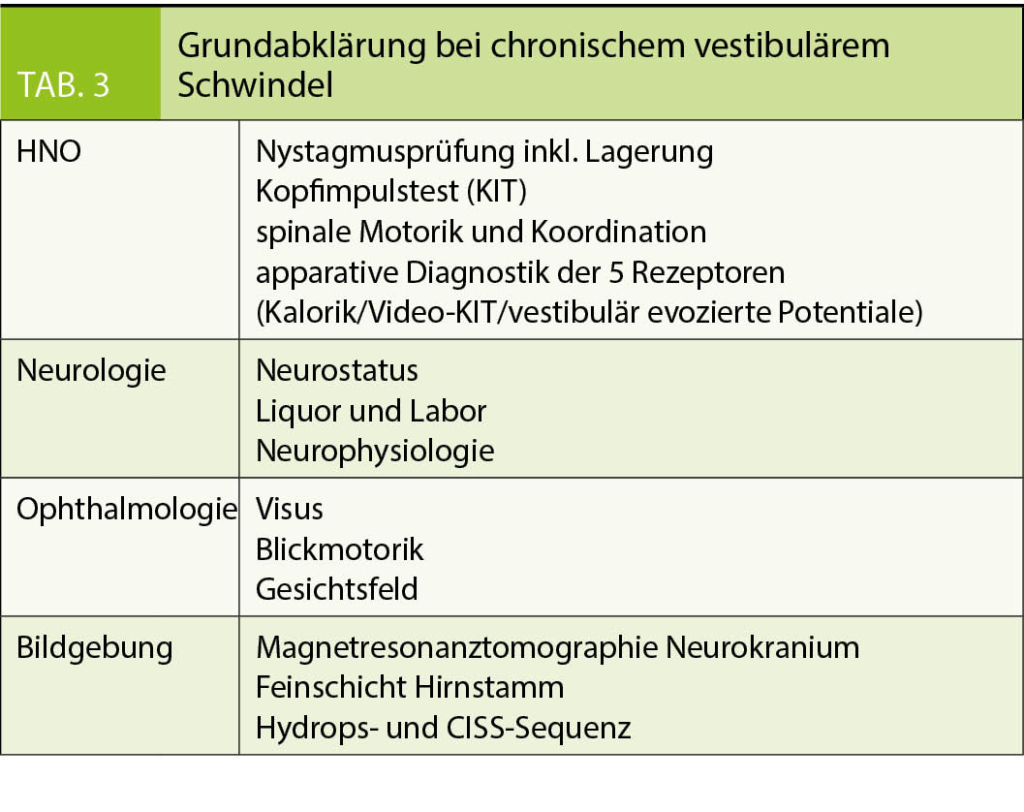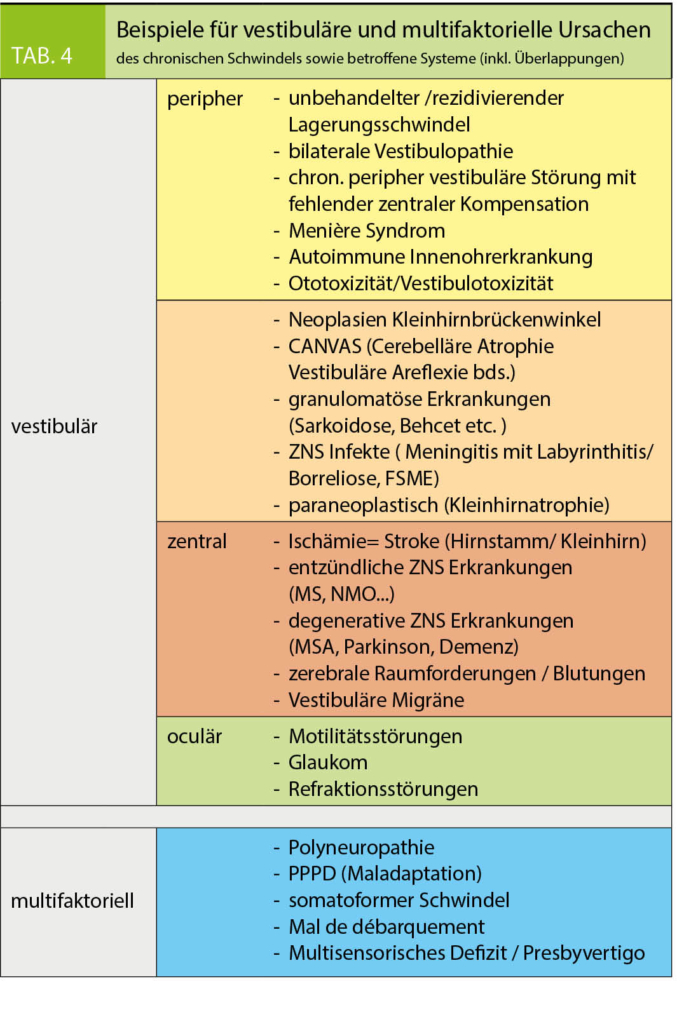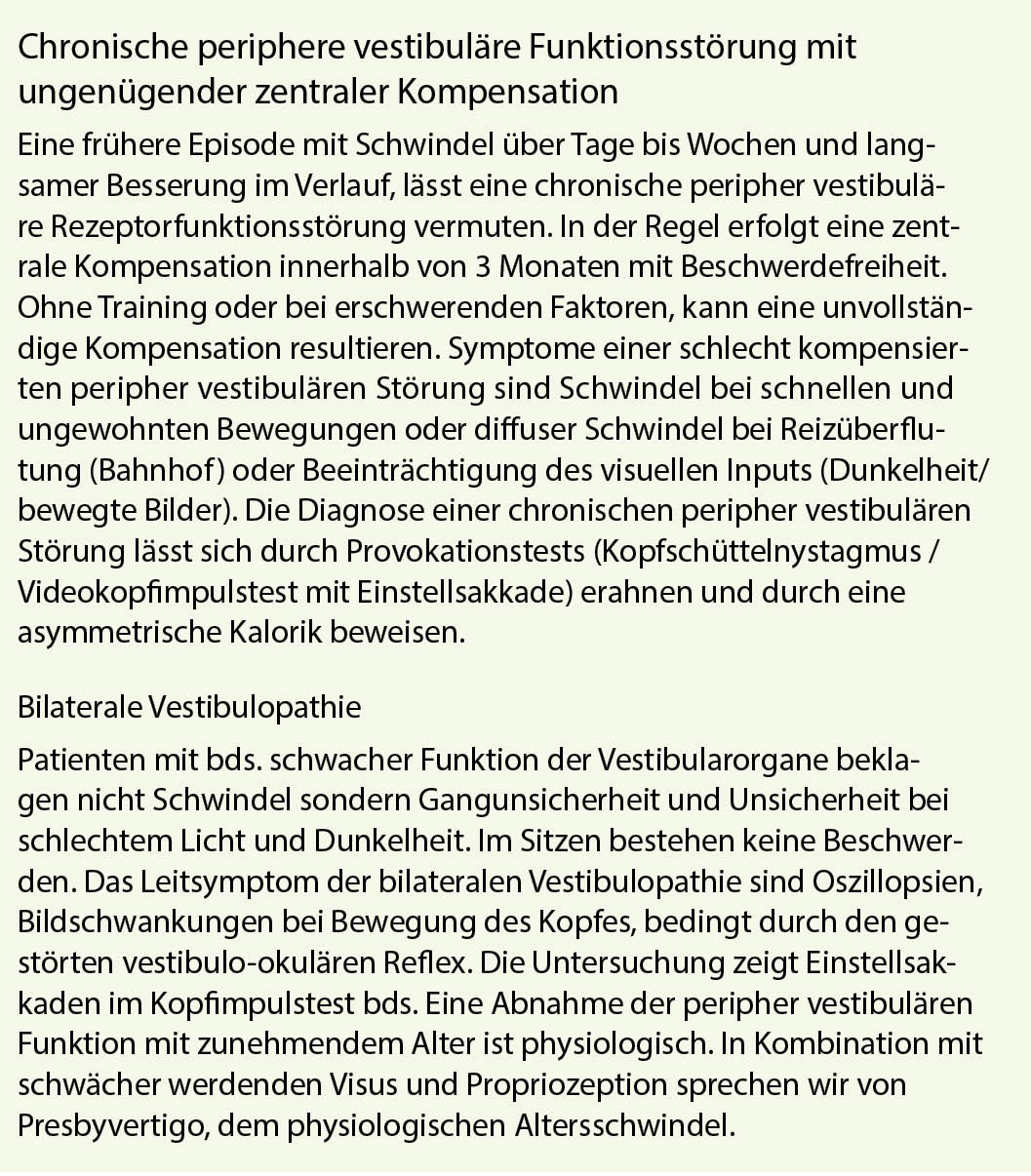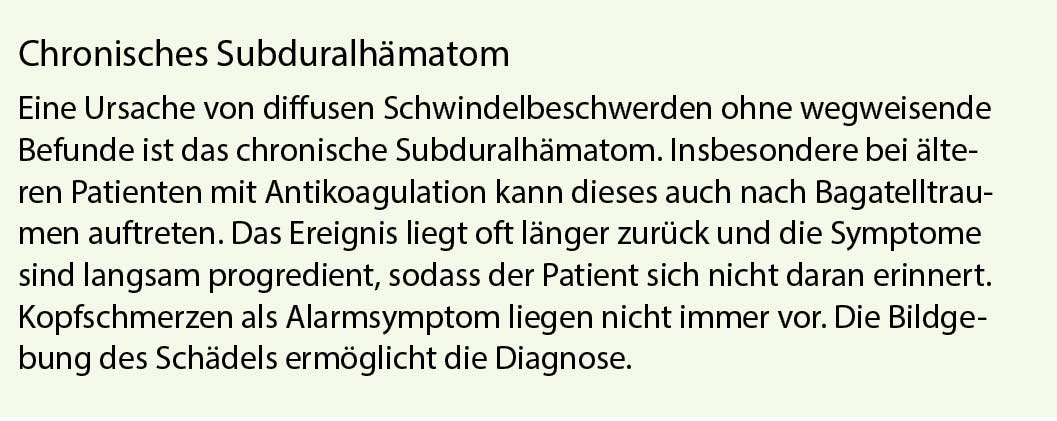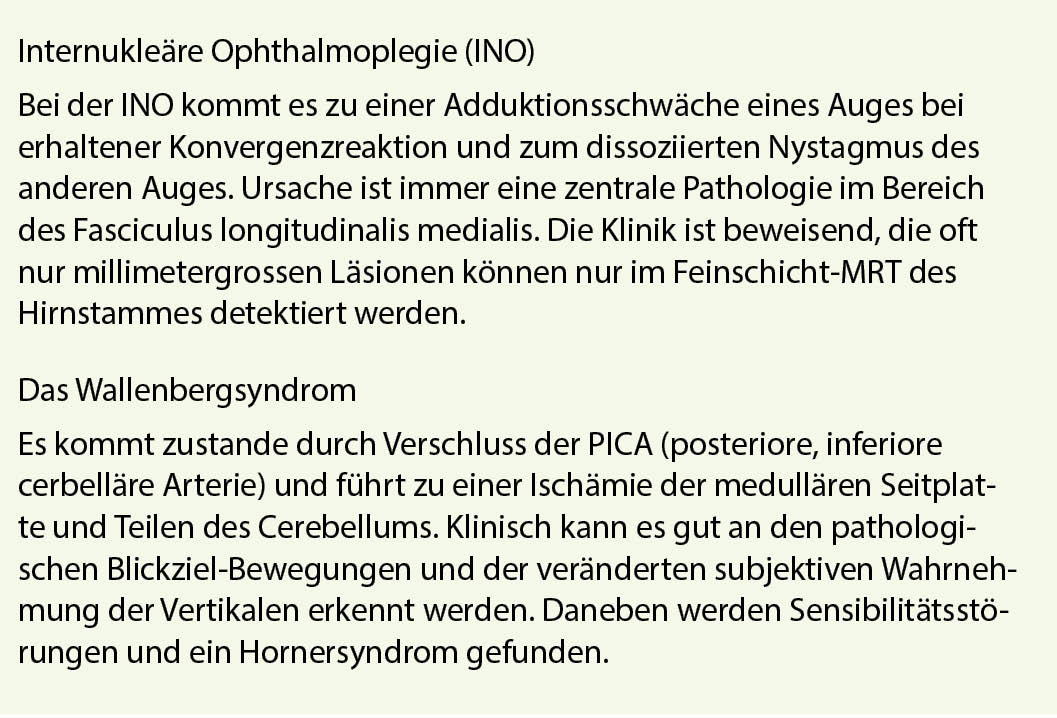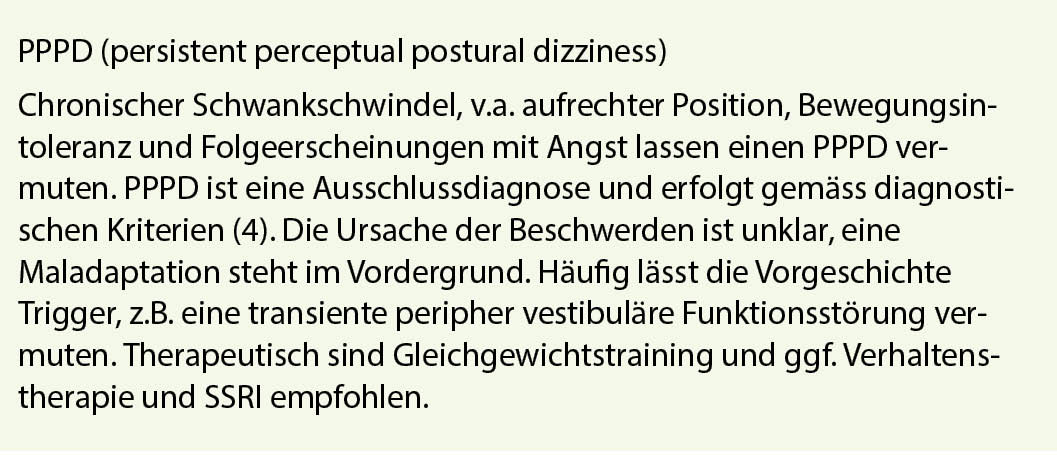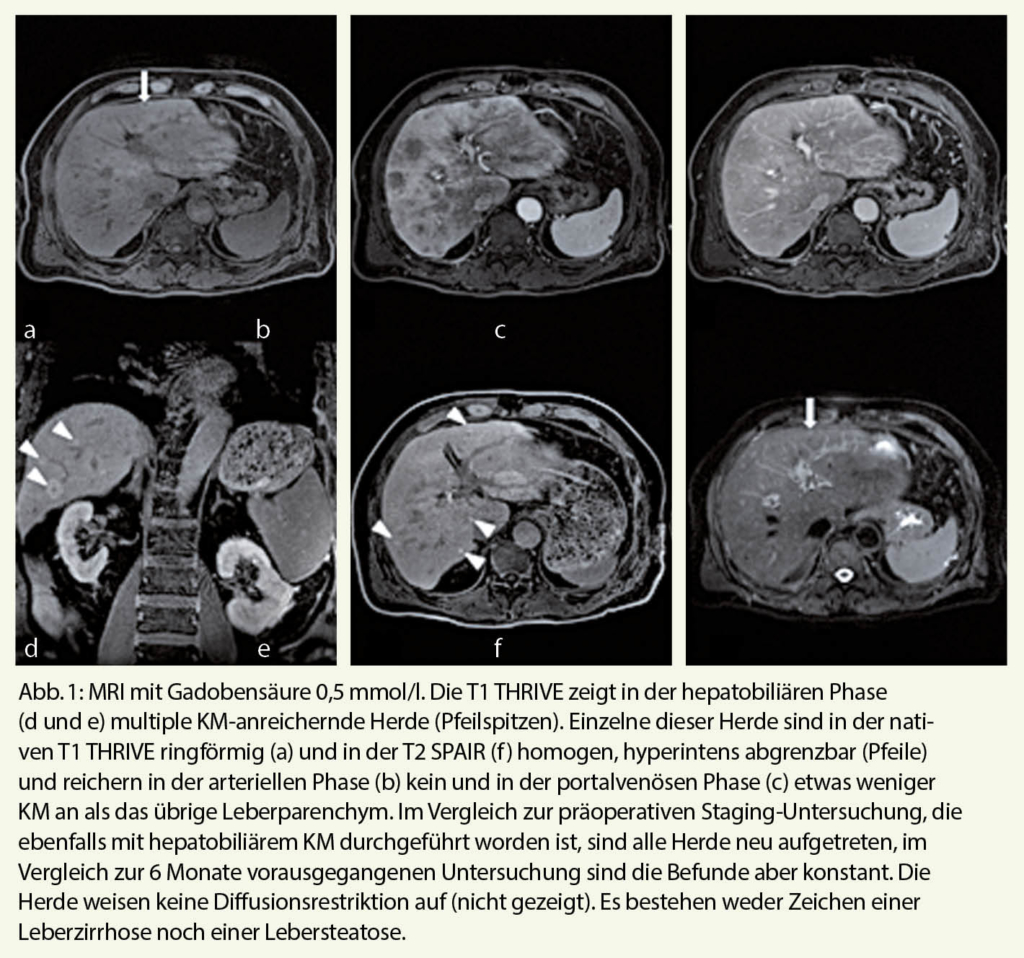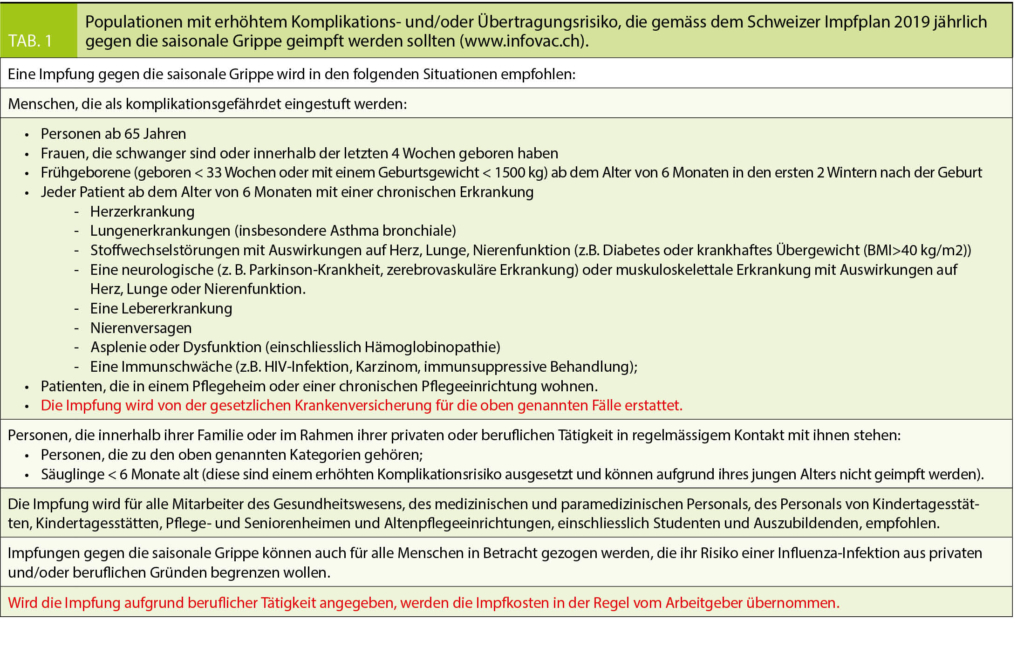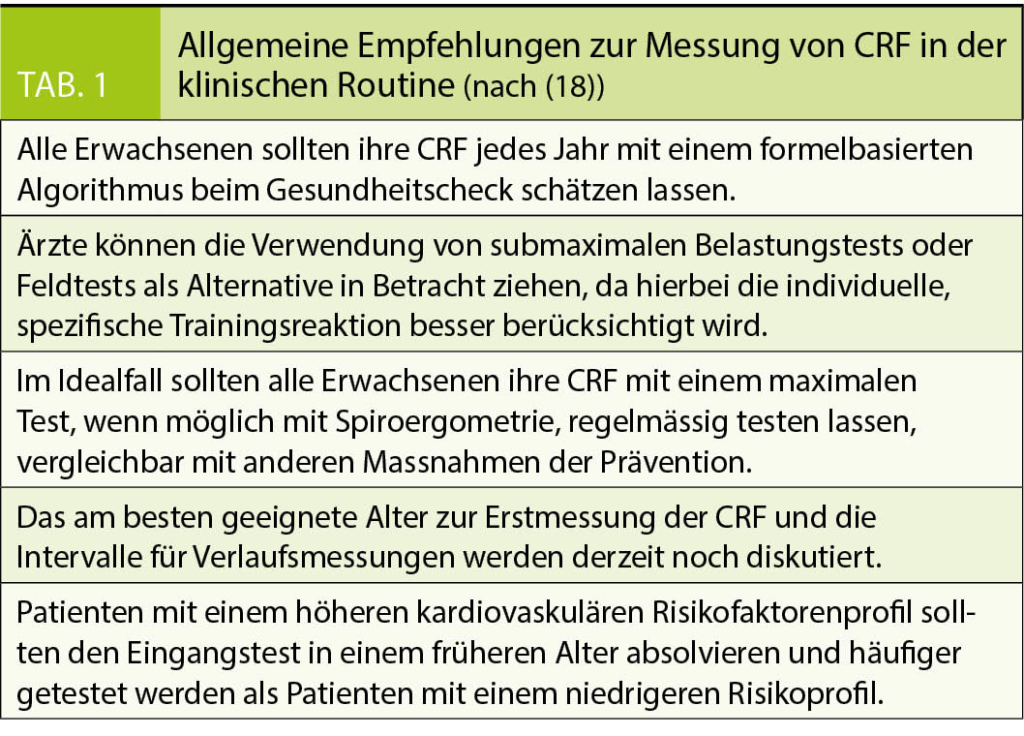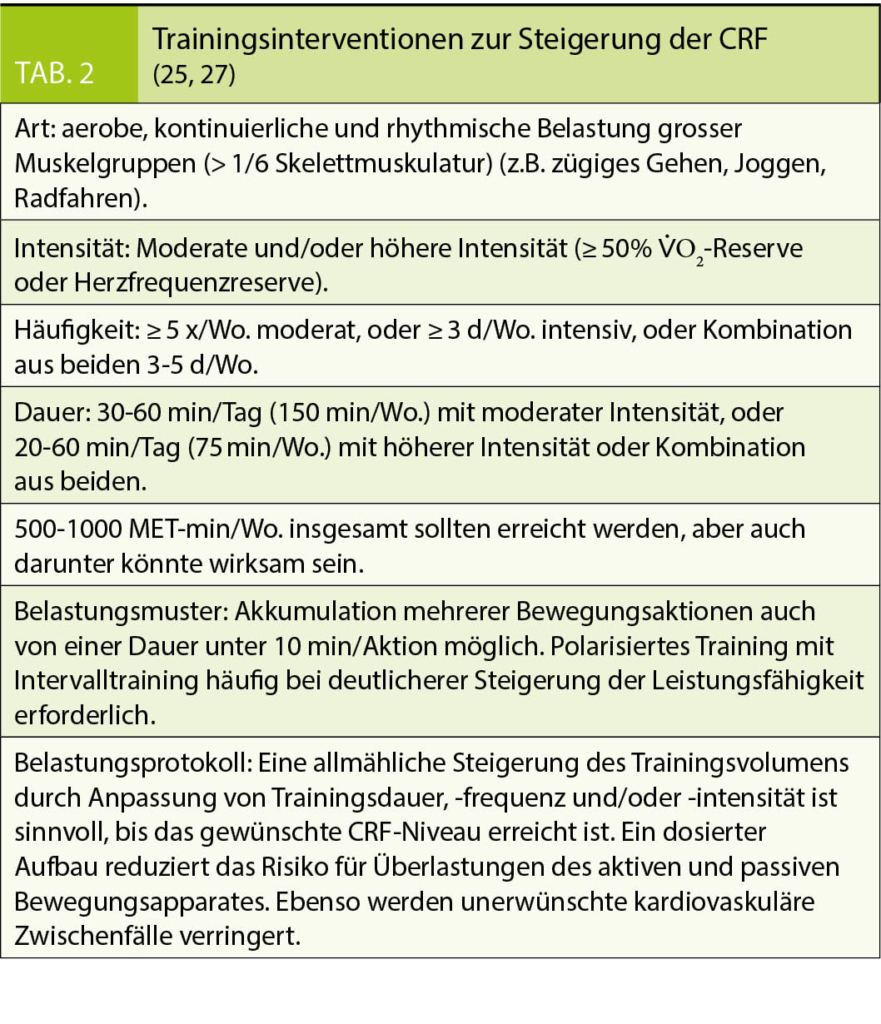1. Hollister EB, Gao C, Versalovic J. Compositional and functional features of the gastrointestinal microbiome and their effects on human health. Gastroenterology 2014;146:1449-58.
2. Rescigno M. Intestinal microbiota and its effects on the immune system. Cell Microbiol 2014.
3. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, et al. Diversity of the human intestinal microbial flora. Science 2005;308:1635-8.
4. Matias Rodrigues JF, von Mering C. HPC-CLUST: distributed hierarchical clustering for large sets of nucleotide sequences. Bioinformatics 2014;30:287-8.
5. Scanlan PD, Marchesi JR. Micro-eukaryotic diversity of the human distal gut microbiota: qualitative assessment using culture-dependent and -independent analysis of faeces. ISME J 2008;2:1183-93.
6. Scanlan PD, Shanahan F, O’Mahony C, et al. Culture-independent analyses of temporal variation of the dominant fecal microbiota and targeted bacterial subgroups in Crohn’s disease. J Clin Microbiol 2006;44:3980-8.
7. Dekio I, Hayashi H, Sakamoto M, et al. Detection of potentially novel bacterial components of the human skin microbiota using culture-independent molecular profiling. J Med Microbiol 2005;54:1231-8.
8. Sakata S, Tonooka T, Ishizeki S, et al. Culture-independent analysis of fecal microbiota in infants, with special reference to Bifidobacterium species. FEMS Microbiol Lett 2005;243:417-23.
9. Candela M, Biagi E, Maccaferri S, et al. Intestinal microbiota is a plastic factor responding to environmental changes. Trends Microbiol 2012;20:385-91.
10. Walter J, Ley R. The human gut microbiome: ecology and recent evolutionary changes. Annu Rev Microbiol 2011;65:411-29.
11. Rehman A, Sina C, Gavrilova O, et al. Nod2 is essential for temporal development of intestinal microbial communities. Gut 2011;60:1354-62.
12. Backhed F, Ley RE, Sonnenburg JL, et al. Host-bacterial mutualism in the human intestine. Science 2005;307:1915-20.
13. Hooper LV, Gordon JI. Commensal host-bacterial relationships in the gut. Science 2001;292:1115-8.
14. Olivares M, Laparra JM, Sanz Y. Host genotype, intestinal microbiota and inflammatory disorders. Br J Nutr 2013;109 Suppl 2:S76-80.
15. Ventura M, Turroni F, Motherway MO, et al. Host-microbe interactions that facilitate gut colonization by commensal bifidobacteria. Trends Microbiol 2012;20:467-76.
16. Ursell LK, Haiser HJ, Van Treuren W, et al. The intestinal metabolome: an intersection between microbiota and host. Gastroenterology 2014;146:1470-6.
17. Casen C, Vebo HC, Sekelja M, et al. Deviations in human gut microbiota: a novel diagnostic test for determining dysbiosis in patients with IBS or IBD. Aliment Pharmacol Ther 2015;42:71-83.
18. Bellaguarda E, Chang EB. IBD and the gut microbiota–from bench to personalized medicine. Curr Gastroenterol Rep 2015;17:15.
19. Ray K. IBD. Gut microbiota in IBD goes viral. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015;12:122.
20. Cenit MC, Olivares M, Codoner-Franch P, et al. Intestinal Microbiota and Celiac Disease: Cause, Consequence or Co-Evolution? Nutrients 2015;7:6900-23.
21. Cicerone C, Nenna R, Pontone S. Th17, intestinal microbiota and the abnormal immune response in the pathogenesis of celiac disease. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2015;8:117-22.
22. Marasco G, Colecchia A, Festi D. Dysbiosis in Celiac disease patients with persistent symptoms on gluten-free diet: a condition similar to that present in irritable bowel syndrome patients? Am J Gastroenterol 2015;110:598.
23. Trivedi PJ, Adams DH. Gut – Liver Immunity. J Hepatol 2015.
24. Usami M, Miyoshi M, Yamashita H. Gut microbiota and host metabolism in liver cirrhosis. World J Gastroenterol 2015;21:11597-608.
25. Aqel B, DiBaise JK. Role of the Gut Microbiome in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Nutr Clin Pract 2015;30:780-6.
26. Wieland A, Frank DN, Harnke B, et al. Systematic review: microbial dysbiosis and nonalcoholic fatty liver disease. Aliment Pharmacol Ther 2015;42:1051-63.
27. Seksik P, Rigottier-Gois L, Gramet G, et al. Alterations of the dominant faecal bacterial groups in patients with Crohn’s disease of the colon. Gut 2003;52:237-42.
28. Rajilic-Stojanovic M, Shanahan F, Guarner F, et al. Phylogenetic analysis of dysbiosis in ulcerative colitis during remission. Inflamm Bowel Dis 2013;19:481-8.
29. Machiels K, Joossens M, Sabino J, et al. A decrease of the butyrate-producing species Roseburia hominis and Faecalibacterium prausnitzii defines dysbiosis in patients with ulcerative colitis. Gut 2013.
30. Duboc H, Rajca S, Rainteau D, et al. Connecting dysbiosis, bile-acid dysmetabolism and gut inflammation in inflammatory bowel diseases. Gut 2013;62:531-9.
31. Kang S, Denman SE, Morrison M, et al. Dysbiosis of fecal microbiota in Crohn’s disease patients as revealed by a custom phylogenetic microarray. Inflamm Bowel Dis 2010;16:2034-42.
32. Benjamin JL, Hedin CR, Koutsoumpas A, et al. Smokers with active Crohn’s disease have a clinically relevant dysbiosis of the gastrointestinal microbiota. Inflamm Bowel Dis 2012;18:1092-100.
33. Hedin CR, McCarthy NE, Louis P, et al. Altered intestinal microbiota and blood T cell phenotype are shared by patients with Crohn’s disease and their unaffected siblings. Gut 2014.
34. Joossens M, Huys G, Cnockaert M, et al. Dysbiosis of the faecal microbiota in patients with Crohn’s disease and their unaffected relatives. Gut 2011;60:631-7.
35. Yilmaz B, Juillerat P, Oyas O, et al. Microbial network disturbances in relapsing refractory Crohn’s disease. Nat Med 2019;25:323-336.
36. Schreiner P, Yilmaz B, Rossel JB, et al. Vegetarian or gluten-free diets in patients with inflammatory bowel disease are associated with lower psychological well-being and a different gut microbiota, but no beneficial effects on the course of the disease. United European Gastroenterol J 2019;7:767-781.
37. Mondot S, de Wouters T, Dore J, et al. The human gut microbiome and its dysfunctions. Dig Dis 2013;31:278-85.
38. Docktor MJ, Paster BJ, Abramowicz S, et al. Alterations in diversity of the oral microbiome in pediatric inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2012;18:935-42.
39. Packey CD, Sartor RB. Commensal bacteria, traditional and opportunistic pathogens, dysbiosis and bacterial killing in inflammatory bowel diseases. Curr Opin Infect Dis 2009;22:292-301.
40. Antoni L, Nuding S, Wehkamp J, et al. Intestinal barrier in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2014;20:1165-79.
41. Ostaff MJ, Stange EF, Wehkamp J. Antimicrobial peptides and gut microbiota in homeostasis and pathology. EMBO Mol Med 2013;5:1465-83.
42. Klag T, Stange EF, Wehkamp J. Defective antibacterial barrier in inflammatory bowel disease. Dig Dis 2013;31:310-6.
43. Antoni L, Nuding S, Weller D, et al. Human colonic mucus is a reservoir for antimicrobial peptides. J Crohns Colitis 2013;7:e652-64.
44. Chu H, Pazgier M, Jung G, et al. Human alpha-defensin 6 promotes mucosal innate immunity through self-assembled peptide nanonets. Science 2012;337:477-81.
45. Schroeder BO, Wu Z, Nuding S, et al. Reduction of disulphide bonds unmasks potent antimicrobial activity of human beta-defensin 1. Nature 2011;469:419-23.
46. Lam WC, Zhao C, Ma WJ, et al. The Clinical and Steroid-Free Remission of Fecal Microbiota Transplantation to Patients with Ulcerative Colitis: A Meta-Analysis. Gastroenterol Res Pract 2019;2019:1287493.
47. Cao Y, Zhang B, Wu Y, et al. The Value of Fecal Microbiota Transplantation in the Treatment of Ulcerative Colitis Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterol Res Pract 2018;2018:5480961.
48. Narula N, Kassam Z, Yuan Y, et al. Systematic Review and Meta-analysis: Fecal Microbiota Transplantation for Treatment of Active Ulcerative Colitis. Inflamm Bowel Dis 2017;23:1702-1709.
49. Keshteli AH, Millan B, Madsen KL. Pretreatment with antibiotics may enhance the efficacy of fecal microbiota transplantation in ulcerative colitis: a meta-analysis. Mucosal Immunol 2017;10:565-566.
50. Shi Y, Dong Y, Huang W, et al. Fecal Microbiota Transplantation for Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2016;11:e0157259.
51. Moayyedi P, Surette MG, Kim PT, et al. Fecal Microbiota Transplantation Induces Remission in Patients With Active Ulcerative Colitis in a Randomized Controlled Trial. Gastroenterology 2015;149:102-109 e6.
52. Paramsothy S, Kamm MA, Kaakoush NO, et al. Multidonor intensive faecal microbiota transplantation for active ulcerative colitis: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2017;389:1218-1228.
53. Paramsothy S, Nielsen S, Kamm MA, et al. Specific Bacteria and Metabolites Associated With Response to Fecal Microbiota Transplantation in Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2019;156:1440-1454 e2.
54. Kruis W, Fric P, Pokrotnieks J, et al. Maintaining remission of ulcerative colitis with the probiotic Escherichia coli Nissle 1917 is as effective as with standard mesalazine. Gut 2004;53:1617-23.
55. Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis 2017;11:769-784.
56. Pimentel M, Lembo A, Chey WD, et al. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without constipation. N Engl J Med 2011;364:22-32.
57. Kassinen A, Krogius-Kurikka L, Makivuokko H, et al. The fecal microbiota of irritable bowel syndrome patients differs significantly from that of healthy subjects. Gastroenterology 2007;133:24-33.
58. Rajilic-Stojanovic M, Biagi E, Heilig HG, et al. Global and deep molecular analysis of microbiota signatures in fecal samples from patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2011;141:1792-801.
59. Johnsen PH, Hilpusch F, Cavanagh JP, et al. Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018;3:17-24.
60. Xu D, Chen VL, Steiner CA, et al. Efficacy of Fecal Microbiota Transplantation in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2019;114:1043-1050.
61. Zhang H, Chang Y, Zheng Q, et al. Altered intestinal microbiota associated with colorectal cancer. Front Med 2019.
62. Yachida S, Mizutani S, Shiroma H, et al. Metagenomic and metabolomic analyses reveal distinct stage-specific phenotypes of the gut microbiota in colorectal cancer. Nat Med 2019;25:968-976.
63. Wu Y, Shi L, Li Q, et al. Microbiota Diversity in Human Colorectal Cancer Tissues Is Associated with Clinicopathological Features. Nutr Cancer 2019;71:214-222.
64. Lin C, Cai X, Zhang J, et al. Role of Gut Microbiota in the Development and Treatment of Colorectal Cancer. Digestion 2019;100:72-78.
65. Song M, Chan AT. Environmental Factors, Gut Microbiota, and Colorectal Cancer Prevention. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;17:275-289.
66. Irrazabal T, Belcheva A, Girardin SE, et al. The multifaceted role of the intestinal microbiota in colon cancer. Mol Cell 2014;54:309-20.
67. Schwabe RF, Jobin C. The microbiome and cancer. Nat Rev Cancer 2013;13:800-12.
68. Kostic AD, Chun E, Robertson L, et al. Fusobacterium nucleatum potentiates intestinal tumorigenesis and modulates the tumor-immune microenvironment. Cell Host Microbe 2013;14:207-15.
69. Kostic AD, Gevers D, Pedamallu CS, et al. Genomic analysis identifies association of Fusobacterium with colorectal carcinoma. Genome Res 2012;22:292-8.
70. Guzman JR, Conlin VS, Jobin C. Diet, microbiome, and the intestinal epithelium: an essential triumvirate? Biomed Res Int 2013;2013:425146.
71. Lerner A, Matthias T. Rheumatoid arthritis-celiac disease relationship: joints get that gut feeling. Autoimmun Rev 2015;14:1038-47.
72. Rogers GB. Germs and joints: the contribution of the human microbiome to rheumatoid arthritis. Nat Med 2015;21:839-41.
73. Zhang X, Zhang D, Jia H, et al. The oral and gut microbiomes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly normalized after treatment. Nat Med 2015;21:895-905.
74. Rogler G, Rosano G. The heart and the gut. Eur Heart J 2014;35:426-30.
75. Singh S, Kullo IJ, Pardi DS, et al. Epidemiology, risk factors and management of cardiovascular diseases in IBD. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015;12:26-35.
76. Wang Z, Roberts AB, Buffa JA, et al. Non-lethal Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine Production for the Treatment of Atherosclerosis. Cell 2015;163:1585-95.
77. Witjes JJ, van Raalte DH, Nieuwdorp M. About the gut microbiome as a pharmacological target in atherosclerosis. Eur J Pharmacol 2015;763:75-8.
78. Gregory JC, Buffa JA, Org E, et al. Transmission of atherosclerosis susceptibility with gut microbial transplantation. J Biol Chem 2015;290:5647-60.
79. Breit S, Kupferberg A, Rogler G, et al. Vagus Nerve as Modulator of the Brain-Gut Axis in Psychiatric and Inflammatory Disorders. Front Psychiatry 2018;9:44.
80. Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, et al. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol 2015;28:203-209.
81. Evrensel A, Ceylan ME. The Gut-Brain Axis: The Missing Link in Depression. Clin Psychopharmacol Neurosci 2015;13:239-44.
82. Leclercq S, Forsythe P, Bienenstock J. Posttraumatic Stress Disorder: Does the Gut Microbiome Hold the Key? Can J Psychiatry 2016;61:204-13.
83. Park AJ, Collins J, Blennerhassett PA, et al. Altered colonic function and microbiota profile in a mouse model of chronic depression. Neurogastroenterol Motil 2013;25:733-e575.
84. Naseribafrouei A, Hestad K, Avershina E, et al. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterol Motil 2014.
85. Dinan TG, Cryan JF. Melancholic microbes: a link between gut microbiota and depression? Neurogastroenterol Motil 2013;25:713-9.
86. Wang L, Conlon MA, Christophersen CT, et al. Gastrointestinal microbiota and metabolite biomarkers in children with autism spectrum disorders. Biomark Med 2014;8:331-44.
87. De Angelis M, Piccolo M, Vannini L, et al. Fecal microbiota and metabolome of children with autism and pervasive developmental disorder not otherwise specified. PLoS One 2013;8:e76993.
88. Louis P. Does the human gut microbiota contribute to the etiology of autism spectrum disorders? Dig Dis Sci 2012;57:1987-9.
89. Kang DW, Adams JB, Coleman DM, et al. Long-term benefit of Microbiota Transfer Therapy on autism symptoms and gut microbiota. Sci Rep 2019;9:5821.
90. Hemarajata P, Gao C, Pflughoeft KJ, et al. Lactobacillus reuteri-specific immunoregulatory gene rsiR modulates histamine production and immunomodulation by Lactobacillus reuteri. J Bacteriol 2013;195:5567-76.
91. Hemarajata P, Versalovic J. Effects of probiotics on gut microbiota: mechanisms of intestinal immunomodulation and neuromodulation. Therap Adv Gastroenterol 2013;6:39-51.
92. Sanchez M, Darimont C, Panahi S, et al. Effects of a Diet-Based Weight-Reducing Program with Probiotic Supplementation on Satiety Efficiency, Eating Behaviour Traits, and Psychosocial Behaviours in Obese Individuals. Nutrients 2017;9.
93. Dinan TG, Stanton C, Cryan JF. Psychobiotics: a novel class of psychotropic. Biol Psychiatry 2013;74:720-6.
94. Scott LV, Clarke G, Dinan TG. The brain-gut axis: a target for treating stress-related disorders. Mod Trends Pharmacopsychiatry 2013;28:90-9.
95. Saulnier DM, Ringel Y, Heyman MB, et al. The intestinal microbiome, probiotics and prebiotics in neurogastroenterology. Gut Microbes 2013;4:17-27.
96. Zheng P, Zeng B, Zhou C, et al. Gut microbiome remodeling induces depressive-like behaviors through a pathway mediated by the host’s metabolism. Mol Psychiatry 2016;21:786-96.
97. Cheung SG, Goldenthal AR, Uhlemann AC, et al. Systematic Review of Gut Microbiota and Major Depression. Front Psychiatry 2019;10:34.
98. Valles-Colomer M, Falony G, Darzi Y, et al. The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nat Microbiol 2019;4:623-632.
99. Alam C, Bittoun E, Bhagwat D, et al. Effects of a germ-free environment on gut immune regulation and diabetes progression in non-obese diabetic (NOD) mice. Diabetologia 2011;54:1398-406.
100. Alkanani AK, Hara N, Lien E, et al. Induction of diabetes in the RIP-B7.1 mouse model is critically dependent on TLR3 and MyD88 pathways and is associated with alterations in the intestinal microbiome. Diabetes 2014;63:619-31.
101. Boerner BP, Sarvetnick NE. Type 1 diabetes: role of intestinal microbiome in humans and mice. Ann N Y Acad Sci 2011;1243:103-18.
102. Brown CT, Davis-Richardson AG, Giongo A, et al. Gut microbiome metagenomics analysis suggests a functional model for the development of autoimmunity for type 1 diabetes. PLoS One 2011;6:e25792.
103. Dessein R, Peyrin-Biroulet L, Chamaillard M. Intestinal microbiota gives a nod to the hygiene hypothesis in type 1 diabetes. Gastroenterology 2009;137:381-3.
104. Devaraj S, Hemarajata P, Versalovic J. The human gut microbiome and body metabolism: implications for obesity and diabetes. Clin Chem 2013;59:617-28.
105. Dunne JL, Triplett EW, Gevers D, et al. The intestinal microbiome in type 1 diabetes. Clin Exp Immunol 2014;177:30-7.
106. Hara N, Alkanani AK, Ir D, et al. The role of the intestinal microbiota in type 1 diabetes. Clin Immunol 2013;146:112-9.
107. Wen L, Ley RE, Volchkov PY, et al. Innate immunity and intestinal microbiota in the development of Type 1 diabetes. Nature 2008;455:1109-13.
108. Chassaing B, Gewirtz AT. Gut microbiota, low-grade inflammation, and metabolic syndrome. Toxicol Pathol 2014;42:49-53.
109. Tilg H. Obesity, metabolic syndrome, and microbiota: multiple interactions. J Clin Gastroenterol 2010;44 Suppl 1:S16-8.
110. Vijay-Kumar M, Aitken JD, Carvalho FA, et al. Metabolic syndrome and altered gut microbiota in mice lacking Toll-like receptor 5. Science 2010;328:228-31.
111. Henao-Mejia J, Elinav E, Jin C, et al. Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity. Nature 2012;482:179-85.
112. Wood NJ. Microbiota: Dysbiosis driven by inflammasome deficiency exacerbates hepatic steatosis and governs rate of NAFLD progression. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012;9:123.
113. Ley RE, Peterson DA, Gordon JI. Ecological and evolutionary forces shaping microbial diversity in the human intestine. Cell 2006;124:837-48.
114. Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE, et al. Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. Science 2013;341:1241214.
115. Turnbaugh PJ, Ley RE, Mahowald MA, et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature 2006;444:1027-31.
116. de Clercq NC, Frissen MN, Davids M, et al. Weight Gain after Fecal Microbiota Transplantation in a Patient with Recurrent Underweight following Clinical Recovery from Anorexia Nervosa. Psychother Psychosom 2019;88:58-60.
117. Alang N, Kelly CR. Weight gain after fecal microbiota transplantation. Open Forum Infect Dis 2015;2:ofv004.
118. Vrieze A, Van Nood E, Holleman F, et al. Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. Gastroenterology 2012;143:913-6 e7.