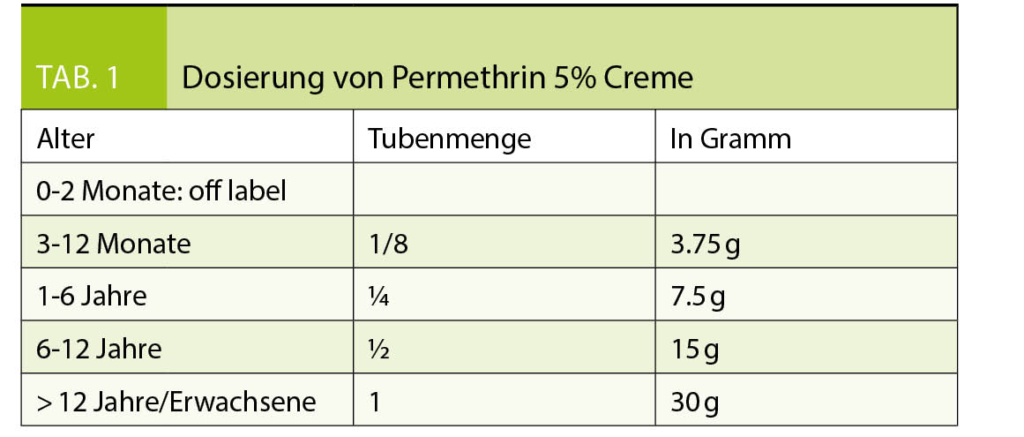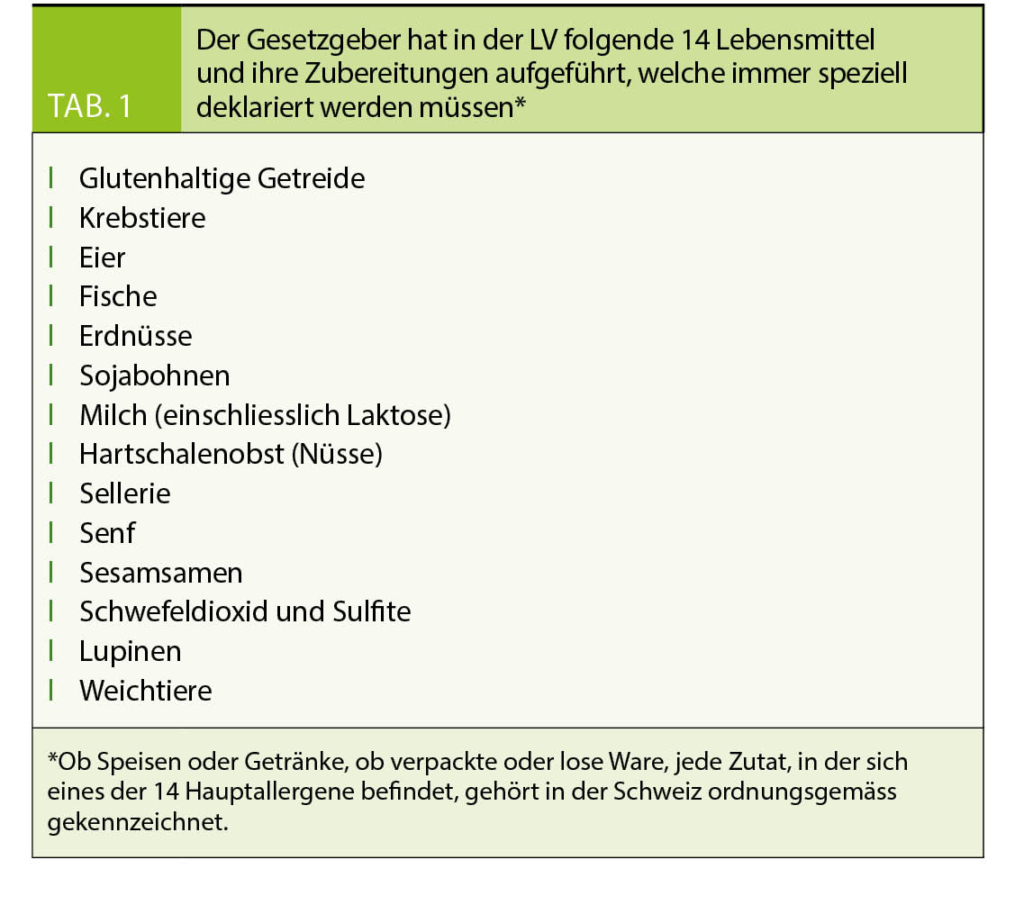Nachdem in der epidemiologischen Studie in Lausanne (SomnoLaus) die Häufigkeit des Schlaf-Apnoe Syndroms deutlich höher ausfiel als bisher international bekannt, ist das Interesse an Diagnostik und Behandlung des SAS auch in der Schweiz insbesondere in der Geriatrie weiter gewachsen. In diesem Artikel werden aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen zusammengefasst.
Als Haupttreiber für das Entstehen einer Alzheimer Demenz wird die Akkumulation von Beta-Amyloid angesehen. Dies wird im Schlaf über die Blut-Hirn-Schranke aus dem Gehirn transportiert. Gestörter Schlaf, insbesondere durch Arousal im Rahmen der Apnoen führt zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von kognitiven Defiziten oder Demenz. In 2 Studien mit 298, bzw. 1414 Patienten und > 7000 Kontrollpersonen ergab sich eine odds ratio von 2,04, bzw. 1,7.
Im Alter steigt die Neigung der oberen Atemwege zum nächtlichen Kollaps und damit die Häufigkeit von Apnoen. Bisher war die Notwendigkeit einer Behandlung umstritten und bis heute wird diskutiert, die Normwerte im Alter evtl. auf einen Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) von 15/h anzupassen. Zusätzliche Parameter wie v.a. die Sauerstoffsättigung, aber auch die Schlafstruktur und Arousalhäufigkeit sollten in die Therapieentscheidungen mit einfliessen.
In kleineren Untersuchungen konnte ein positiver Effekt einer CPAP-Behandlung bereits nach 2 Monaten nachgewiesen werden. Verbesserungen zeigten sich neben Schlafarchitektur und Tagesschläfrigkeit v.a. bei verbalem Lernen und kognitiver Flexibilität.
Aus meiner Sicht hat es sich in der Praxis bewährt, bei ausreichender Mitarbeit von Betroffenen und/oder Angehörigen einen Therapieversuch über 2 Monate ab einem AHI von 10/h, evtl. bei Tagesschläfrigkeit auch schon bei > 5/h, durchzuführen.
Eine intensive Anleitung und Begleitung, sowie Ergebnisevaluation sind aber nötig.
In Zukunft wäre eine Zusammenarbeit mit geriatrischen Spitälern und Alten- sowie Pflegeheimen sinnvoll, da dort bereits Fachpersonen arbeiten. Eine kontinuierliche Weiterbildung, Anleitung und auch Ansprechbarkeit von Schlafspezialisten ist dafür erforderlich.
SAS ist mit Unfällen assoziiert
Eine erhöhte Unfallgefährdung bei Patienten mit SAS ist bekannt, als mögliche Ursache wird Tagesschläfrigkeit angenommen, die zu Aufmerksamkeitsstörungen führen kann. Eine kürzlich publizierte Studie konnte nun nachweisen, dass auch das Haltungsgleichgewicht bei Patienten mit SAS gestört ist, und zwar bereits in den ersten Stunden des Tages, mit einer Korrelation mit der tiefsten nächtlichen O2-Sättigung.
Therapiealternativen zur Ventilationstherapie
Goldstandard und von den Krankenkassen finanzierte Behandlung eines OSAS ist weiterhin die CPAP-Therapie, die jedoch nur symptomatisch und mechanisch die Atmung verbessert. Unterkieferprotrusionsschienen bleiben bei AHI < 30/h und BMI < 30 nach S3-Leitlinie weiter eine Behandlungsoption.
In den letzten Jahren werden erneut operative Alternativen diskutiert. Seit der Einführung der transoralen Roboterchirurgie hat sich die Repositions-Pharyngoplastik mittels mit Widerhaken versehenem Nahtmaterial (barbed repositioning pharyngoplasty) als wenig invasive Behandlungsoption für das SAS erwiesen, dessen Wirksamkeit in kleinen Studien dokumentiert ist, dessen Stellenwert im Rahmen aller Behandlungsmöglichkeiten aber noch offen ist. Neben den bekannten Optionen im Bereich des weichen Gaumens, der Kiefer und der Nase gewinnt die Behandlung einer der Hauptursachen, des Übergewichts, mittels Adipositaschirurgie an Bedeutung.
Die Zusammenarbeit mit Adipositaszentren zur umfassenden Behandlung wird deshalb wichtiger. Bei Adipositas Grad 2-3 führt eine deutliche Gewichtsreduktion in etwa 50% zu einer signifikanten Verbesserung, evtl. sogar Normalisierung des AHI.
Trotz der zunehmenden OP-Zahlen (2014 weltweit 579000) gibt es aber bisher keine grösseren Studien sondern nur ein Konsensuspapier einer internationalen Expertengruppe (2017).
Bei Kindern ist die Tonsillektomie als Therapie der Wahl bereits bei AHI von > 2/h zu diskutieren bei im Alltag relevanten Störungen, wie Entwicklungsverzögerung oder Leistungsknick.
Eine weitere Option ist die Zungengrundstimulation. Hierbei wird über eine atemgesteuerte Stimulation des Nervus Hypoglossus ein Zungenvorschub ausgelöst, der die Atemwege offen hält. Voraussetzung ist ein gescheiterter CPAP-Versuch und ein AHI >15/h. Dann ist sie als 2. Linienbehandlung zugelassen. Nach Abklärung des Kollapsortes in Propofolschlaf wird analog zum Herzschrittmacher eine Elektrode am Zwerchfell platziert und eine am Zungengrund. Den Generator kann der Patient abends mit Magnet einschalten. Eine individuelle Einstellung unter Schlaflaborbedingungen ist notwendig. In der STAR-Studie wird der AHI auch über 3 Jahre um ¾ reduziert, ebenso die Tagesschläfrigkeit. Die Compliance ist hoch. In der Schweiz sind bisher etwa 40 Patienten mit dieser noch sehr teuren Therapie versorgt.
Verbesserte Diagnostik
Bei der Diagnostik gibt es weiter Bestrebungen, die ambulanten Möglichkeiten zu verbessern. Als Screening-Methoden v.a. für die hausärztliche Anwendung gibt es immer kleinere Polygraphie-Geräte. Zum Teil können diese mit EEG zur Erfassung des Schlafs ergänzt werden.
Ideal wäre eine Screeningmethode auf Grund von Biomarkern. Ein Team aus Tschechien hat kürzlich die Resultate einer Studie vorgestellt, in welcher unter anderem Pentraxin-3 (PTX-3) als potenzieller Biomarker evaluiert wurde. Dabei zeigte es sich, dass die Erhöhung des PTX-3-Serumspiegels signifikant mit einem mittleren bis schweren obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom verbunden ist und in der Lage sein könnte, Patienten mit OSAS von gesunden Personen zu unterscheiden. Zur endgültigen Diagnose ist aber weiter die Polysomnographie sinnvoll, vor allem zur Differentialdiagnose von Beinbewegungsstörungen (RLS) oder anderen Schlafstörungen.
Schlaflabor Fluntern
Ärztehaus Fluntern
Zürichbergstrasse 70
8044 Zürich
schlaflabor-fluntern@gmx.ch
Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.