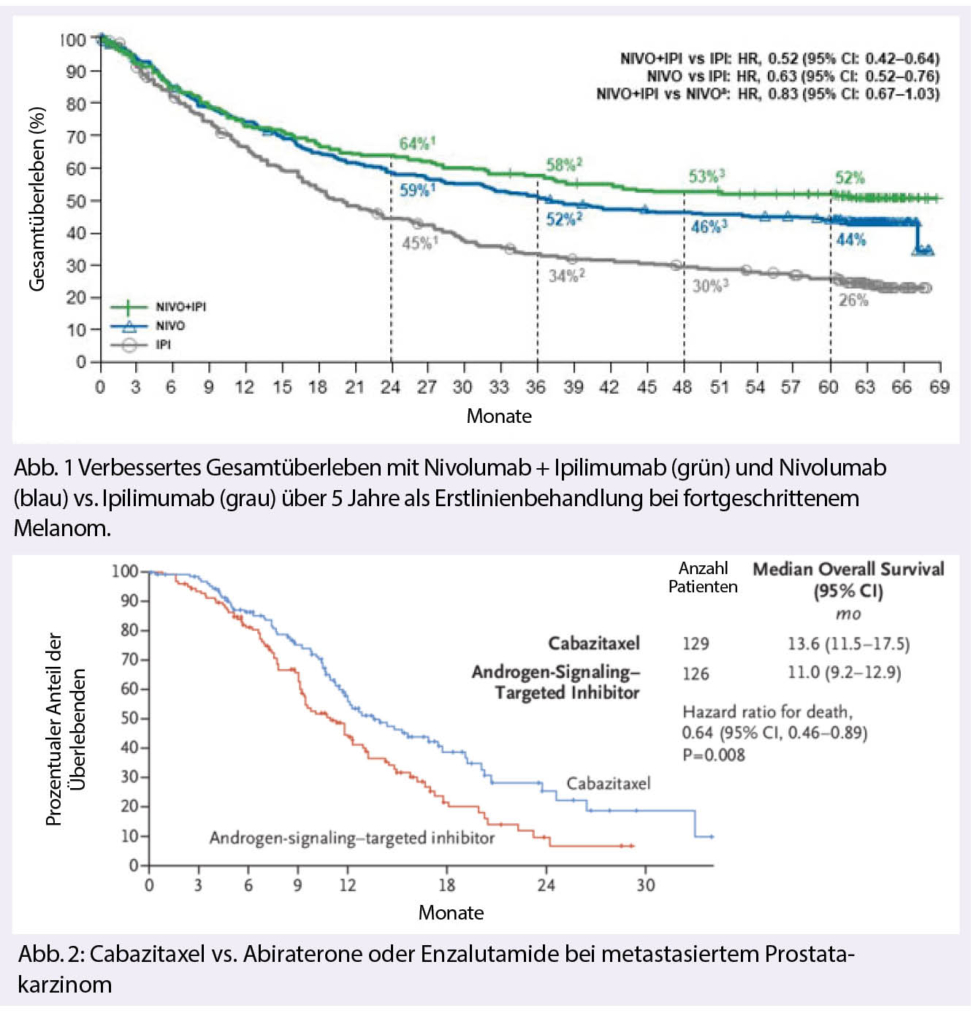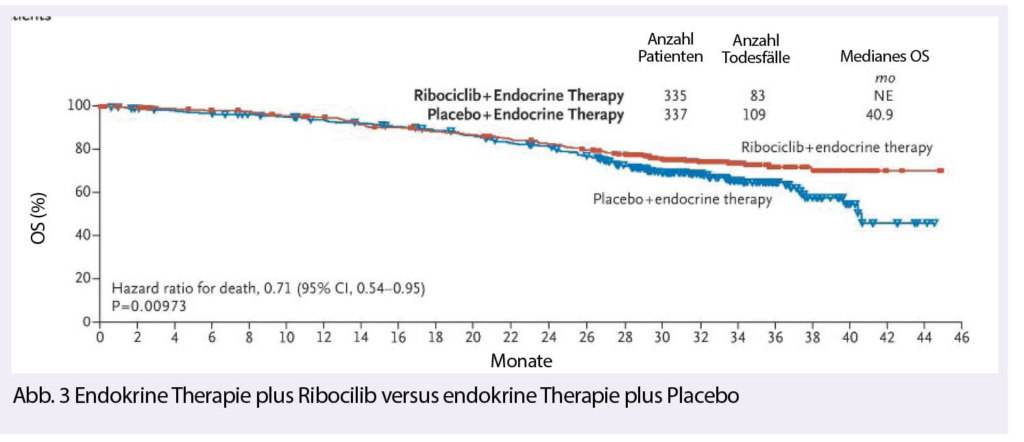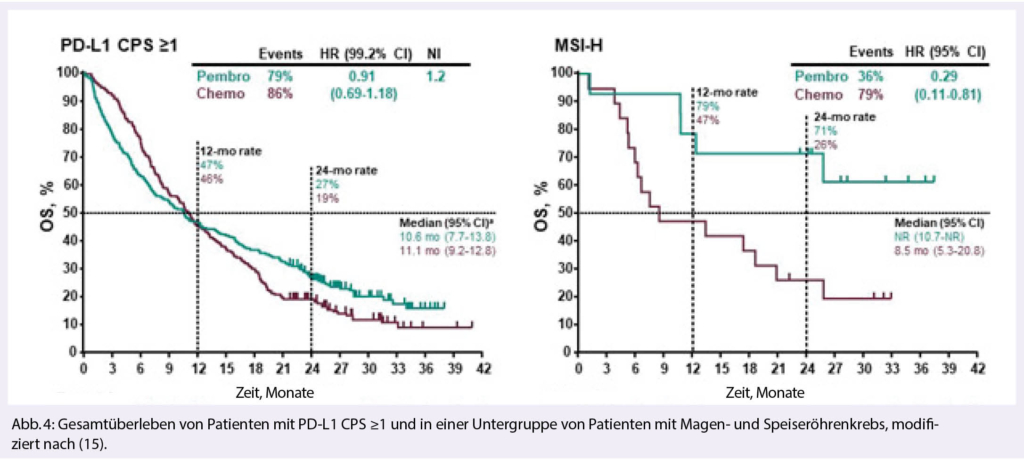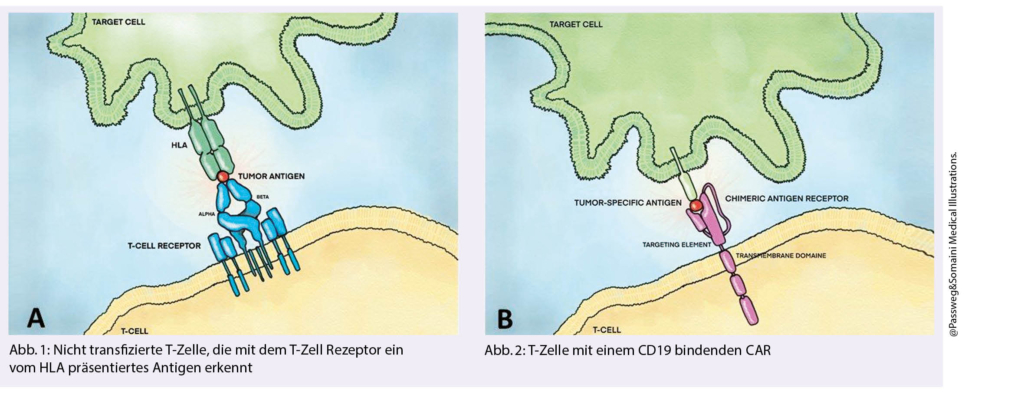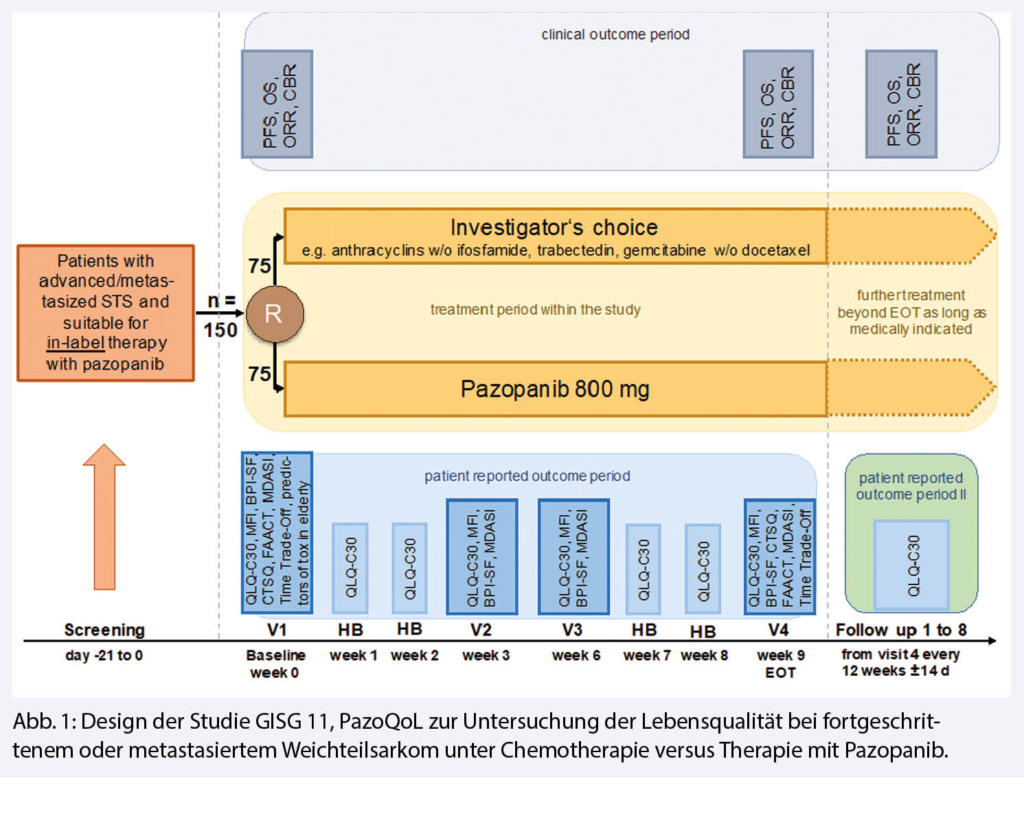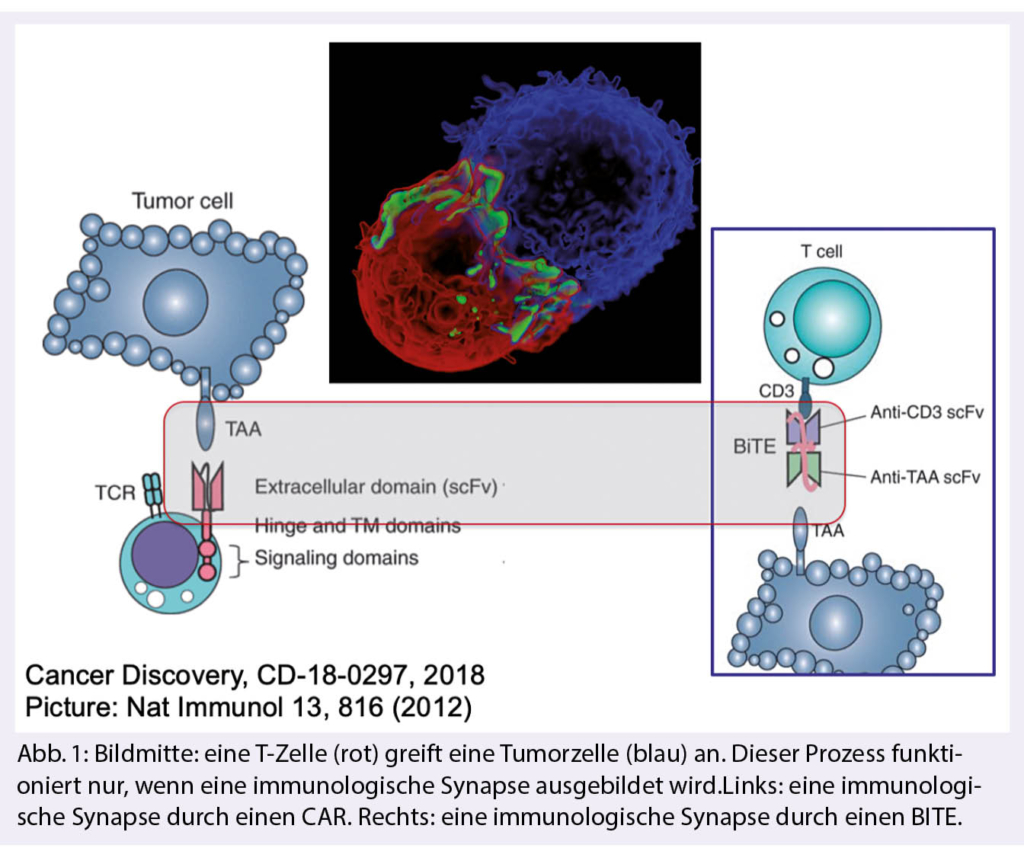PET-gesteuerte Behandlung des Hodgkin Lymphoms im Frühstadium
Endergebnisse der internationalen, randomisierten Phase III-Studie HD16 der GHSG
In dieser Phase III Studie wurden 1.150 Patienten mit Hodgkin-Lymphom im Frühstadium randomisiert, die sich einer Behandlung mit Standard-Adriamycin/Bleomycin/Vinblastin/Dacarbazin (ABVD) über 2 Zyklen mit anschliessender FDG-PET-Untersuchung unterzogen. Im Standard-Arm wurden 20 Gy-Involved-Field-Radiotherapie (IFRT) appliziert, während im experimentellen Arm die IFRT nur bei Patienten mit PET-positiven Restbefunden nach 2 Zyklen ABVD durchgeführt wurde. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 47 Monate. Bei Patienten mit PET-negativer Erkrankung nach zwei Zyklen ABVD (PET-2) betrug das progressionsfreie 5-Jahres-Überleben (PFS) 93,4 % (90,4-96,5%) mit sequentieller Chemo- und Radiotherapie und 86,1% (81,4-90,9%) nur mit Chemotherapie (Hazard Ratio 1,78; 95% Konfidenzintervall 1,02-3,12). Die PFS-Differenz resultiert in erster Linie aus einem signifikanten Anstieg der In-Feld-Rezidivraten (2,1 vs. 8,7%, p = 0,0003), wobei es keinen Unterschied bei den Out-of-Field-Rezidiven gibt. Die Fünf-Jahres-Gesamtüberlebensrate betrug 98,1% mit kombinierter Behandlung vs. 98,4% nur mit Chemotherapie. In der kombinierten Behandlungsgruppe betrug die 5-Jahres-PFS 93,2% bei PET-Negativität vs. 88,1% bei PET-Positivität. Bei Verwendung des Deauville-Scores 4 für PET-Positität war dieser Unterschied bei der 5-Jahres-PFS mit 93,1% gegenüber 80,1% noch ausgeprägter.
Schlussfolgerung: Bei einem Hodgkin Lymphom im Frühstadium verbessert RT das PFS nach 2 Zyklen ABVD, auch wenn die PET negativ ist. Eine positive PET nach 2 Zyklen ABVD ist ein Risikofaktor für ein schlechteres PFS, selbst bei 20 Gy Konsolidierungs-RT, insbesondere bei einem Deauville-Score von 4. In einer zwischenzeitlich erschienenen Vollpublikation der Studie (Fuchs M et al, JCO 2019) empfiehlt die Studiengruppe daher explizit, dass die konsolidierende Strahlentherapie als Standardbehandlung bei den Patienten, die nach 2 Zyklen ABVD ein Ansprechen im PET zeigen, beibehalten wird.
Körperstereotaxie im Vergleich zur externen Standardbestrahlung bei lokaler Metastasierung der Wirbelsäule
Ergebnisse der Phase III der NRG Oncology/RTOG 0631
In dieser Phase III NRG Oncology/RTOG Studie wurden 339 Patienten mit Wirbelsäulenmetastasen 2:1 zu einer stereotaktischen Körperbestrahlung (SBRT, 16 oder 18 Gy in 1 Fraktion) gegenüber einer konventionellen Strahlentherapie (RT, 8 Gy in 1 Fraktion) randomisiert. Der primäre Endpunkt war die Schmerzkontrolle, definiert als eine 3-Punkt-Verbesserung auf der numerischen Schmerzskala (0-10). Die 3-Monatsveränderung des Schmerzscores unterschied sich nicht zwischen den Armen (-3,00 bei SBRT gegenüber -3,83 bei konventioneller RT). Ausserdem wurde kein Unterschied in der Ansprechrate der Schmerzreduktion nach 3 Monaten beobachtet (40,3% bei SBRT vs. 57,9% bei konventioneller RT, p = 0,99).
Schlussfolgerung: Die SBRT der Wirbelsäule konnte im Vergleich zur konventionellen RT die Schmerzreduktion aus Patientensicht nach 1, 3 und 6 Monaten bei Patienten mit lokalisierten Wirbelsäulenmetastasen nicht verbessern.
Zwei Jahre Anti-Androgen-Behandlung erhöht die Sterblichkeit bei Männern, die eine frühe Salvage-Strahlentherapie erhalten
Eine Sekundäranalyse der randomisierten Phase III-Studie NRG/RTOG 9601
Diese Phase III NRG Onkology-Studie randomisierte 760 Patienten mit Prostatakrebs nach radikaler Prostatektomie mit biochemischem Rezidiv (post-op PSA 0,2-4,0 ng/mL und mit initial entweder pT2-Stadium mit positiven chirurgischen Rändern oder pT3), die dann eine Salvage-RT (64,8 Gy/36 Fraktionen) plus 150 mg Bicalutamid täglich gegen Placebo für 24 Monate erhielten. Diese Sekundäranalyse zeigte einen signifikanten Gesamtüberlebensvorteil (OS) für Bicalutamid bei Männern mit PSA > 1,5 ng/mL (Hazard Ratio [HR] 0,45; 0,25-0,81), jedoch nicht für PSA 0,2-1,5 ng/mL (HR 0,87; 0,66-1,16). Männer mit PSA ≤ 0.6 ng/mL hatten eine erhöhte anderweitige Mortalität durch Bicalutamid (HR 1,94; 1,17 - 3,20). Im Bicalutamid-Arm gab es erhöhte kardiale Ereignisse des Grades 3-5 (p = 0,04).
Schlussfolgerung: PSA ist sowohl prognostisch als auch prädiktiv für den Nutzen einer Hormontherapie mit Salvage RT. Eine langfristige Androgenentzugstherapie verbessert das OS bei Patienten, die eine frühzeitige Salvage-RT mit PSA < 1.5 ng/mL erhielten, nicht und kann die Mortalität anderer Ursachen erhöhen.
Eine Phase III Multi-Center randomisierte Studie zum Vergleich von Adjuvanter versus Früh-Salvage Strahlentherapie nach radikaler Prostatektomie
Ergebnisse der TROG 08.03 und ANZUP-Studie «RAVES»
Diese Phase III Studie randomisierte 333 Patienten mit extraprostatischer Extension (EPE), Samenblaseninvasion (SVI) oder positiven Rändern und PSA < 0,10 ng/mL zur adjuvanten Strahlentherapie (RT) innerhalb von 6 Monaten nach radikaler Prostatektomie im Vergleich zur Salvage RT, die bei einem Anstieg des PSA ≥ 0.20 ng/mL durchgeführt wurde. Die Behandlung bestand aus 64 Gy/32 Fraktionen auf das Prostatabett, mit oder ohne Androgenentzugs-Therapie. Primäres Ziel war es, eine 10%ige Unterlegenheit in der Freiheit von biochemischem Versagen (FFBF) im Salvage-RT-Arm auszuschliessen. Die Rekrutierung wurde aufgrund der geringen Anzahl von Ereignissen vorzeitig beendet. Es wurde kein Unterschied zwischen 8-yr FFBF für adjuvante RT und Salvage RT (79% vs. 76%; NS) festgestellt. ~50% der Männer erhielten aufgrund des steigenden PSA-Wertes eine Salvage RT. Die Grad ≥2 genito-urinäre (GU) Toxizitätsrate war im RT-Arm des Salvage-RT-Armes geringer (Odds Ratio 0,34; p = 0,002). Es gab keinen Unterschied bezüglich Grad ≥ 2 gastrointestinaler Toxizität.
Schlussfolgerung: Das Konzept der Salvage RT verschont die Hälfte der Männer nach radikaler Prostatektomie vor einer RT und ist mit einer geringeren GU-Toxizität verbunden.
Randomisierte Beobachtungsstudie der Phase II versus stereotaktische Ablativbestrahlung bei oligometastatischem Prostatakrebs (ORIOLE)
Primäre Ergebnisse
In dieser Phase II-Studie wurden 54 Patienten mit rezidivierendem, hormonsensitivem oligometastatischem (1-3 Stellen) Prostatakrebs für eine stereotaktische Körperbestrahlungstherapie (SBRT) versus Beobachtung randomisiert. Primärer Endpunkt war die Progression nach 6 Monaten. Bei der SBRT wurde eine signifikant geringere Progression nach 6 Monaten festgestellt, 19% gegenüber 61% in der Beobachtungsgruppe. Alle 35 Patienten in der SBRT-Gruppe hatten eine verblindete PMSA-PET-CT zu Beginn und nach 6 Monaten. Patienten, die eine vollständige Konsolidierung der PET-positiven Läsionen hatten, entwickelten nach 6 Monaten weniger wahrscheinlich neue Metastasen (16% vs. 63% p = 0,006) und hatten ein signifikant längeres progressionsfreies Überleben (PFS, nicht erreicht vs. 11,8 Monate, p = 0,003) sowie ein verbessertes fernmetastasenfreies Überleben (29 vs. 6 Monate, p = 0,0008).
Schlussfolgerung: SBRT der Metastasen bei Patienten mit oligometastatischem, hormonsensitivem Prostatakrebs ist mit einem verbesserten PFS verbunden.
Strahlentherapie versus Trans-Oral-Roboterchirurgie bei oropharyngealem Plattenepithelkarzinom
Ergebnisse einer randomisierten Studie
In dieser Phase II Studie wurden 68 Patienten mit T1-T2, N0-N2 (≤ 4 cm, keine extrakapsuläre Ausbreitung in der Bildgebung) Oropharynx-Plattenepithelkarzinom (OPSCC) randomisiert in einen Arm mit trans-oraler Roboterchirurgie (TORS) versus definitive Radiotherapie (bei T1-2N0) respektive definitive Radiochemotherapie (bei T1-2N1-2). Die Bestrahlungsdosis betrug 70 Gy/35 Fraktionen), als Chemotherapie wurde Cisplatin gegeben. Die Patienten wurden nach dem p16-Status stratifiziert. Der primäre Endpunkt der Studie war die Lebensqualität beim Schlucken nach 1 Jahr (Beurteilung gemäss dem MD Anderson Dysphagie Inventory MDADI). Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 27 Monate. Der Bestrahlungsarm zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung der MDADI-Scores nach 1 Jahr (p = 0,04), erfüllte jedoch nicht die vorgegebene Definition einer klinisch sinnvollen Veränderung (d.h. 10-Punkte-Verbesserung des MDADI). In Subset-Analysen wurde keine Untergruppe identifiziert, die TORS begünstigt. Es gab einen TORS-bedingten Blutungstod.
Schlussfolgerung: Die Toxizitätsmuster unterschieden sich zwischen den Gruppen. Patienten mit OPSCC sollten über beide Behandlungsoptionen informiert werden.
Internationale randomisierte kontrollierte Phase-III-Studie PACE-B
Patienten-berichtete akute Toxizität, bei der die stereo-taktische Körperbestrahlung mit konventionell fraktionierter oder mässig hypofraktionierter Strahlentherapie bei lokalisiertem Prostatakrebs verglichen wurde
In dieser Phase III non-inferiority Studie wurden 874 Patienten mit Prostatakrebs mit niedrigem und mittlerem Risiko (Gleason-Score 4 + 3 ausgeschlossen) randomisiert in einen Arm konventionelle (78 Gy in 39 Fraktionen) oder mässig hypofraktionierte (62 Gy in 20 Fraktionen) Strahlentherapie versus stereotaktische Körperbestrahlung (SBRT, 36.25 Gy in 5 Fraktionen über 1-2 Wochen). Primärer Endpunkt: Freiheit von biochemischem oder klinischem Versagen (bereits publiziert). Co-Primärer Endpunkt: Rate akuter Grad 2 oder schwerere genito-urinäre/gastrointestinale (GU/GI) Toxizität (Patienten-berichtet). Es gab keinen Unterschied zwischen den Armen hinsichtlich der Toxizität-Raten des Grades 2 oder mehr (GI oder GU).
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse von PACE-B zeigten keine signifikanten Unterschiede in den wichtigsten patientenberichteten Endpunktmassen, was darauf hindeutet, dass SBRT weder die GI- noch die akute GU-Toxizität erhöht.
Klinische Phase III Studie NRG Oncology/NSABP B39-RTOG 0413
Kosmetische Ergebnisse der Post-Lumpektomie-Bestrahlung der ganzen Brust (WBI) gegenüber der Bestrahlung der partiellen Brust (PBI)
In dieser Phase III NRG Oncology/NSABP-RTOG-Studie wurden Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium nach Lumpektomie in Teilbrustbestrahlung gegenüber einer Vollbrustbestrahlung randomisiert. Bereits zuvor publiziert wurden die 10 Jahres lokalen Kontroll-Daten, die einen Unterschied von weniger als 1% bei den Brust-Rezidivraten zeigten. In der vorliegenden Teilstudie zur Lebensqualität (900 analysierbare Patientinnen) wurden die kosmetischen Ergebnisse zwischen den Armen von Patientinnen, Ärzten und der zentralen Übersichtsarbeit verglichen. Die von den Patientinnen bewerteten kosmetischen Ergebnisse waren gleichwertig. Bei der Bewertung durch den Arzt waren die anfänglichen Ergebnisse gleichwertig, während die Bestrahlung einer Teilbrust nach 3 Jahren zu schlechteren kosmetischen Ergebnissen führte. Bei der verblindeten zentralen Überprüfung wurde nach 3 Jahren kein Unterschied in den kosmetischen Ergebnissen festgestellt.
Schlussfolgerung: Während die kosmetischen Ergebnisse der Teilbrustbestrahlung aus Ärzte-Sicht schlechter waren als die der Vollbrustbestrahlung, zeigte die Patientinnen-Beurteilung und der verblindete Review kosmetisch gleichwertige Resultate.