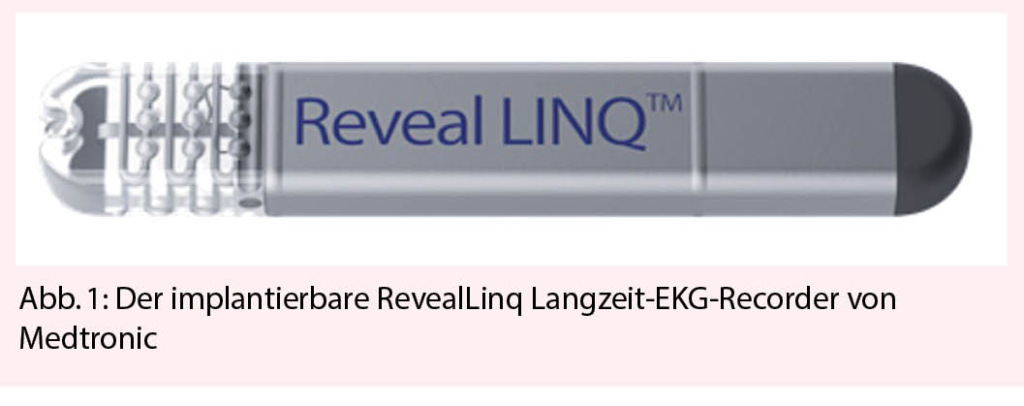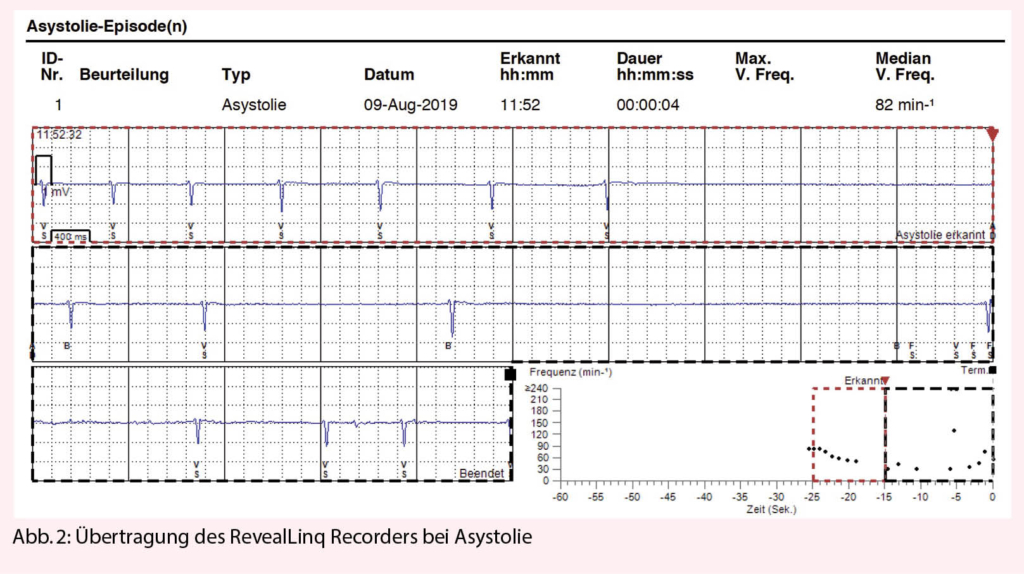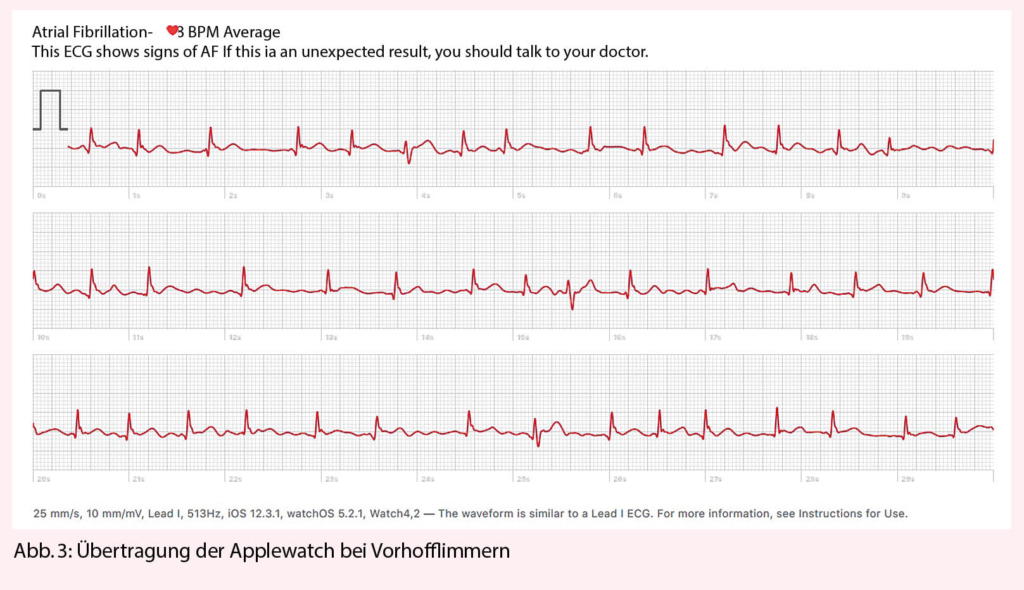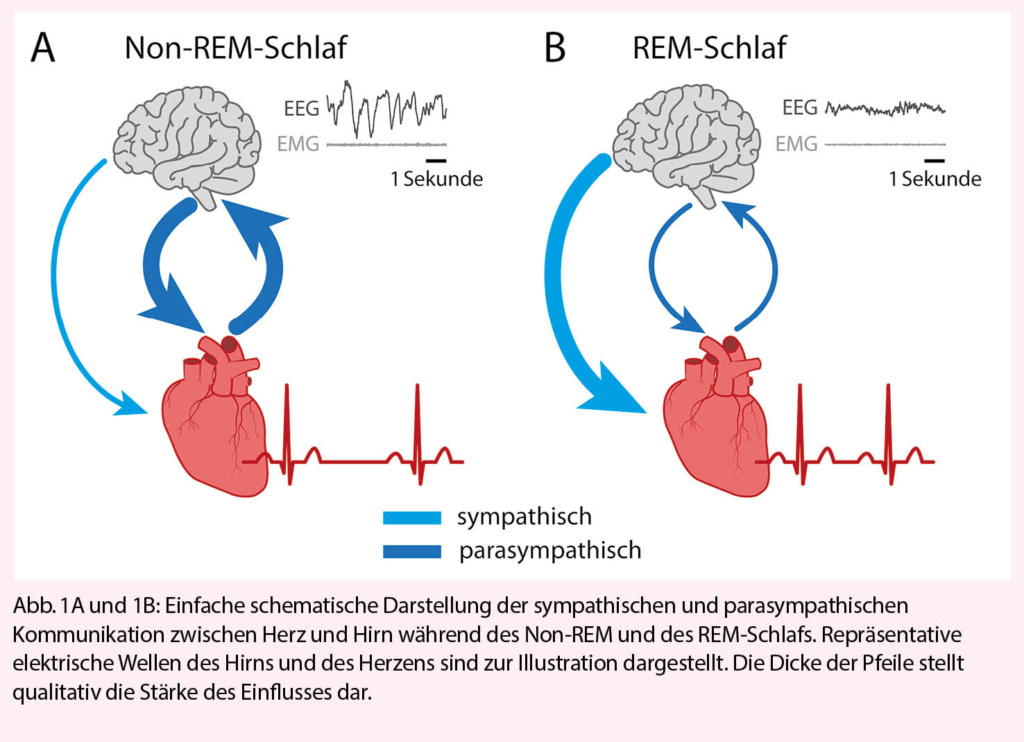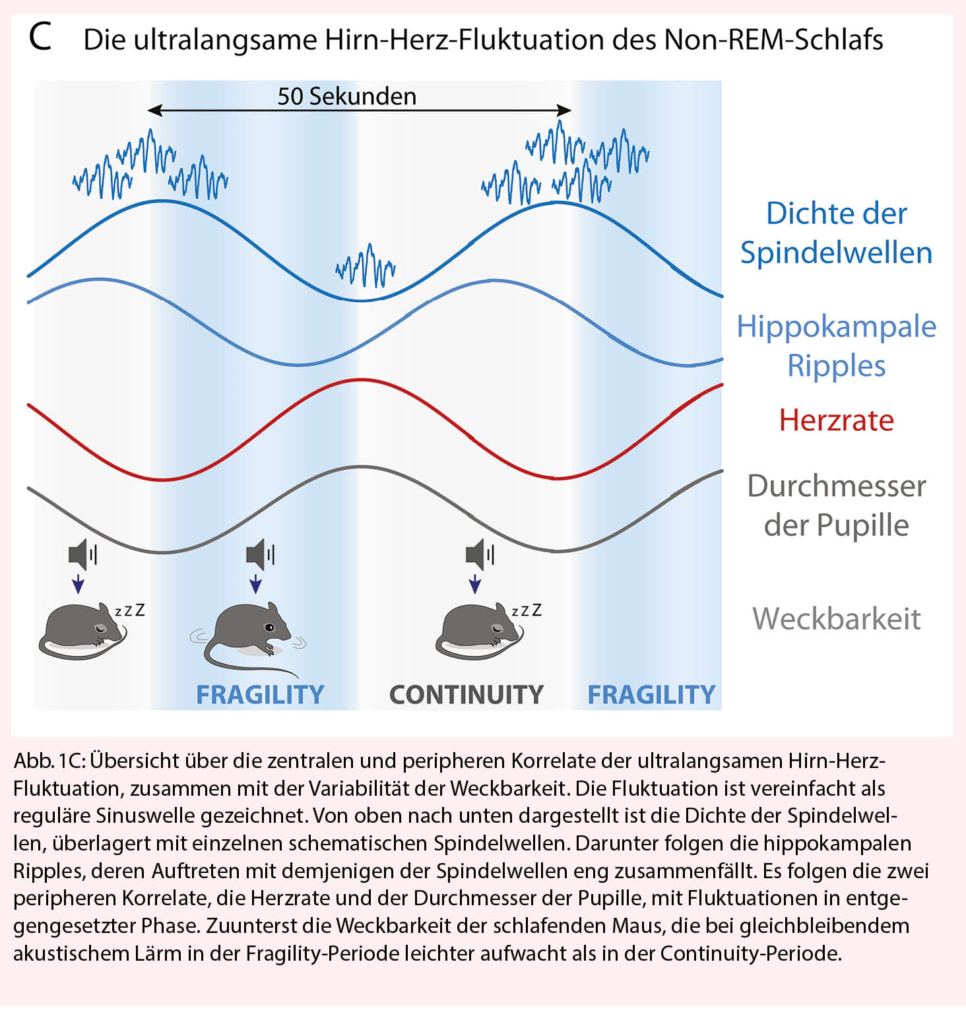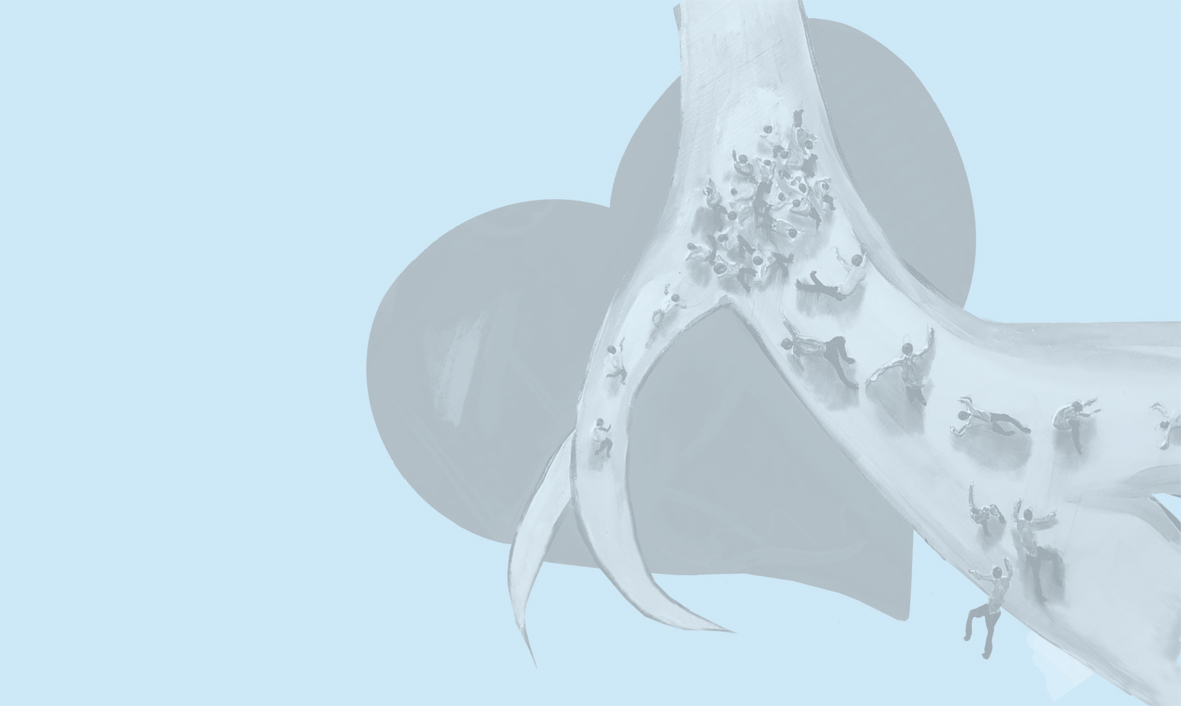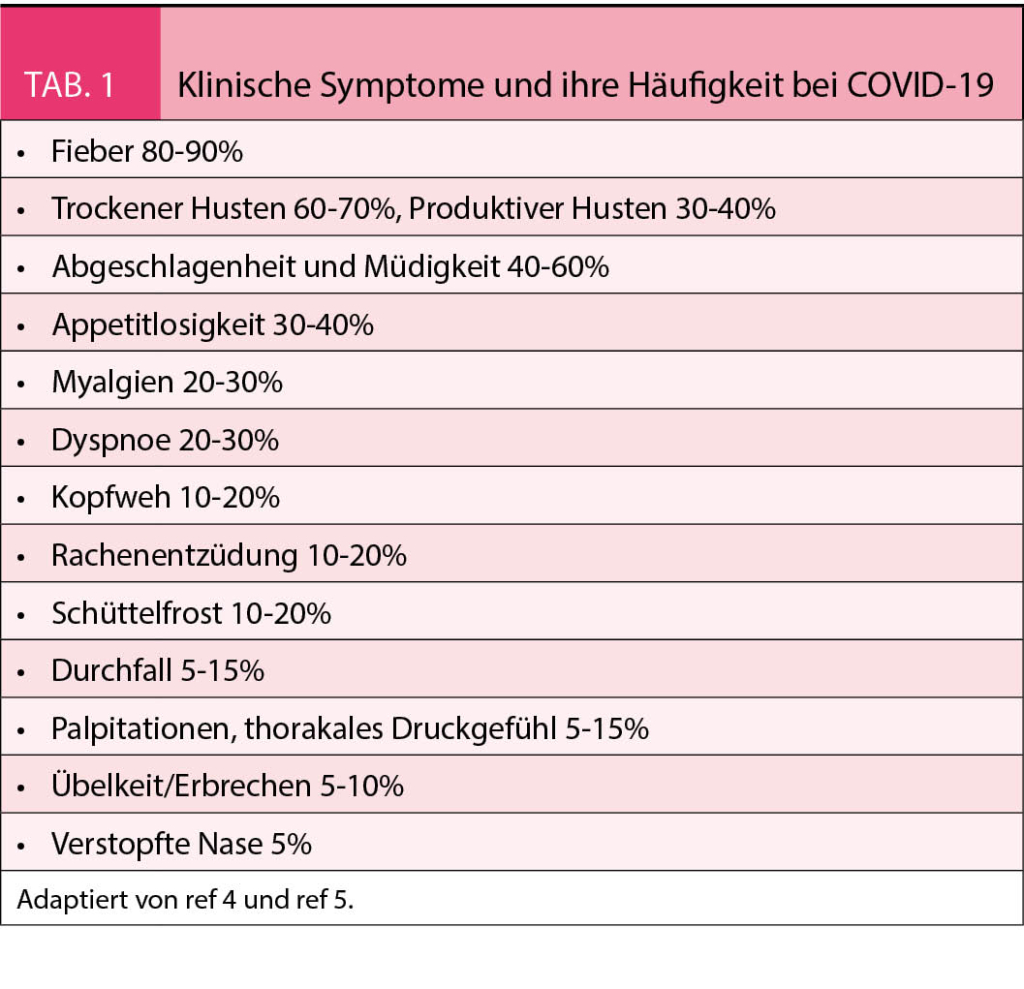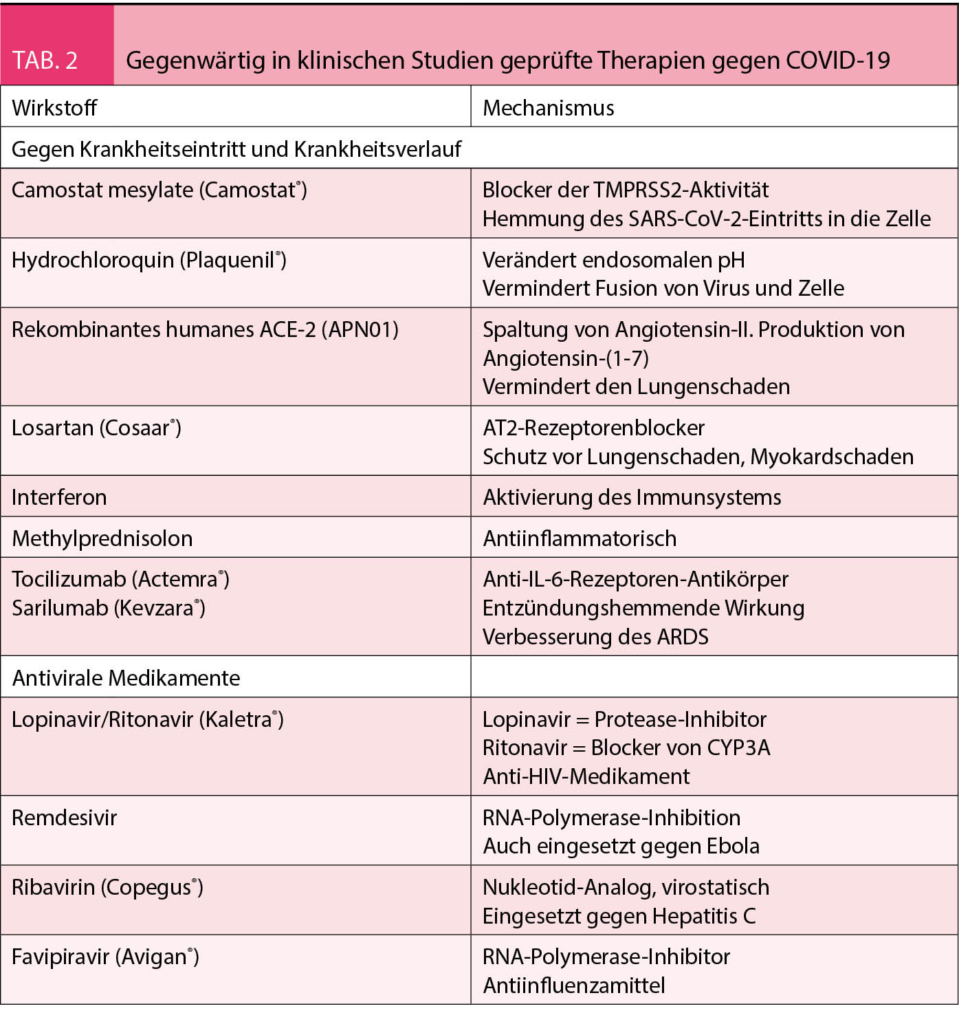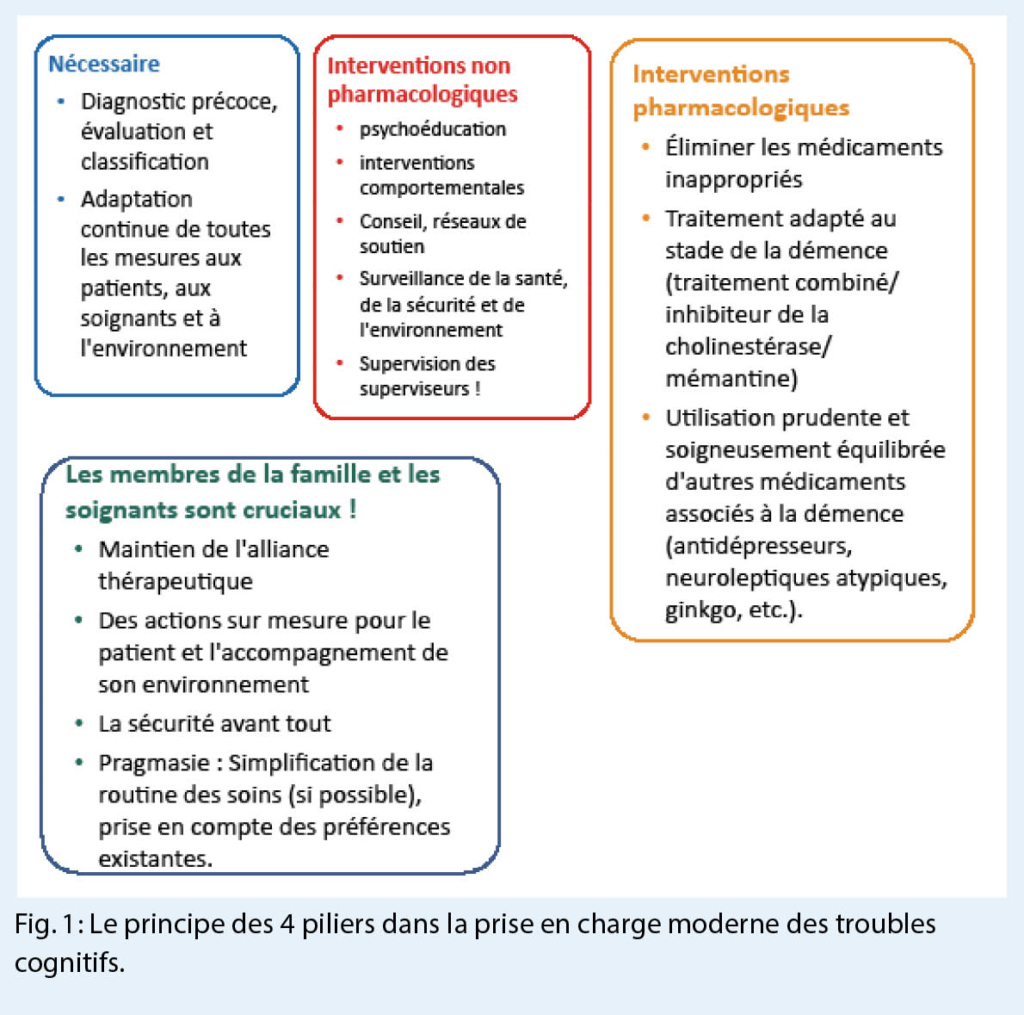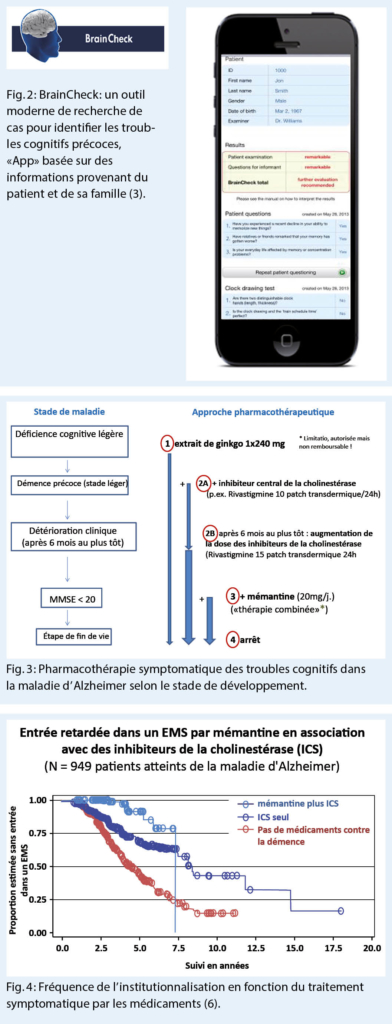Politische Interessenvertretung ist ein legitimer Bestandteil des demokratischen Meinungsbildungsprozesses in der Schweiz. Die Krebsliga engagiert sich seit Jahren für die Anliegen von Krebsbetroffenen und setzt sich zurzeit im Verband mit der politischen Interessenvertretung auseinander.
Gespannt wurde in der Wintersession 2019 die neue Zusammensetzung des Parlaments beobachtet: Stimmen die Mitglieder des National- und Ständeräts «linker» oder «rechter» im Vergleich zur letzten Legislatur? Wird konservativer entschieden, was wird unter «liberal» verstanden und welche Bündnisse bilden sich? In gesundheits- und sozialpolitischen Fragen sind die Mehrheitsverhältnisse noch nicht eindeutig. Die Veränderungen scheinen aber weniger stark ausgeprägt zu sein als erwartet.
20 Jahre bis zum neuen Gesetz
Das Schweizer Politsystem ist geprägt von Stabilität. Dazu tragen auch die staatspolitischen Prozesse bei. Bis eine Gesetzesänderung oder ein neues Gesetz und damit verbundene Massnahmen umgesetzt sind, dauert es nicht selten Jahre. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Krebsregistrierung: 1998 verlangte der damalige Nationalrat Franco Cavalli «auf der Basis der kantonalen und regionalen Register über Tumore ein einheitliches statistisches Informationssystem betreffend die Krebsmorbidität in der Schweiz zu schaffen» (1). Die entsprechende Motion wurde vom Nationalrat in Form eines Postulats an den Bundesrat überwiesen. Das neue Bundesgesetz (2), das schlussendlich im Grundsatz unumstritten war, ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten – notabene über 20 Jahre später. Seit diesem Jahr werden in der Schweiz nun Daten zu allen Krebsfällen einheitlich erfasst, um künftig Präventionsmassnahmen, Früherkennungsprogramme sowie Behandlung und Versorgung besser planen zu können. Ein Anliegen, für das sich die Krebsliga seit über 20 Jahren eingesetzt hat. Dies zeigt, dass es Geduld und Durchhaltewillen braucht und sich diese auch lohnen. Das Ziel ist allerdings noch nicht erreicht – eine Evaluation des Gesetzes ist bereits gestartet, eine Revision der Verordnung wohl absehbar.
Zur richtigen Zeit das politisch Machbare ausschöpfen
Gut vorbereitet kann zur richtigen Zeit und in geeigneter Formation das maximal politische Machbare ausgeschöpft werden. Feuerwehrübungen sind hingegen in unserem Politsystem meist nicht zielführend oder nur mit grossem Aufwand erfolgreich. Hier braucht es das richtige «Gspüri», wie die Deutschschweizer so schön sagen. Eine Gelegenheit muss korrekt erkannt und sinnvoll genutzt werden. Eine Organisation braucht bisweilen auch den Mut, sich proaktiv für ein relevantes Anliegen einzusetzen, selbst wenn die Zeit noch nicht reif dafür ist, und gleichzeitig die Bereitschaft, neue Allianzen einzugehen. Auch dazu gibt es ein aktuelles Beispiel: Seit Jahren setzt sich die Krebsliga für eine Verbesserung der Situation der betreuenden Angehörigen ein. In der Wintersession hat das Parlament nun das Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung verabschiedet. Unter anderem erhalten erwerbstätige Eltern von krebskranken Kindern Anspruch auf einen Betreuungsurlaub von maximal 14 Wochen, der wochen- oder tageweise bezogen werden kann und über die Erwerbsersatzordnung finanziert wird. Die Verabschiedung der Vorlage ist unumstritten ein wichtiger, wenn auch nur erster Schritt in die richtige Richtung. Im Rahmen der «Interessensgemeinschaft betreuende Angehörige» wird sich die Krebsliga für weitere Schritte einsetzen.
Die Krebsliga bleibt dran
Jede dritte Person erkrankt in der Schweiz an Krebs. Beispielsweise aufgrund des demografischen Wandels steigt die Zahl der Betroffenen kontinuierlich an. Dank dem medizinischen Fortschritt verläuft eine Krebserkrankung nicht mehr zwingend tödlich. So wird es voraussichtlich im Jahr 2030 in der Schweiz eine halbe Million «Cancer Survivors» geben – unumstritten eine grosse Herausforderung für das Schweizer Sozial- und Gesundheitssystem wie auch für unsere Wirtschaft. Damit haben Krebserkrankungen nicht nur eine hohe gesellschaftliche und ökonomische, sondern auch eine politische Relevanz. Aufgrund des hochkomplexen gesundheitspolitischen Umfelds in der Schweiz und den zahlreichen politischen Regulierungsprozessen, welche Krebsbetroffene und ihre Angehörige betreffen, ist ein professionelles und fokussiertes politisches Engagement gefragt. Deshalb hat sich die Krebsliga, die den Dachverband «Krebsliga Schweiz» und die 18 kantonalen und regionalen Ligen vereint, Ziele für die politische Interessensvertretung gesetzt. Sie engagiert sich in der Politik und der Gesellschaft dafür, dass
- Risikofaktoren von Krebs bekannt sind und wirksame Gegenmassnahmen umgesetzt werden,
- die Chancengerechtigkeit beim Zugang zu Informationen sowie zu sinnvollen Früherkennungsmassnahmen und Behandlungen gewährleistet ist,
- Anliegen von Krebsbetroffenen sowie deren Angehörigen berücksichtigt werden,
- die Krebsforschung gefördert wird.
Die direkte Demokratie und der Föderalismus erfordern mehrheitsfähige Lösungen. Diese basieren auf durchdachten Kompromissen, deren Zustandekommen Zeit braucht. Demgegenüber stehen die schnellen gesellschaftlichen Entwicklungen und eine zunehmend globale und digitale Welt. Geduld und Durchhaltewillen, aber auch Mut und «Gspüri» wird es auch in Zukunft brauchen.
Leiterin Politik und Public Affairs Krebsliga Schweiz
1. siehe Curia Vista 98.3286 (https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=19983286)
2. siehe SR 818.33 (https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121618/index.html)