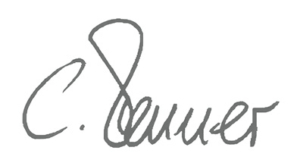Dans sa conférence, la Pre Petra Stute, du service universitaire de gynécologie de l’Hôpital de l’Ile à Berne, a présenté les approches thérapeutiques actuelles pour le traitement des troubles somatiques de la ménopause. Un accent particulier a été mis sur les recommandations pour le traitement de l’atrophie vaginale, aussi appelé syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM), ainsi que sur d’autres troubles fréquents tels que la sécheresse oculaire, l’acné et les symptômes musculo-squelettiques. Les traitements présentés comprennent des options hormonales et non-hormonales et offrent un aperçu complet des options de traitement qui devraient répondre aux besoins des femmes concernées.
Atrophie vaginale et syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM)

L’ un des principaux thèmes de la conférence était les options thérapeutiques pour le syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM), qui se caractérise par une atrophie vaginale et qui touche de nombreuses femmes après la ménopause. Les recomman- dations actuelles de la NAMS (North American Menopause Society) de 2020 proposent un guide de traitement qui comprend à la fois des approches hormonales et non-hormonales (1). Pour les femmes qui souhaitent ou ont besoin d’ un traitement sans hormones, il est recommandé d’ utiliser des lubrifiants lors des rapports sexuels ainsi que des crèmes hydratantes à action prolongée pour une utilisation régulière. Ces produits sont généralement bien tolérés et constituent un traitement de première intention pour les symptômes légers.
Cependant, si les patientes présentent des symptômes modérés à sévères ou si elles ne répondent pas suffisamment au traitement de première intention, il est recommandé d’utiliser des œstro- gènes locaux à faible dose ou de la déhydroépiandrostérone (DHEA) par voie vaginale. Les préparations à base de DHEA, comme Intrarosa® (supp vag), autorisé en Europe à la posologie de 6.5 mg par jour, constituent une option efficace pour stimuler la production locale d’œstrogènes dans les tissus et réduire l’atrophie vaginale. Des études montrent que cela entraîne chez de nombreuses femmes une amélioration de la lubrification vaginale et une réduction des symptômes tels que la sécheresse et les douleurs. Comme alternative, une thérapie systémique aux œstro-gènes peut être envisagée, en particulier en cas d’apparition de symptômes vasomoteurs, tels que des bouffées de chaleur.
Une nouvelle approche dans le traitement de la GMS est l’utilisation de lasers vaginaux. Cependant, ces derniers font encore l’objet de recherche et des études plus approfondies quant à leur effet à long terme et leur sécurité doivent encore être menées. Les résultats préliminaires sont prometteurs et cette méthode pourrait dans l’avenir être envisagée comme thérapie complémentaire ou alternative en cas de GMS sévère.
Sécheresse oculaire et androgènes topiques
La kératoconjonctivite sèche péri- et post-ménopausique est un effet secondaire fréquent de la ménopause. Elle se manifeste par une sécheresse oculaire et peut considérablement affecter la qualité de vie de nombreuses femmes. L’ exposé a évoqué la possibilité d’ une application topique d’ androgènes. Comme les androgènes peuvent être aromatisés localement dans les tissus, il est judicieux de les appliquer sur la peau des paupières. L’ exemple d’ une formule magistrale de crème vaginale à base d’ estriol et de 1 % de propionate de testostérone a été mentionné. Cette crème peut être appliquée une fois par jour, le soir, sur les paupières. Cependant, ce traitement n’a pas encore fait l’objet de recherches approfondies et il manque des études sur la sécurité à long terme et des effets systémiques. Il est donc recommandé de n’ utiliser cette option thérapeutique que sous étroite surveillance ophtalmologique et avec prudence.
Traitement de l’ acné pendant la ménopause
Outre la GMS et la sécheresse oculaire, la ménopause peut également entraîner une aggravation ou une réapparition de l’ acné. Les options de traitement, une combinaison de thérapies topiques et systémiques, ont été présentées en détail. Parmi les produits topiques, on trouve les rétinoïdes tels que la crème Airol® 0.05 % et Differin®, qui ont un effet anti-inflammatoire et régulent la production de sébum. En complément, des antibiotiques tels que la clindamycine, souvent associée au peroxyde de benzoyle, peuvent être utilisés sous forme de gel, comme le gel Duac Akne Gel®, pour inhiber la croissance bactérienne.
Dans les cas plus graves, il est recommandé de prendre du Doxacné® (50 mg par jour pendant 6 à 12 semaines), un antibio- tique oral qui agit spécifiquement sur l’acné hormonale. Pour les femmes sujettes aux fluctuations hormonales, un traitement antiandrogène à base d’ Aldactone® (50 à 100 mg par jour) peut également être bénéfique. Cette utilisation off-label vise à diminuer l’effet des androgènes dans le corps, afin de réduire les problèmes de peau. Finalement, il est important de souligner l’importance de la protection solaire, d’une alimentation équilibrée et d’ un mode de vie sain pour contribuer à stabiliser l’ aspect de la peau.
Muscles et articulations: maintien et prévention grâce à l’ hormonothérapie
Un autre aspect souvent sous-estimé des troubles liés à la ménopause concerne le système musculo-squelettique. Il n’ est pas rare que les femmes ménopausées souffrent de faiblesse musculaire et de douleurs articulaires, ce qui peut nuire à leur mobilité et à leur qualité de vie. Des études montrent qu’ une hormonothérapie, en particulier une thérapie combinée d’ œstrogènes et de progestatifs, a un effet positif sur les muscles et les articulations et peut donc avoir un effet préventif. Les mécanismes exacts ne sont pas encore entièrement étudiés, mais on suppose que la baisse du taux d’ œstrogènes pendant la ménopause joue un rôle dans la faiblesse musculaire et les douleurs articulaires. Une hormo- nothérapie ciblée peut améliorer le tonus musculaire et réduire le risque de problèmes articulaires.
Approches holistiques et mesures de style de vie
En complément des traitements médicamenteux, l’ importance des mesures non pharmacologiques et d’ une approche globale a été soulignée lors de la conférence. Il s’ agit notamment d’ une activité physique régulière, qui maintient la force musculaire et la santé des articulations, ainsi que de mesures ciblées pour gérer le stress. Une alimentation équilibrée, privilégiant les aliments anti-inflammatoires, peut également contribuer à réduire les symptômes et à améliorer l’état de santé général. L’arrêt du tabac et le contrôle du poids sont des facteurs supplémentaires qui peuvent soutenir le traitement et réduire le risque de divers phénomènes qui accompagnent la ménopause.
Message à retenir
Le traitement des troubles somatiques de la ménopause doit être adapté à chaque personne et combiner des options pharmacologiques et non pharmacologiques. Les lubrifiants vaginaux et les crèmes hydratantes constituent le traitement de base des troubles musculo-squelettiques, tandis que les hormones vaginales ou les préparations à base de DHEA peuvent être utilisées pour les troubles plus graves. Il existe également des traitements spécifiques pour les yeux secs et l’ acné. L’ importance des facteurs liés au mode de vie ne doit pas être sous-estimée dans la planification du traitement, car ils contribuent de manière significative à l’ efficacité et à la tolérance des mesures prises.
lehmann@medinfo-verlag.ch
1. Menopause.2020 Sep;27(9):976-992. doi: 10.1097/GME.0000000000001609. The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society