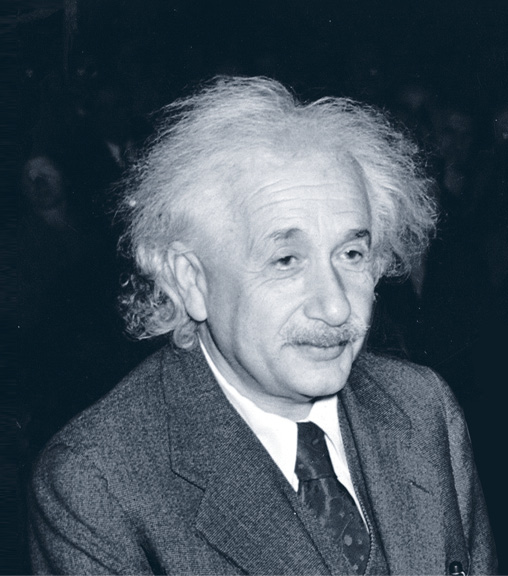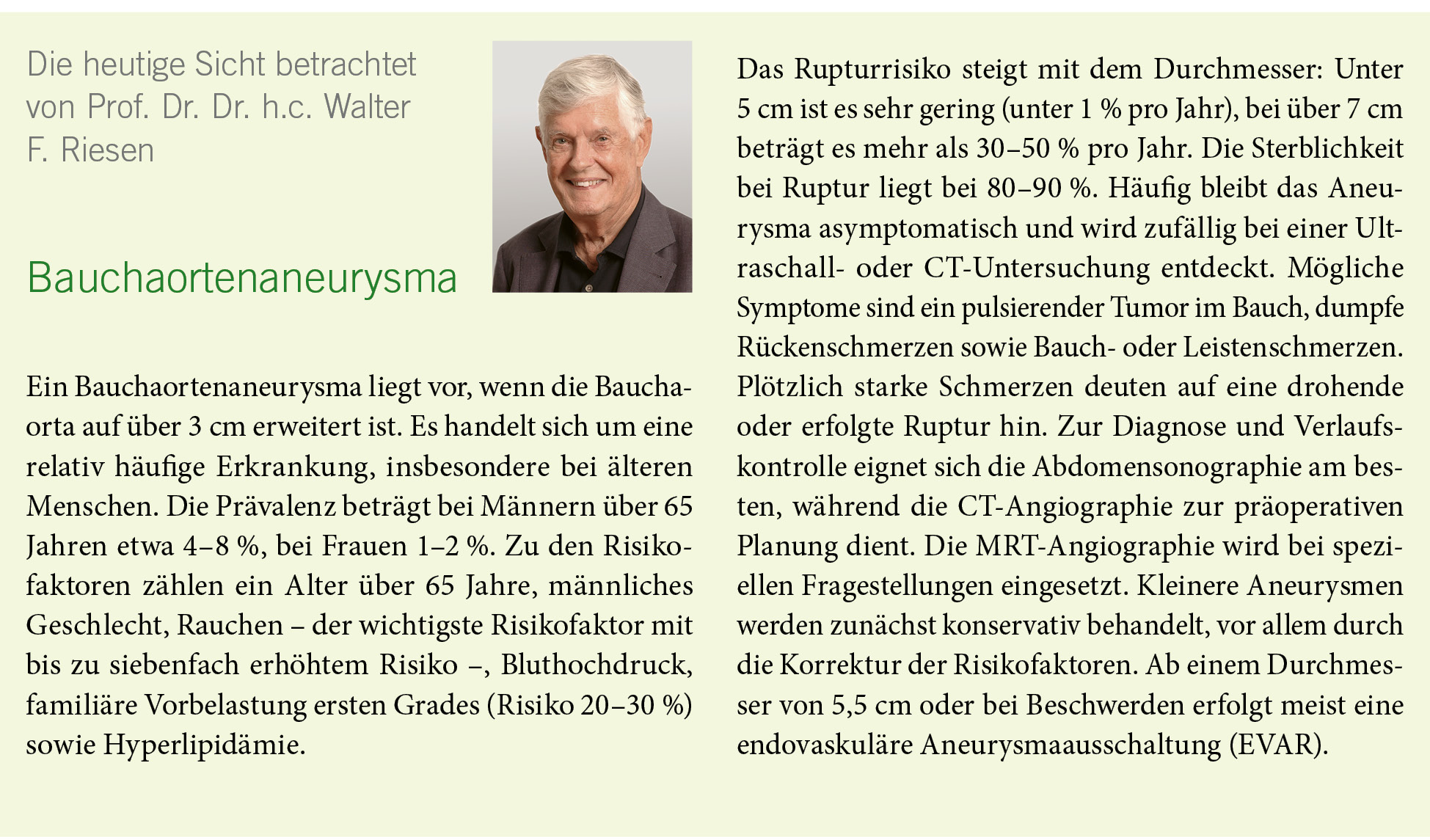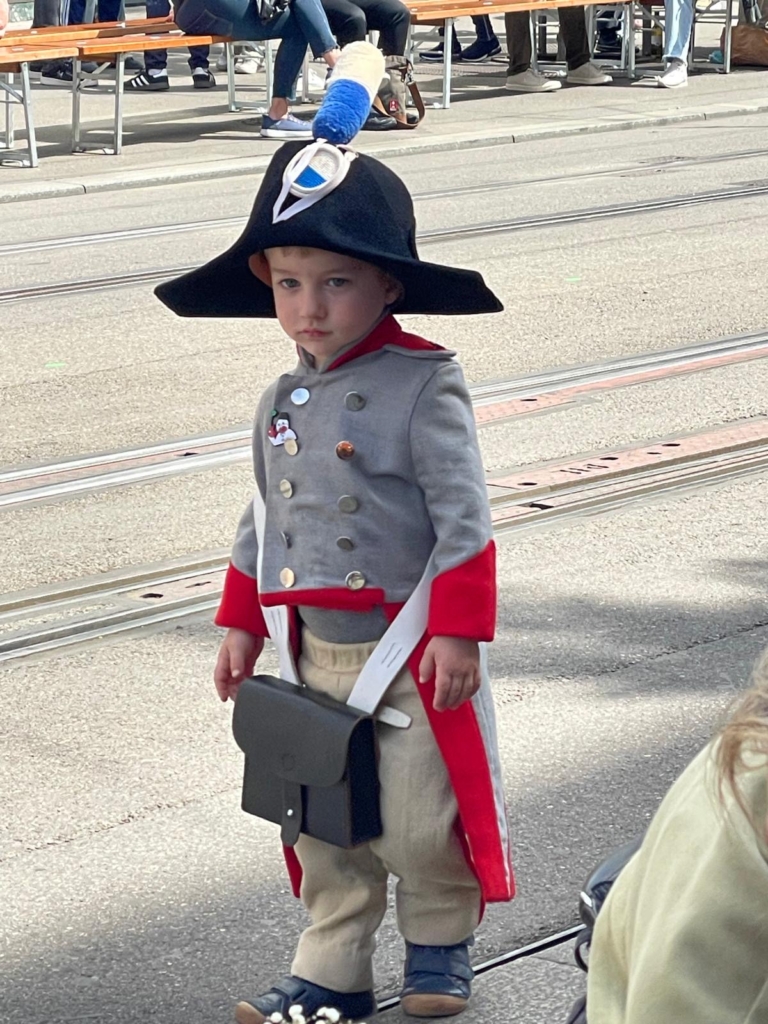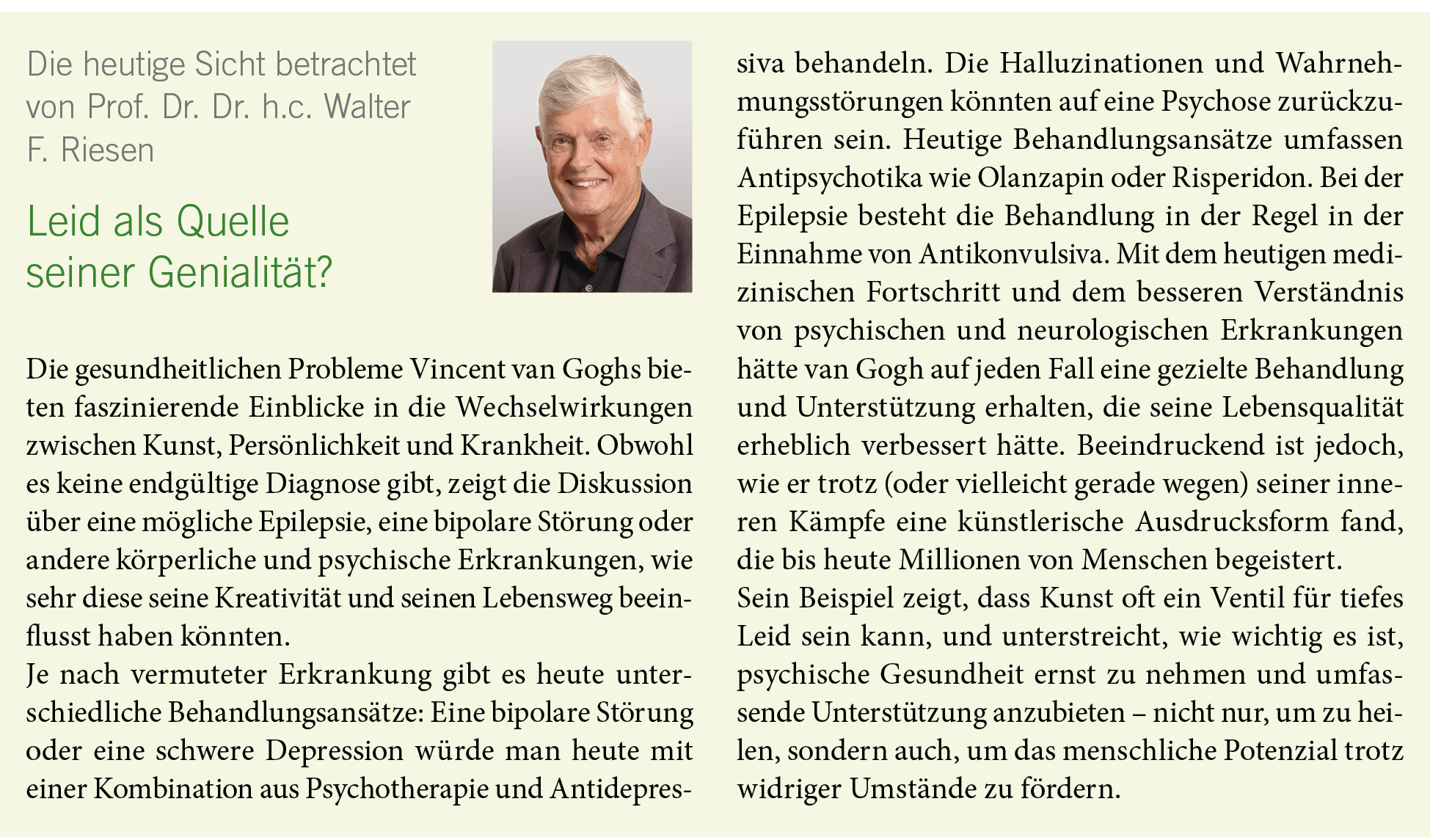Kreativität und Krankheit: Vincent van Gogh kannte beides. Auf Episoden geistiger Klarheit folgten dramatische Höhen und Tiefen, kurze und heftige Krankheitsschübe mit akustischen und optischen Halluzinationen, Depressionen, epileptischen Anfällen und Desorientierung. Zahlreiche Forscher gehen primär von psychischen Erkrankungen aus, andere von somatischen Ursachen. Letztlich bleibt unklar, an welche(n) Erkrankung(en) van Gogh litt.
Patient: Vincent van Gogh
Geboren: 30. März 1853 in Groot-Zundert, Niederlande
Gestorben: 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise, Frankreich
Ärzte und Psychologen stellten zu Lebzeiten und posthum bei van Gogh verschiedenste Diagnosen seiner Krankheit(en), die im dritten Lebensjahrzehnt einsetzten. Von einer Epilepsie über Schizophrenie bis zur Menière-Erkrankung, von der bipolaren Störung bis hin zu Syphilis wurden diverse Leiden vermutet. Gegen primär psychiatrische Diagnosen sprach, dass die psychotischen Episoden erst spät in van Goghs Leben auftraten und nur relativ kurz anhielten. Zudem lagen Anzeichen für eine organisch bedingte Psychose vor, etwa fokalneurologische Symptome, epileptische Anfälle, Gedächtnisstörungen und optische Halluzinationen. Von den somatischen Differenzialdiagnosen deckten vor allem die Temporallappenepilepsie und die akute intermittierende Porphyrie (AIP) van Goghs psychiatrisch-neurologische Symptome ab. Sein übermässiger Alkoholkonsum hat beide Erkrankungen möglicherweise aggravieren und zu einem Alkoholentzugsdelir führen können.
Stress, Alkohol, Hunger, Tabakkonsum
Van Gogh quälten immer wieder starke Magenschmerzen. Forscher interpretierten diese Beschwerden gemeinsam mit der Psychose und epileptischen Anfällen als mögliche Manifestation einer akut intermittierenden Porphyrie. Häufig manifestiert sich die AIP um das 30. Lebensjahr latent, bis äussere Einflussfaktoren einen und akuten Schub auslösen. Dazu gehören Stress, Alkohol, Hungern und Tabakkonsum. All diese Aspekte trafen auf van Gogh zu: In seinen exzessiven Schaffensphasen konsumierte er während der Arbeit regelmässig Alkohol, vor allem Cognac und Absinth, und ass tagelang fast nichts, um das Geld für Malfarben zu sparen. «Wenn der Sturm in mir zu laut brüllt, trinke ich ein Glas zu viel, um mich zu betäuben», schrieb er seinem Bruder und Vertrauten Theo, der als Kunsthändler in Paris arbeitete, zwei Jahre vor seinem Tod. Auch das Nervengift Alpha-Thujon, das im Absinth enthalten ist, könnte zu AIP-Schüben geführt haben.
Zeitgenossen berichteten, van Gogh habe unter tonischen Spasmen der Hand gelitten und oft abwesend vor sich hin gestarrt. Für die Dauer dieser Episoden habe eine Amnesie bestanden. Van Gogh konnte sich etwa nicht daran erinnern, dass er Gaugin bei seinem Besuch in Arles bedroht oder sich ein Ohr abgeschnitten hatte. Seine Ärzte gingen von einer Epilepsie aus und behandelten ihn mit Kaliumbromid, einem der ersten Antikonvulsiva. Danach soll sich der Zustand des Malers nach eigenen Angaben deutlich gebessert haben. Dennoch setzten die weiterbehandelnden Ärzte das Medikament aus unbekannten Gründen wenig später wieder ab.
«Ich habe nicht weniger als 10 Zähne verloren»
Van Gogh ging regelmässig in Bordelle und war zeitweise mit einer Prostituierten liiert. Daher wurde von einigen Forschern auch eine Neurosyphilis als mögliche Ursache seiner Symptomatik diskutiert; diese konnte sowohl zu epileptischen Anfällen als auch zu psychotischen Störungen führen. Allerdings zeigte van Gogh keine weiteren Lues-IV-Symptome wie Ataxie, Hirnnervenausfälle oder Sensibilitätsstörungen.
– Der Maler galt als starker Raucher. Sich selbst porträtierte er oft mit Pfeife. Seinem Bruder schrieb er in einem seiner vielen Hundert Briefe an ihn, dass er vermehrt rauche, um «den leeren Bauch nicht spüren» zu müssen.
– In van Goghs Familie gab es zahlreiche psychiatrische Erkrankungen. Bei van Goghs Vater und seinen Geschwistern traten neben neurologisch-psychiatrischen Symptomen wie Wahnvorstellungen auch Lähmungserscheinungen auf. Forscher sahen in dieser Familienanamnese Anzeichen für eine autosomal-dominant vererbte AIP.
– Eine Bleivergiftung könnte zu einer Enzephalopathie und starken Bauchschmerzen geführt haben. Die mögliche Giftquelle: die bleihaltigen Ölfarben des Künstlers. Auch Frida Kahlo, Peter Paul Rubens und Michelangelo Caravaggio sollen an einer chronischen Bleivergiftung gelitten haben. Seinem Bruder Theo schrieb van Gogh 1886: «Ich habe nicht weniger als zehn Zähne verloren», was sich wie auch seine Darmkoliken, die Anämie, seine Verwirrtheit und Schlaflosigkeit mit einer chronischen Bleivergiftung erklären liesse. Auch wegen van Goghs Verwirrtheit, Schlaflosigkeit oder Aggressivität gegen Gaugin vermuteten Forscher eine chronische Bleivergiftung. Neben Bauchkoliken, blauschwarzem Zahnfleischsaum und Fallhand wurde eine hypochrome Anämie durch den Verdacht auf eine Bleivergiftung als Ursache vermutet.
– Die Fastenperioden und der Alkoholkonsum könnten auch zu einem chronischen Vitaminmangel geführt haben. Das Fehlen von Vitamin B12 etwa, könnte sich in neuropsychiatrischen Symptomen wie Antriebslosigkeit, gedrückter Stimmung oder einer Psychose manifestiert haben. Neben der erwähnten Anämie finden sich in van Goghs Briefen auch Hinweise auf vegetative Folgeerscheinungen eines möglichen Vitamin-B12-Mangels wie Impotenz. Ein Vitamin-B3-Mangel aufgrund des Alkoholabusus könnte bei van Gogh zu psychischen Auffälligkeiten, Desorientierung oder Aggression geführt haben. Ebenfalls iatrogene Ursachen kommen infrage: Digitalis-Intoxikationen könnten bei van Gogh neben Übelkeit und Bauchschmerzen mit einem visuell wahrgenommenen Gelb- und Grünstich einhergegangen sein, wie man ihn von van Goghs berühmten Sonnenblumen kennt. Auch die These, dass der Maler an der erblichen Stoffwechselkrankheit Porphyrie gelitten haben könnte, die einen Einfluss auf die Lichtwahrnehmung des Künstlers hatte, diente einigen Forschern als Erklärung für van Goghs eigenwillige Farbkompositionen.
Höchst produktive Zeit im «Asyl für Geisteskranke»
Vincent van Gogh litt an akustischen Halluzinationen und 1879 wurde erstmals die Theorie vertreten, dass der Künstler an Morbus-Menière-Schwindel gelitten habe. Ein damit einhergehender unerträglicher Tinnitus könnte die Erklärung für van Goghs Attacke in Arles in der Nacht vom 23. Dezember 1888 aufs eigene Ohr sein, an der er, fast verblutet, am nächsten Morgen in seinem Bett gefunden und ins Krankenhaus von Arles eingeliefert wurde.
Nach diesem Vorfall fürchteten sich die Nachbarn van Goghs noch mehr vor dem «Fou roux» und leiteten eine Unterschriftenaktion ein, um ihn einsperren zu lassen. 1889 begab sich van Gogh freiwillig in das «Asyl für Geisteskranke» Saint-Paul-de-Mausole in Saint-Rémy, wo er während eines Jahres behandelt wurde. Es wurde eine der produktivsten Zeiten des Malers überhaupt. Umgeben von riesigen Pinien und grünen Zypressen, entstanden unter vielen anderen Bildern die weltbekannten Grosswerke «Sternennacht» oder «Weizenfeld mit Zypressen». Im Mai 1890 zog er zu seinem Arzt Dr. Paul Gachet nach Auvers-sur-Oise bei Paris. Am 29. Juli 1890 schoss der Künstler auf sich selbst und erlag zwei Tage danach den Verletzungen. Eine Autopsie unterblieb.
Jörg Weber
Quellen:
– Arnold W.: Ein Leben zwischen Kreativität und Krankheit. Birkhäuser Basel/Boston/Berlin, 1993
– Decker G.: Vincent van Gogh – Pilgerreise zur Sonne. Biografie. Matthes & Seitz Berlin, 2009
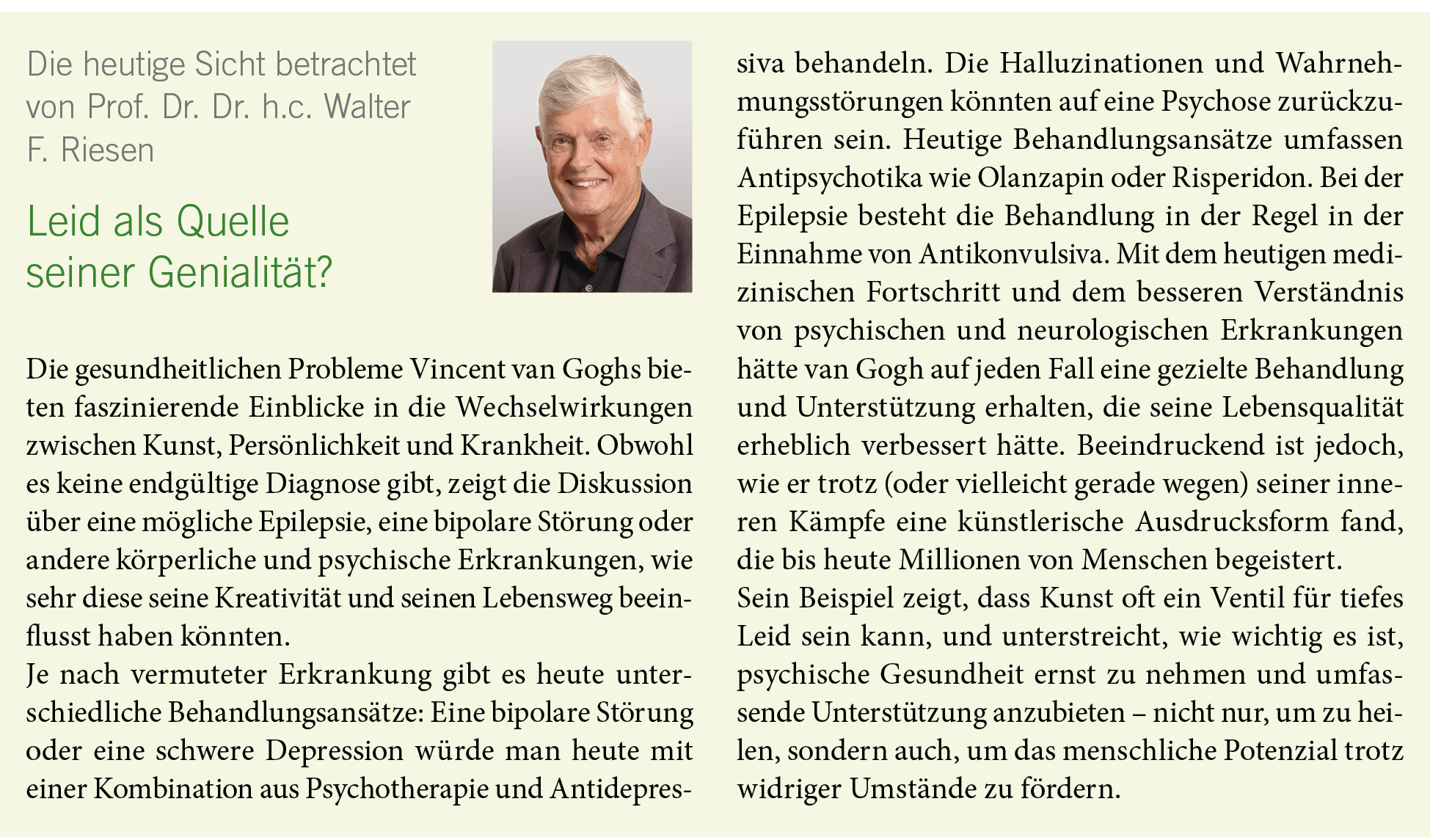
Prof. Dr. Dr. h.c. Walter F. Riesen
riesen@medinfo-verlag.ch