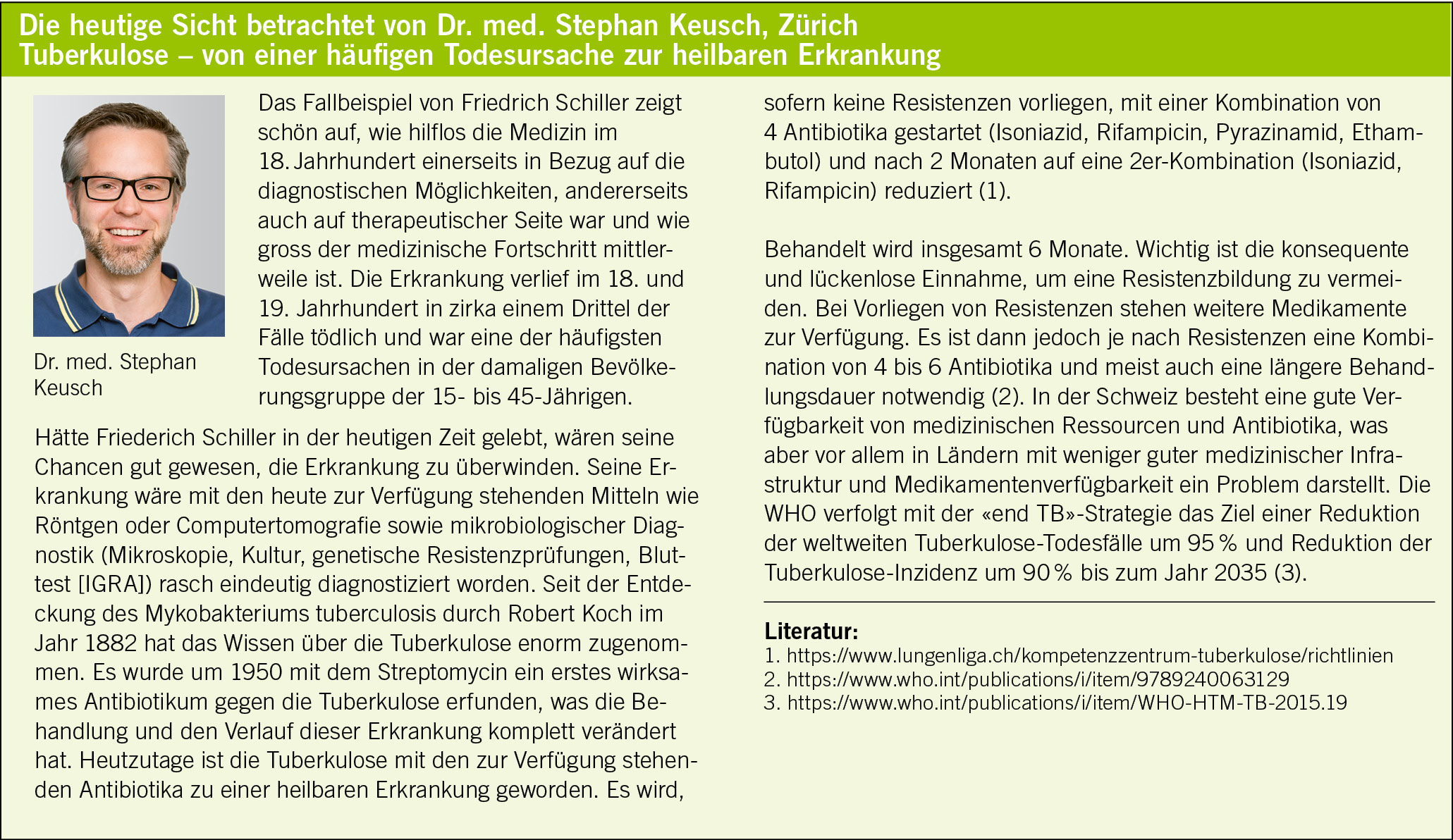Als Friedrich Schillers Drama «Wilhelm Tell» am 17. März 1804 am Weimarer Hoftheater uraufgeführt wurde, war Friedrich Schiller bereits todkrank. Gut ein Jahr später, am 1. Mai 1805, erlitt der Dichter während seines letzten Besuchs des Hoftheaters einen Zusammenbruch mit langanhaltenden Fieberkrämpfen und Bewusstlosigkeit. Acht Tage später starb er.
Patient: Friedrich von Schiller
Geboren: 10. November 1759 in Marbach am Neckar
Gestorben: 9. Mai 1805 in Weimar
Seit zwei Jahrhunderten hat jede Ärztegeneration die Krankengeschichte und Obduktion Friedrich von Schillers nach ihrem Wissensstand betrachtet. Über seine Krankheiten und Todesursache existiert eine unübersehbare Fülle an Literatur.
Nach Aussagen seiner Schwester Christophine war Schiller «vom frühesten Alter an ein zartes Kind», dem schon die üblichen Kinderkrankheiten stark zusetzten. Als 14-Jähriger musste er auf Anordnung des Landesherrn, des Württembergischen Herzogs Karl Eugen, unfreiwillig auf die Militärakademie. Schon dort lag er häufig im Krankenzimmer, meist mit Husten und «Lungenkatarrh». Während seines fünfjährigen Medizinstudiums ab 1776 lernte er tagsüber Medizin, nachts widmete er sich seiner Leidenschaft, der Schriftstellerei. Im dritten Studienjahr obduzierte Schiller in der Hohen Karls-Schule in Weimar einen Medizinmitstudenten, der an Tuberkulose gestorben war. Ob er damals angesteckt wurde, wie viele Forscher vermuten, ist unklar. Nach sieben Jahren auf der «Militär-Pflanzschule» wurde er Regimentsmedikus, Militärarzt. Heimlich begann er sein erstes Hauptwerk zu schreiben, «Die Räuber», das im Januar 1782 uraufgeführt wurde. Das vom Pubikum bejubelte Stück, das Kritik an der Obrigkeit übte, verärgerte Herzog Karl Eugen. Schiller musste für 14 Tage in der Stuttgarter Hauptwache in Arrest, und der Herzog verbot ihm zukünftig jede literarische Tätigkeit. Schiller floh nach Mannheim, wo er 1783 Theaterdirektor am Nationaltheater wurde.
Anfang September 1783 erkrankte der 24-Jährige an einem «kalten Fieber» (damalige Bezeichnung für Schüttelfrost) und an der «gallichten Sucht» (so nannte man eine zeitweilige Gelbfärbung der Haut). Aus Kalendernotizen und Briefen Schillers ist bekannt, dass er unter regelmässig auftretenden Fieberanfällen litt, was auf eine Malariainfektion hindeutete. Schiller hat sich, wie auch häufig später, selbst behandelt, mit Brechweinstein, Chinarinde, Wassersuppen, fleischloser Diät. Er schrieb: «Chinarinde esse ich wie Brot».
Schiller klagte über die Schwäche seines Körpers
Schiller war ein Nachtarbeiter, er schrieb seine Werke in durchwachten Nächten. Abends, wenn ihn die Gesellschaft verliess, stellte er Wein, Liköre, Schnupftabak und Kaffee parat, er rauchte und arbeitete bis zum Morgengrauen. Inspirierend wirkte auf ihn der Geruch faulender Äpfel. So sehr er in seinen Briefen die Schwäche des Körpers beklagte, so wenig nahm er Rücksicht auf seine Gesundheit. (Schillers Lebensweise war seinen Freunden bekannt. Goethe schrieb darüber: «Seine durchwachten Nächte haben unseren Tag erhellt.»)
Am Nachmittag des 3. Januar 1791 befiel den 32-jährigen Dichter während eines Konzerts in Erfurt ein heftiges Fieber. Er erkrankte an Rippenfell- und Lungenentzündung. Seine Studenten, darunter der junge Novalis, teilten sich die Nachtwachen. Schiller hatte hohes Fieber, er hustete mit Eiter vermischtes Blut aus. Die damals gängigen Behandlungen mit Aderlässen, Zugpflaster, Brech- und Abführmitteln verschafften ihm keine Linderung. Erst nach mehreren Wochen konnte er das Krankenbett verlassen. Danach klagte er über «fortdauernde schmerzhafte Spannungen in der Brust». Nach vorübergehender Besserung erlitt er im Mai 1791 eine weitere schwere Krankheitsattacke. Als Mediziner registrierte er seine Zustände genau und schilderte: «Der Atem wurde so schwer, dass ich über der Anstrengung Luft zu bekommen, bei jedem Atemzug ein Gefäss in der Lunge zu zerspringen glaubte.» Dazu klagte er über «starken Fieberfrost» und «Krämpfe im Unterleib und Zwerchfell». Unter seinen Bekannten zirkulierte bereits das Gerücht, Schiller sei unheilbar an «Lungensucht», der damaligen Bezeichnung für Tuberkulose, erkrankt.
Der Verlauf von Schillers Leiden von 1791 bis zu seinem Tod 1805 setzte sich mit einer Kette von Krankheitserscheinungen fort, richtig gesund wurde er nie mehr. Katarrh, Fieber, Husten und zeitweise Bettlägrigkeit begleiteten sein weiteres Leben. Dies manifestiert sich auch in vielen Äusserungen gegenüber Freunden und Bekannten. In einem Brief an Goethe im September 1794, bei dem es um einen Besuch ging, schrieb Schiller: «Ich bitte bloss um die leidige Freyheit, bey Ihnen krank seyn zu dürfen».
Der Jugendfreund, Staatsrat und spätere Biograf Christian Gottfried Körner schrieb 1796 über den Dichter: «Schiller selbst wandelt, ja man möchte sagen, rennt unaufhörlich im Zimmer herum… Oft sieht man ihm sein körperliches Leiden an, besonders wenn ihn die Erstickungsanfälle anwandeln. Wenn es zu arg wird, geht er hinaus und braucht irgendein Palliativ. Kann man ihn in solchen Momenten in eine interessante Unterredung ziehen, so verlässt ihn das Übel wieder, um sogleich zurück zu kommen, wenn nichts mehr zu erörtern übrig ist. Überhaupt sind ihm anstrengende Arbeiten das sicherste Mittel für den Augenblick. Man sieht, in welcher ununterbrochenen Spannung er lebt und wie sehr der Geist bei ihm den Körper tyrannisiert…».
Im Januar 1798 schrieb Schiller an Körner über den in Arbeit befindlichen «Wallenstein»: «Hätte ich 10 Wochen ununterbrochener Gesundheit, so wäre er fertig; so aber habe ich kaum das Drittheil der Zeit zu meiner Disposition.»
Champagner zum «Heben der Kräfte»
Im Todesjahr 1805 hatte Schiller zwei Krankheitsattacken. Im Februar litt er vor allem unter Verstopfung und Blähungen, vermutlich aufgrund der Tuberkulose. «Die verwünschten Verstopfungen! Sie bringen mich alle Jahre um ein Trauerspiel!».
Am Mittwoch, 1. Mai 1805, hatte er sich entschlossen, den Abend im Theater zu verbringen: die Bühnenatmosphäre bedeutete für ihn immer Zauber und Anregung.
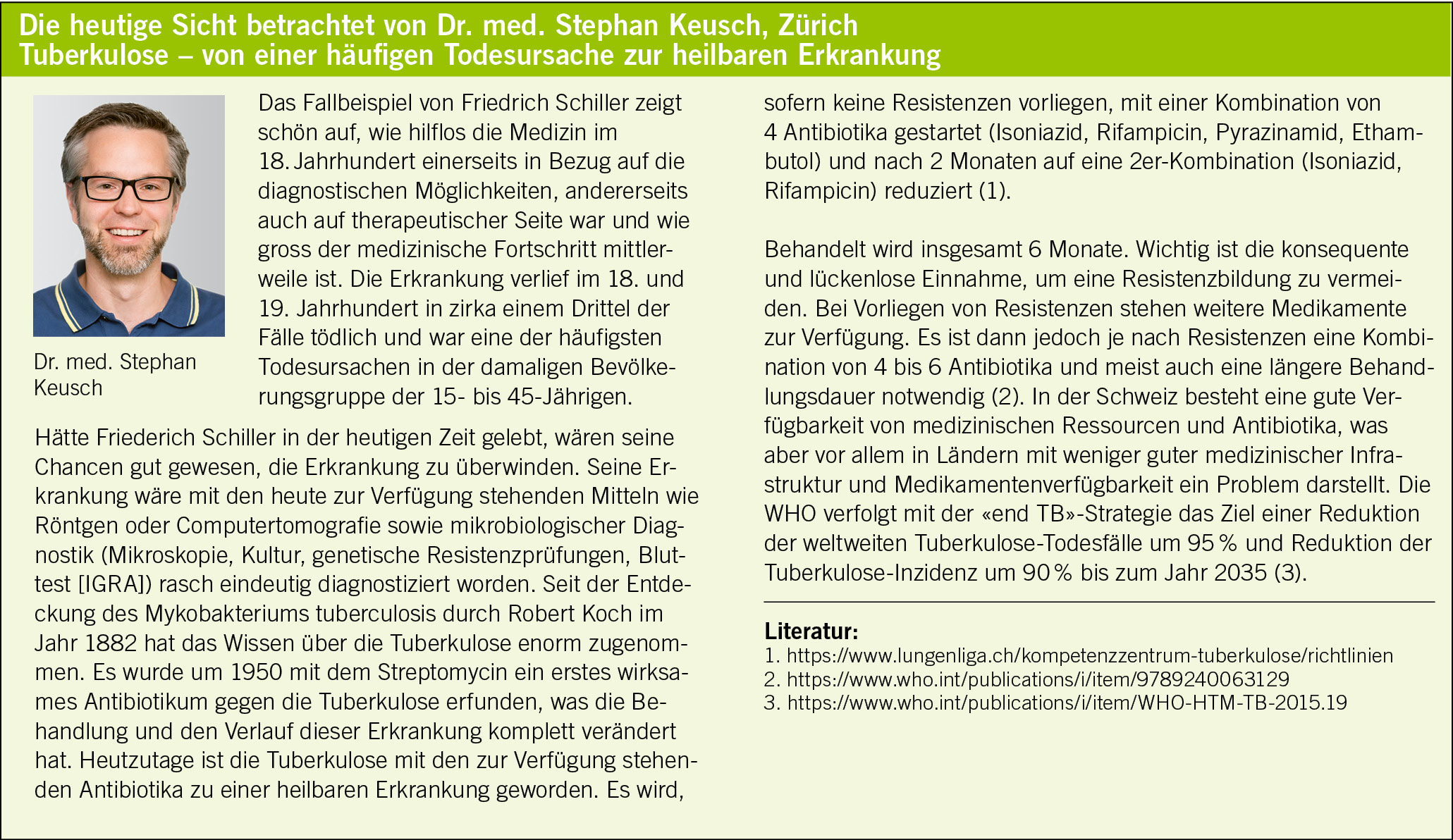
Dr. med. Stephan Keusch
Praxisgemeinschaft Lungdocs
Merkurstrasse 20
8032 Zürich