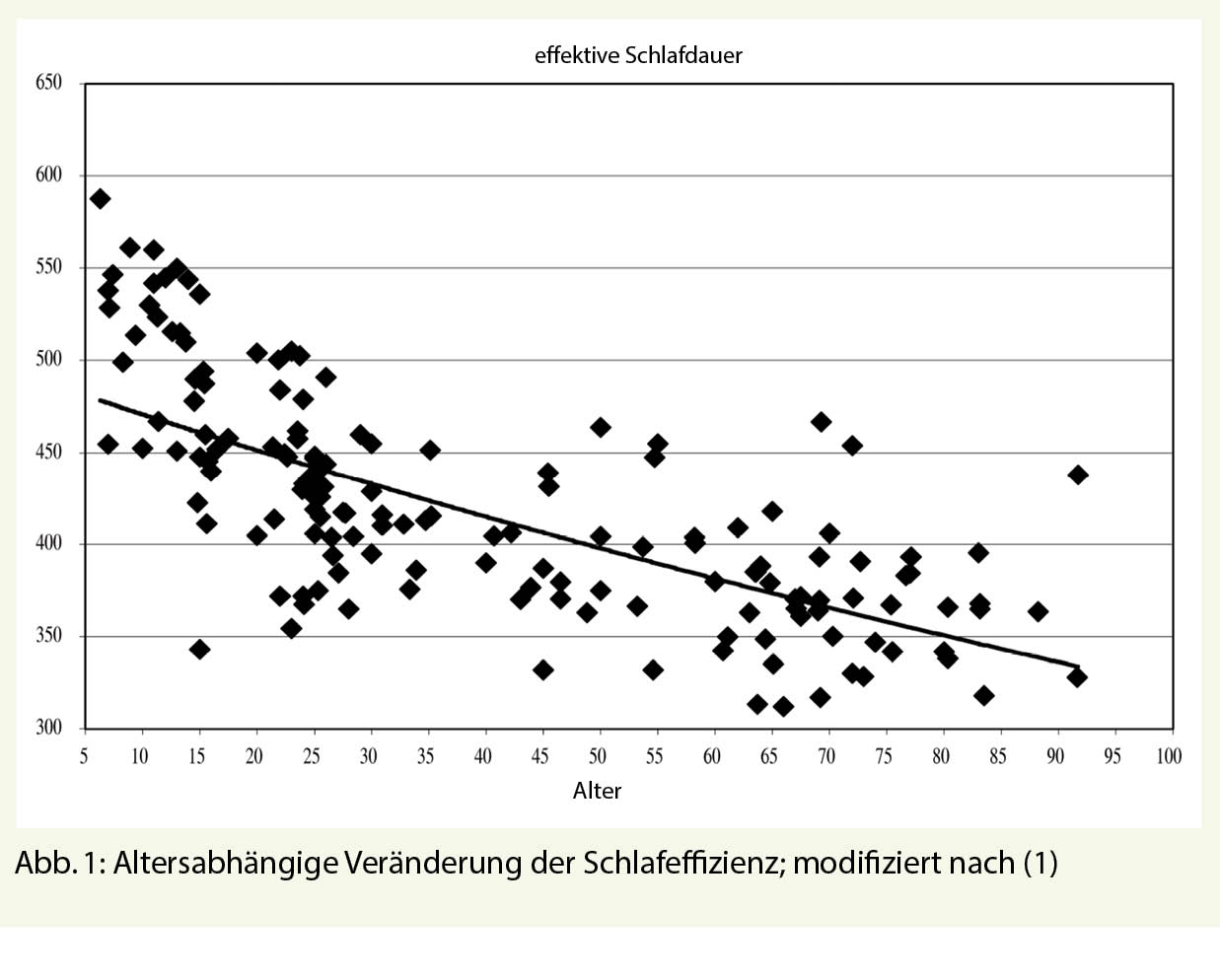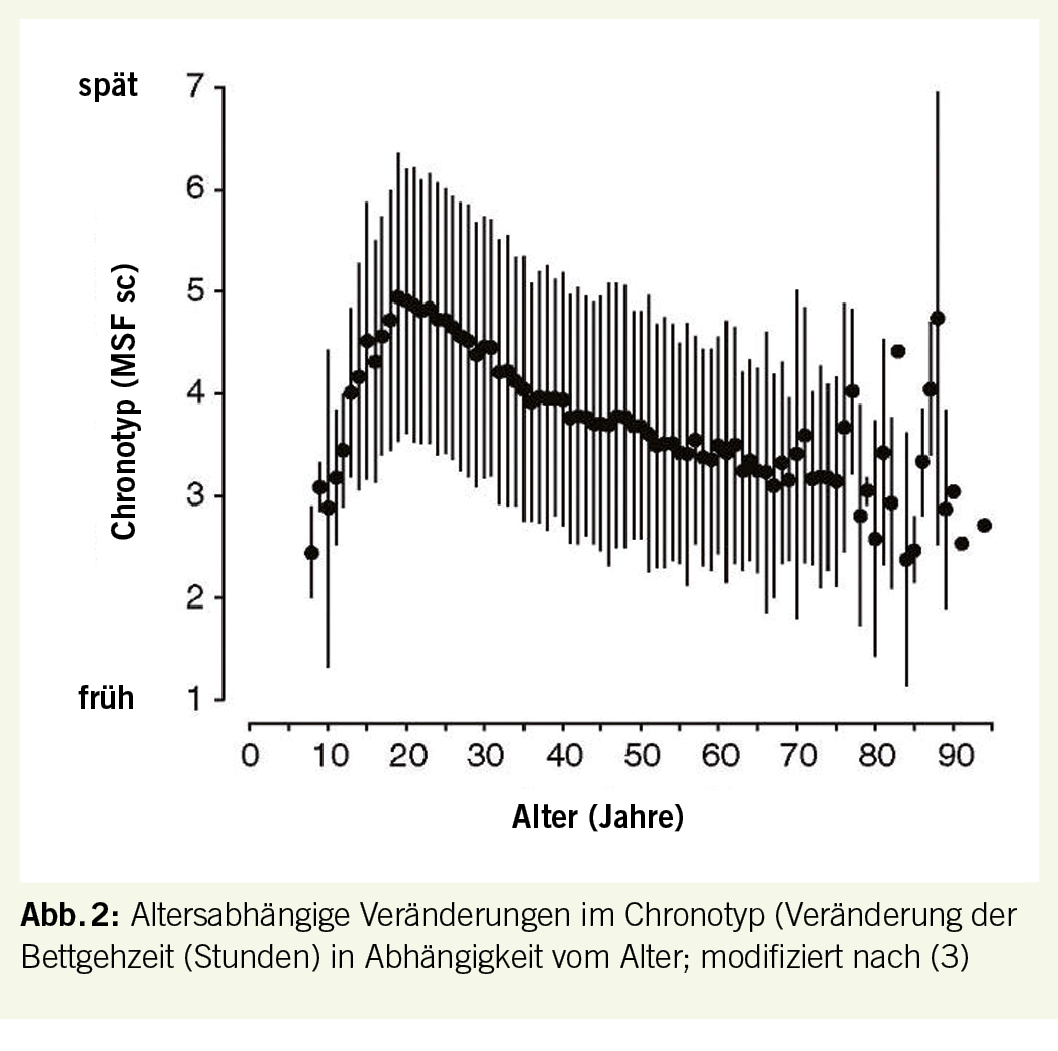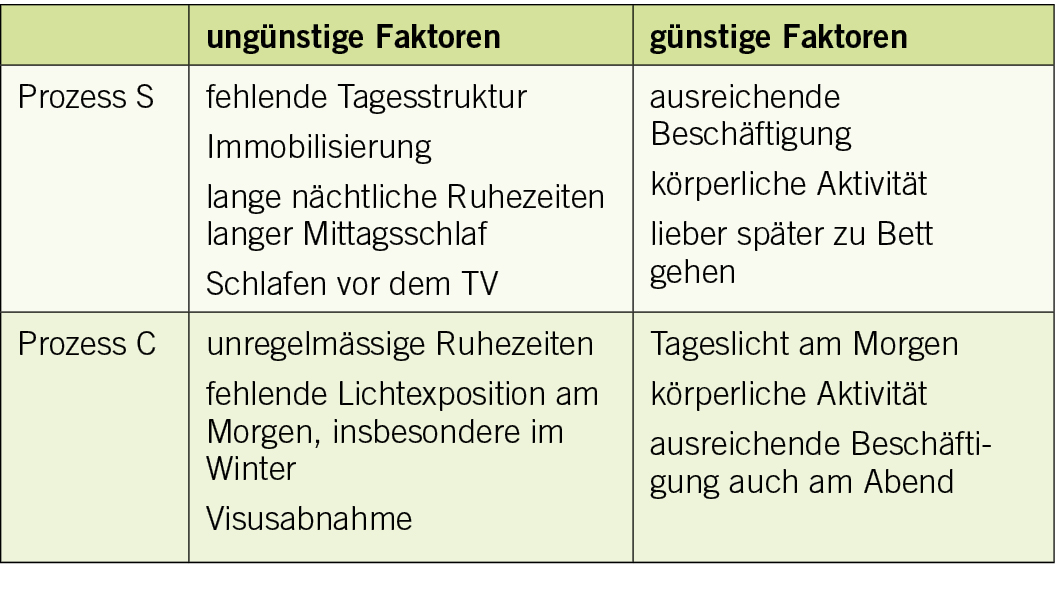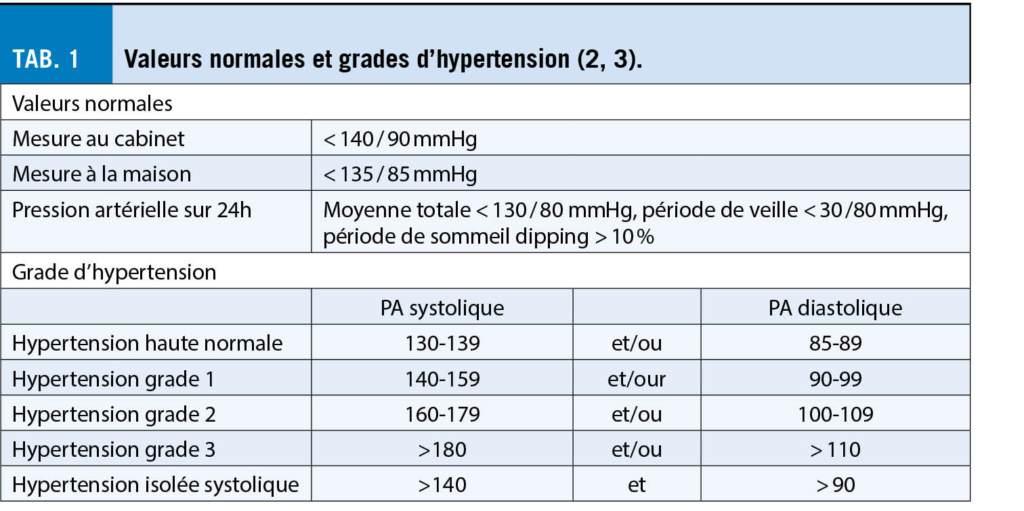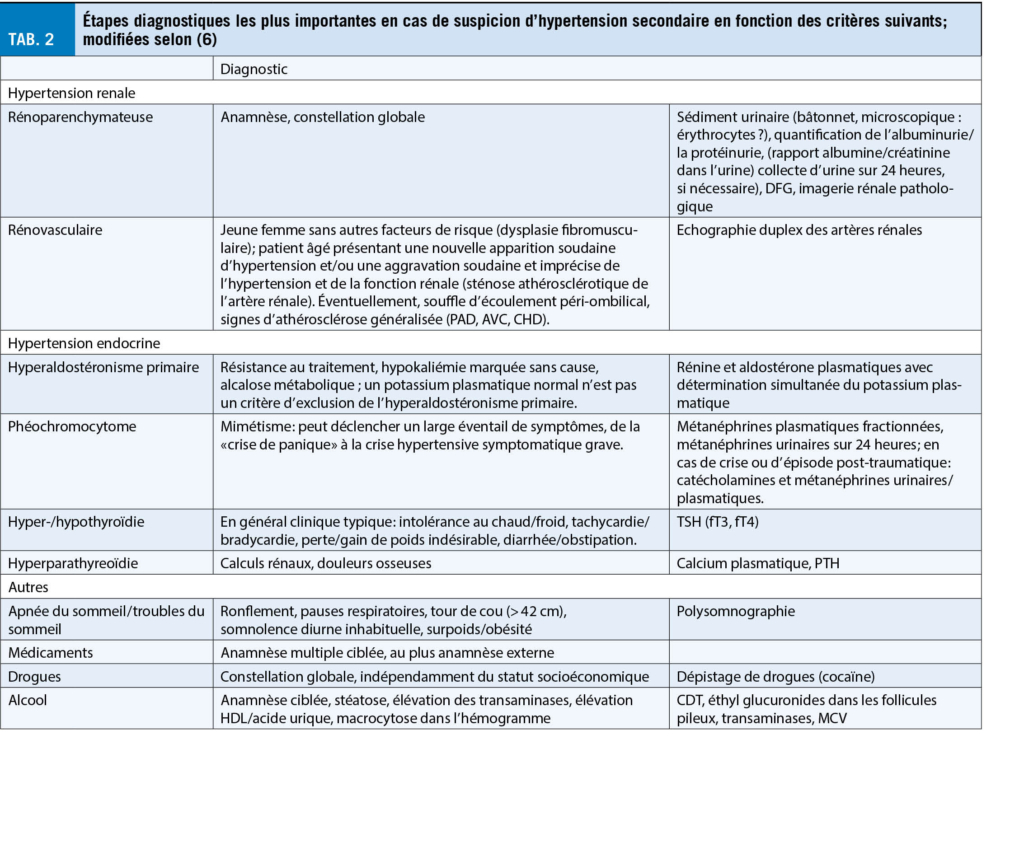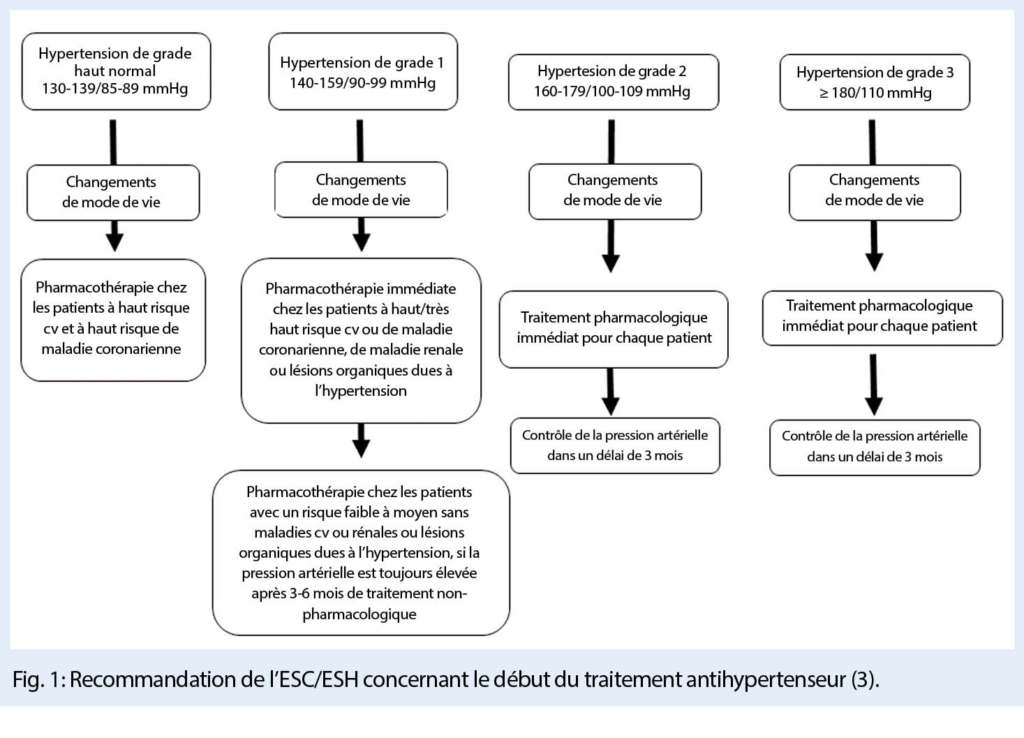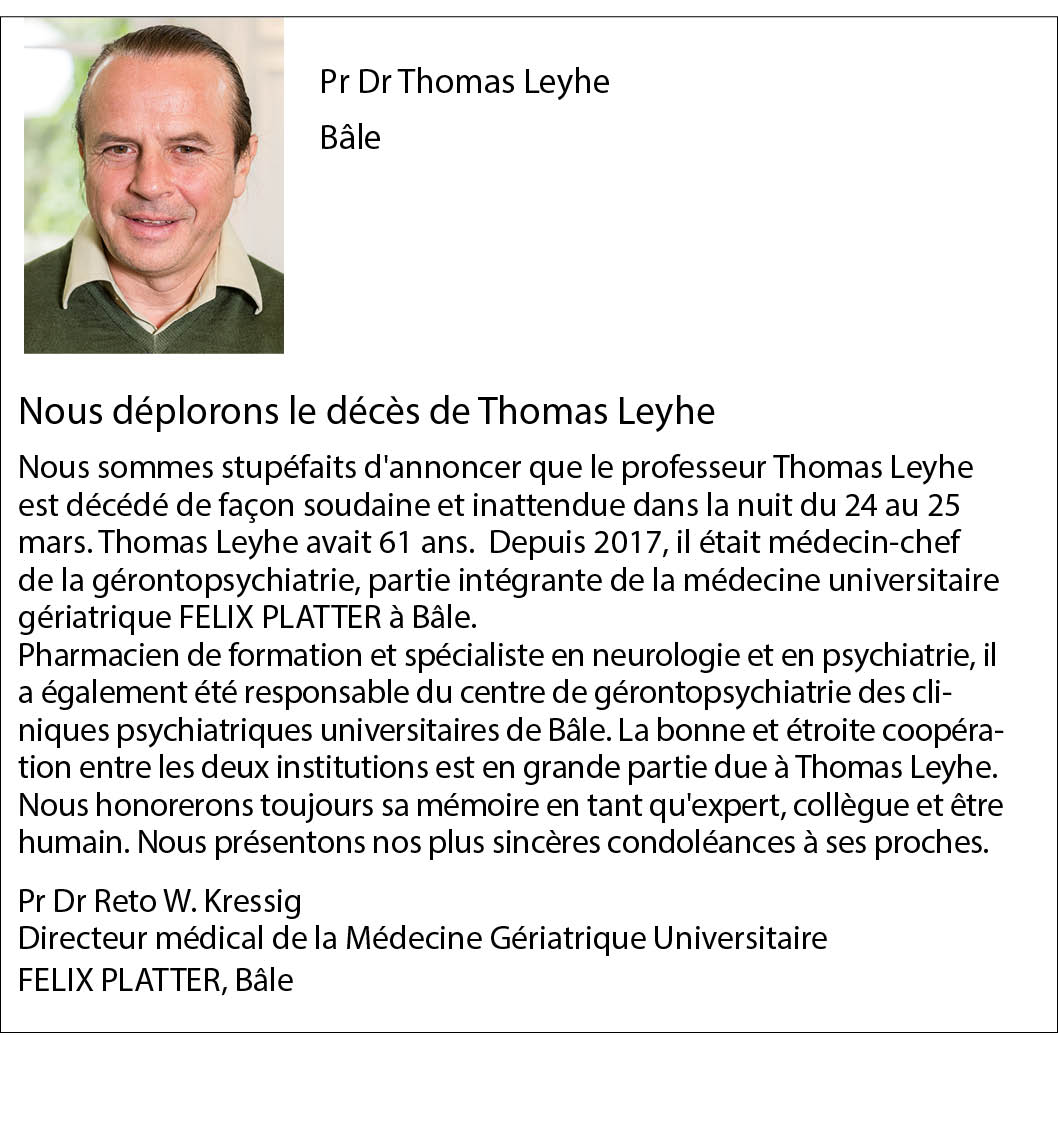Eine kürzlich publizierte Cochrane Review (1) verglich verschiedene systemische oral verabreichte oder injizierte Medikamente, die zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen (über 18 Jahre) eingesetzt werden. Das Ziel war es, herauszufinden, welche die sichersten und wirksamsten Mittel zur Behandlung der Psoriasis sind. Es sollte eine Rangfolge der Medikamente nach ihrer Sicherheit und Wirksamkeit aufgestellt werden, um die Entwicklung eines Behandlungskonzepts für Menschen mit chronischer Plaque-Psoriasis zu unterstützen. Insgesamt wurden 140 relevante Studien zur Beantwortung dieser Frage gesammelt und analysiert.
Die wichtigsten Botschaften
Die Ergebnisse zeigen, dass eine Auswahl von Behandlungen aus der Klasse der biologischen Arzneimittel die wirksamsten systemischen Arzneimittel zu sein scheinen, um eine 90%ige Verbesserung des Psoriasis Area and Severity Index (PASI) zu erreichen. Beim Vergleich der bewerteten Behandlungen gegenüber Placebo wurde kein signifikanter Unterschied in Bezug auf schwerwiegende unerwünschte Wirkungen festgestellt. Da die Nachweise bezüglich Sicherheit jedoch von sehr geringer bis mässiger Qualität waren, sind diese Ergebnisse nicht sicher.
Für einige der Interventionen wurde nur eine geringe Anzahl von Studien gefunden, so dass weitere Untersuchungen durchgeführt werden müssen, um die systemischen Arzneimittel direkt miteinander zu vergleichen, anstatt sie Placebo gegenüber zu stellen. Ausserdem sind längerfristige Studien erforderlich, um mehr Erkenntnisse über den Nutzen und die Sicherheit systemischer Arzneimittel zu gewinnen und ihre Sicherheitsprofile zu vergleichen. Die Ergebnisse dieser Übersichtsarbeit beschränken sich auf die Induktionsbehandlung, das heisst, die Ergebnisse wurden 8 bis 24 Wochen nach der Zuweisung der Teilnehmer zu ihrer Behandlungsgruppe gemessen, und es lagen nicht genügend Informationen vor, um den relativen Nutzen der Behandlungen für die längerfristigen Ergebnisse bei dieser chronischen Krankheit zu verstehen.
Die Autoren stuften Sicherheit der Evidenz von sehr gering (hauptsächlich konventionelle Arzneimittel) bis hoch (hauptsächlich biologische Arzneimittel) ein. Die Beweissicherheit wurde aufgrund des Risikos eines Bias hinsichtlich der Studienmethoden und zudem entweder wegen inkonsistenter Ergebnisse oder Ungenauigkeit herabgestuft.
Was wurde bei der Überprüfung untersucht?
Die Psoriasis ist gekennzeichnet durch rote, schuppige Hautstellen, sogenannte Plaques, oder durch andere entzündliche Erscheinungen, die auf der Haut und an den Gelenken oder beidem auftreten können. Psoriasis wird durch eine abnorme Reaktion des Immunsystems bei Menschen verursacht, die eine genetische Veranlagung für die Krankheit haben.
Etwa 2% der Bevölkerung leiden an Psoriasis, und 90 % dieser Menschen haben Plaque-Psoriasis. Bei etwa 10% bis 20% der Menschen mit chronischer Plaque-Psoriasis ist eine systemische Behandlung erforderlich. Die Psoriasis beeinträchtigt die Lebensqualität, einschliesslich des psychosozialen Lebens der Betroffenen.
In dieser Cochrane Review wurden 19 systemische Medikamente verglichen. Dabei wurden Studien identifiziert, die eines oder mehrere dieser Medikamente entweder mit Placebo oder mit einem anderen Arzneimittel zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Formen von Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen verglichen, die sich in einem beliebigen Behandlungsstadium befanden. Die untersuchten Behandlungen umfassten eine Gruppe von konventionellen systemischen Behandlungen, die zu den ältesten Behandlungen gegen Psoriasis gehören, eine Gruppe von immunmodulierenden Biologika, die aus lebenden Organismen oder synthetisch hergestellt wurden, und eine Gruppe kleiner Moleküle, die auf Moleküle innerhalb von Immunzellen einwirken. Es wurden Studien eingeschlossen, deren Teilnehmer möglicherweise auch an Psoriasis-Arthritis litten. Die wichtigsten Ergebnisse, die interessierten, waren das Erreichen eines PASI-Wertes von 90 und alle schwerwiegenden Nebenwirkungen, die mit den Arzneimitteln in Verbindung gebracht wurden.
Um die Behandlungen miteinander vergleichen zu können, wurden sämtliche Studien zusammengefasst und so eine indirekte Analyse der Behandlungen im Rahmen dieser Netzwerk-Meta-Analyse ermöglicht.
Wichtigste Ergebnisse der Untersuchung
An den 140 Studien nahmen 51749 Personen (hauptsächlich aus Krankenhäusern rekrutiert) mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis teil: 34 624 Männer und 16 529 Frauen (die restlichen 596 Teilnehmer sind unbekannt); das Durchschnittsalter lag bei 45 Jahren, der durchschnittliche PASI-Wert zu Beginn der Studie betrug 20 (Spanne: 9,5 bis 39), was auf einen hohen Schweregrad der Erkrankung hindeutet. In den meisten Studien (n = 82) wurde das systemische Medikament mit einer Placebo-Behandlung verglichen, in 41 Studien wurden systemische Behandlungen mit anderen systemischen Behandlungen verglichen und in 17 Studien wurden systemische Behandlungen mit systemischen Behandlungen und Placebo verglichen. Die meisten Studien waren Kurzzeitstudien; 117 Studien waren multizentrische Studien (2 bis 231 Zentren). Die meisten Studien (107/140) gaben eine Finanzierung durch pharmazeutische Unternehmen an, 22 Studien machten keine Angaben zur Finanzierungsquelle.
Die vorgestellten Ergebnisse Netzwerk-Metaanalyse wurden während der Induktionsphase, 8 bis 24 Wochen nach der Randomisierung der Studienteilnehmer, gemessen. Bei den Biologika-Behandlungen wurden die Gruppen Anti-IL17, Anti-IL12/23, Anti-IL23 und Anti-TNF-alpha bewertet.
Die Ergebnisse zeigten, dass im Vergleich zu Placebo alle Behandlungen – sowohl Biologika-Behandlungen als auch niedermolekulare Behandlungen und konventionelle systemische Wirkstoffe zum Therapieren der Psoriasis signifikant wirksamer waren, wenn sie anhand eines Index bewertet wurden, der eine Verbesserung um 90% erforderte (PASI 90).
In Bezug auf dasselbe Ergebnis (PASI 90) schienen die biologischen Behandlungen Anti-IL17, Anti-IL12/23, Anti-IL23 und Anti-TNF-alpha signifikant besser zu wirken als die niedermolekularen und die konventionellen systemischen Wirkstoffe.
Bei der Bewertung der Fähigkeit, einen PASI-Wert von 90 zu erreichen, waren Infliximab, alle Anti-IL17-Medikamente (Ixekizumab, Secukinumab, Bimekizumab und Brodalumab) und die Anti-IL23-Medikamente (Risankizumab und Guselkumab, aber nicht Tildrakizumab) signifikant wirksamer als Ustekinumab und drei Anti-TNF-alpha-Wirkstoffe: Adalimumab, Certolizumab und Etanercept. Adalimumab und Ustekinumab waren Certolizumab und Etanercept überlegen. Zwischen Tofacitinib oder Apremilast und zwei konventionellen Medikamenten, Ciclosporin und Methotrexat, wurde kein signifikanter Unterschied festgestellt.
Im Vergleich zu Placebo schnitten sieben Biologika am besten ab, wenn es darum ging, Psoriasis-Läsionen zur Abheilung zu bringen (d.h. PASI 90 zu erreichen). Bei diesen Arzneimitteln handelte es sich um Infliximab, Ixekizumab (beide mit mässiger Sicherheit), Risankizumab (mit hoher Sicherheit), Bimekizumab (mit geringer Sicherheit), Guselkumab (mit mässiger Sicherheit), Secukinumab (mit hoher Sicherheit) und Brodalumab (mit mässiger Sicherheit). Es gab kaum Unterschiede in der Wirksamkeit dieser sieben Medikamente.
Für die Ergebnisse PASI 75 und Physician Global Assessment (PGA) 0/1 (d.h. Erreichen einer 75-prozentigen Verbesserung und Erreichen eines PGA-Scores von 0 oder 1) waren die Resultate den Ergebnissen für PASI 90 sehr ähnlich.
Bei den Ergebnissen für einige Biologika (z.B. Bimekizumab), kleine Moleküle (Tyrosinkinase-2-Hemmer) und konventionelle systemische Behandlungen (Acitretin, Ciclosporin, Fumarsäureester und Methotrexat) ist Vorsicht geboten, da diese Medikamente nur in wenigen Studien im Rahmen der NMA bewertet wurden, so die Autoren.
Hinsichtlich des Risikos schwerwiegender Nebenwirkungen gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den systemischen Arzneimitteln im Vergleich zur Placebo-Behandlung. Allerdings war die Zahl der schwerwiegenden Nebenwirkungen sehr gering, und die Einstufungen beruhen auf Belegen mit geringer bis sehr geringer (für knapp die Hälfte der Ergebnisse) oder mässiger Sicherheit, so dass sie mit Vorsicht zu interpretieren sind.
Für alle Studien wurden nur wenige Informationen zur Lebensqualität erfasst und für mehrere der untersuchten Arzneimittel lagen keine Daten zur Lebensqualität vor.
Quelle: Cochrane Skin Group, Emilie Sbidian et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan; 2020(1): CD011535. Published online 2020 Jan 9. doi: 10.1002/14651858.CD011535.pub3
riesen@medinfo-verlag.ch
1. Emilie Sbidian et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan; 2020(1): CD011535. Publiziert online 2020 Jan 9. doi: 10.1002/14651858.CD011535.pub3