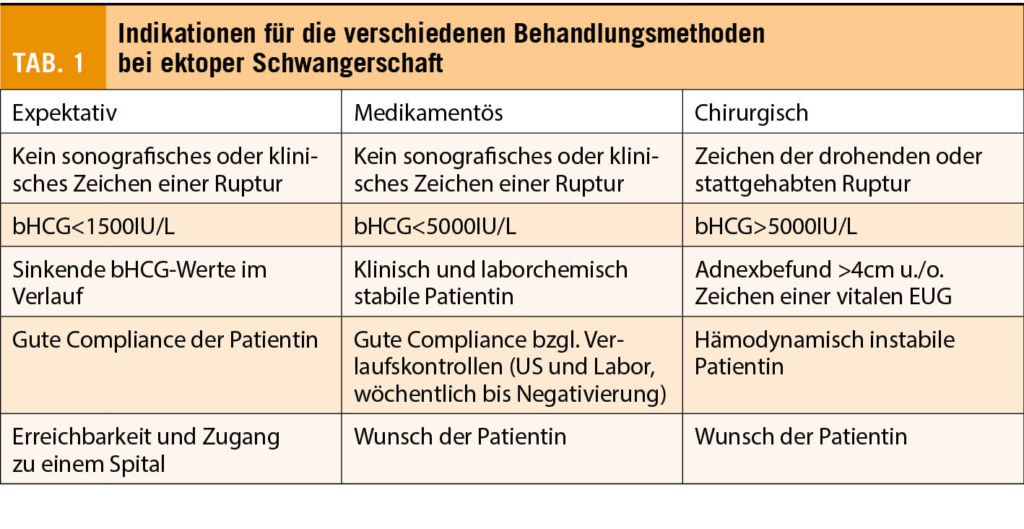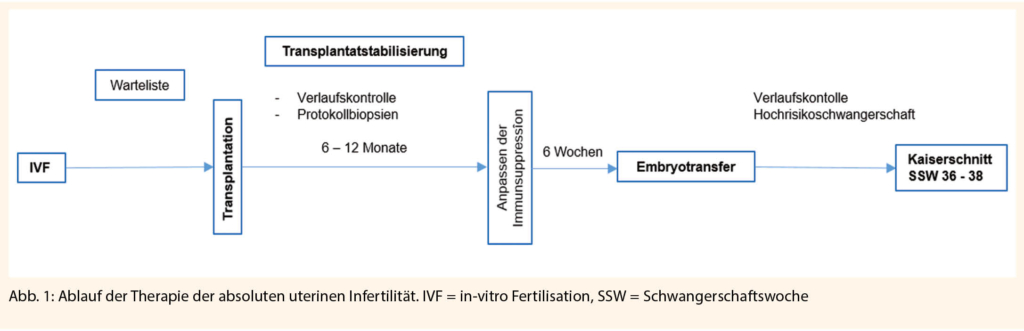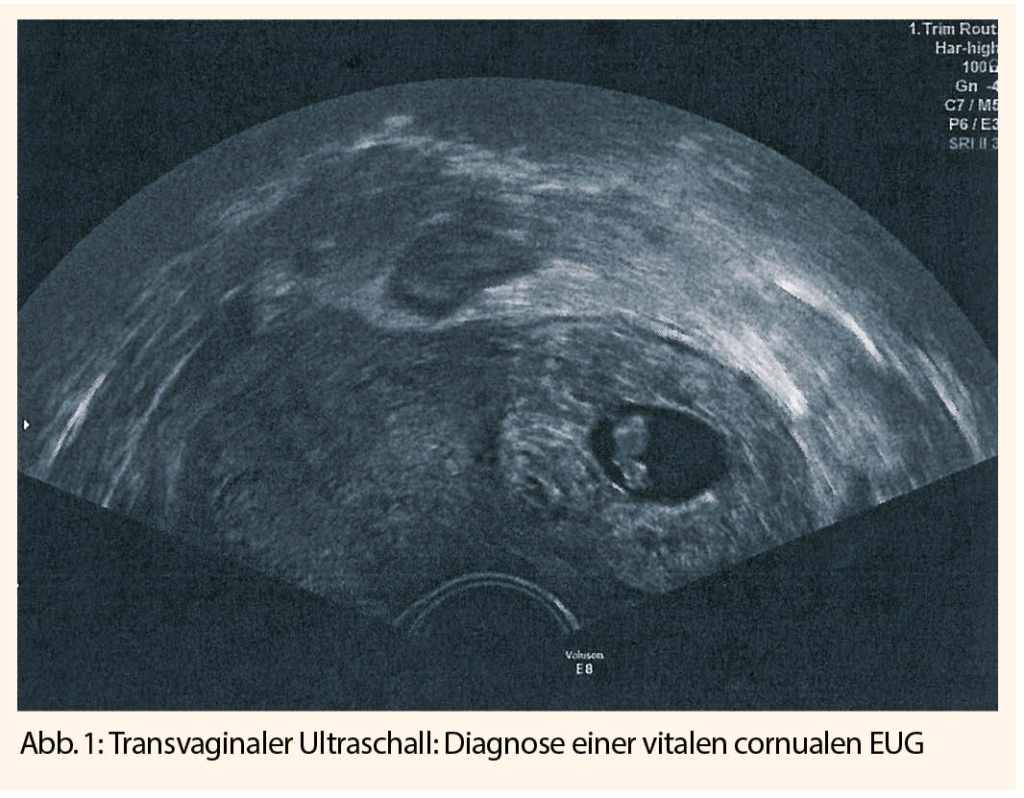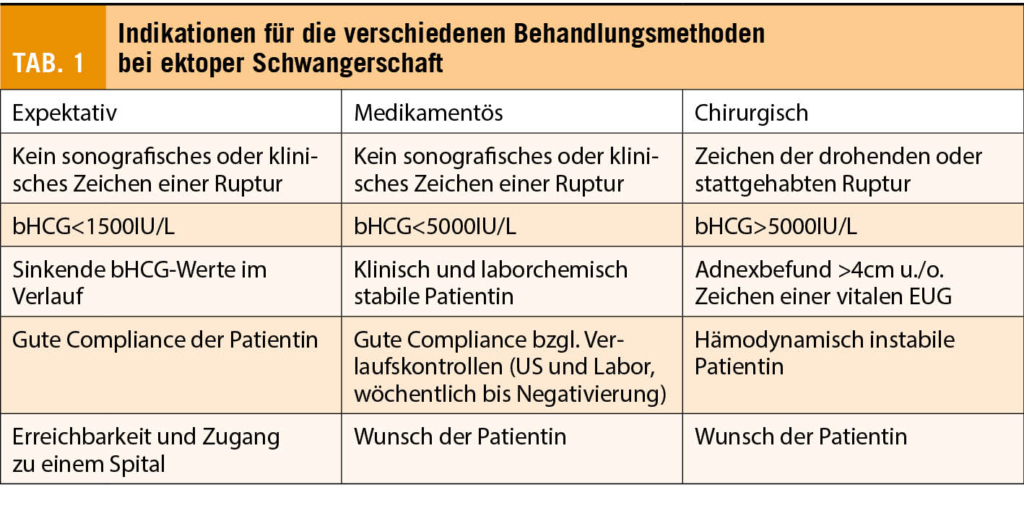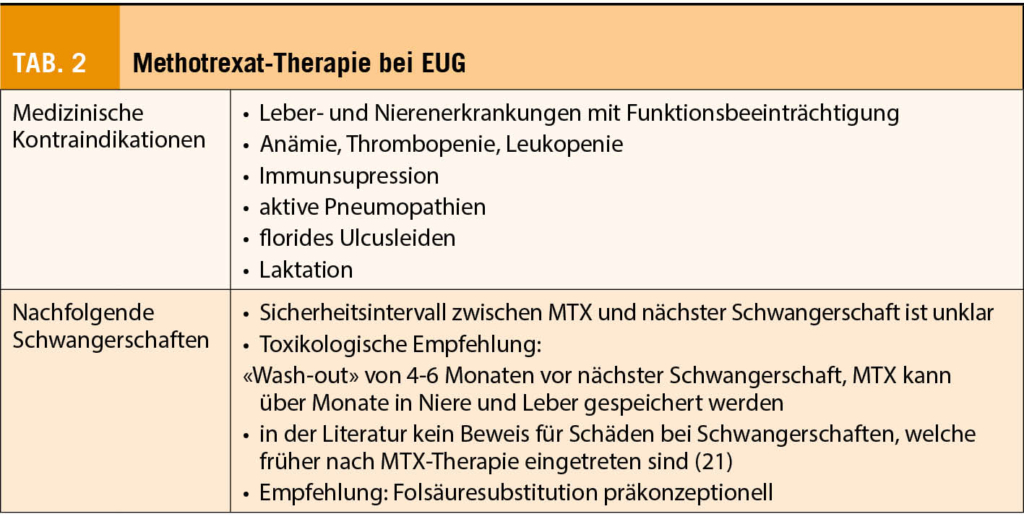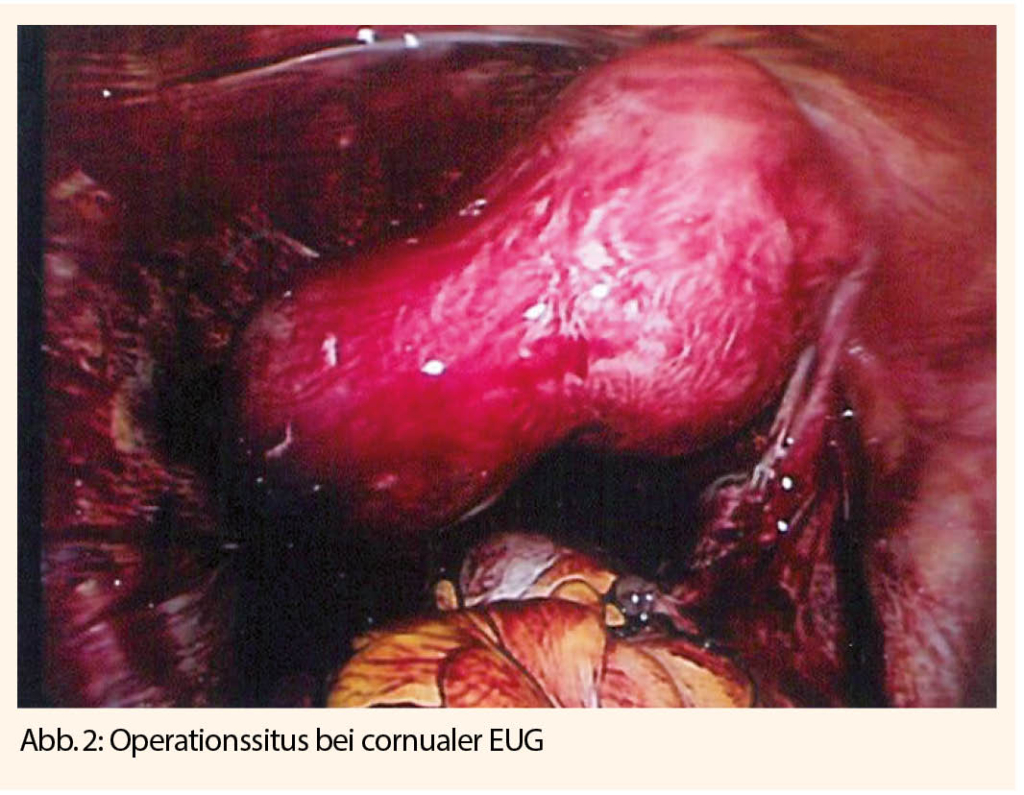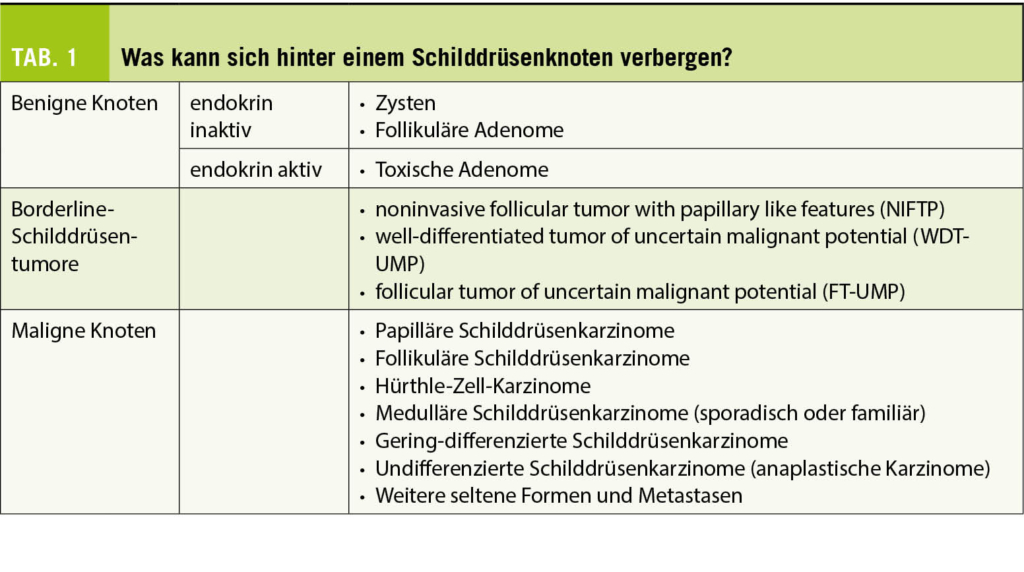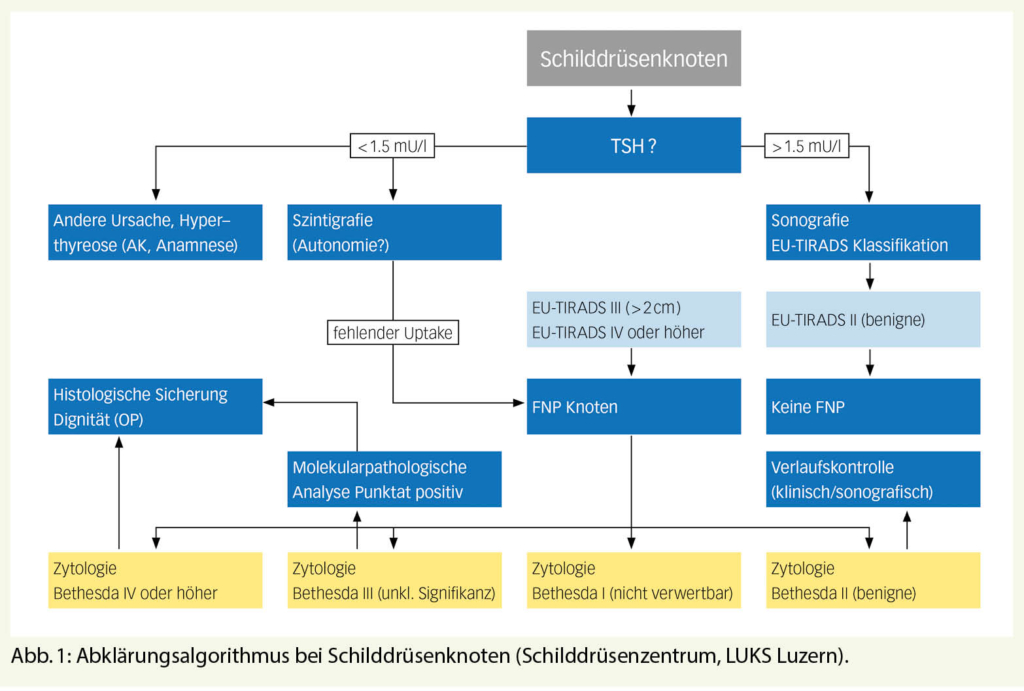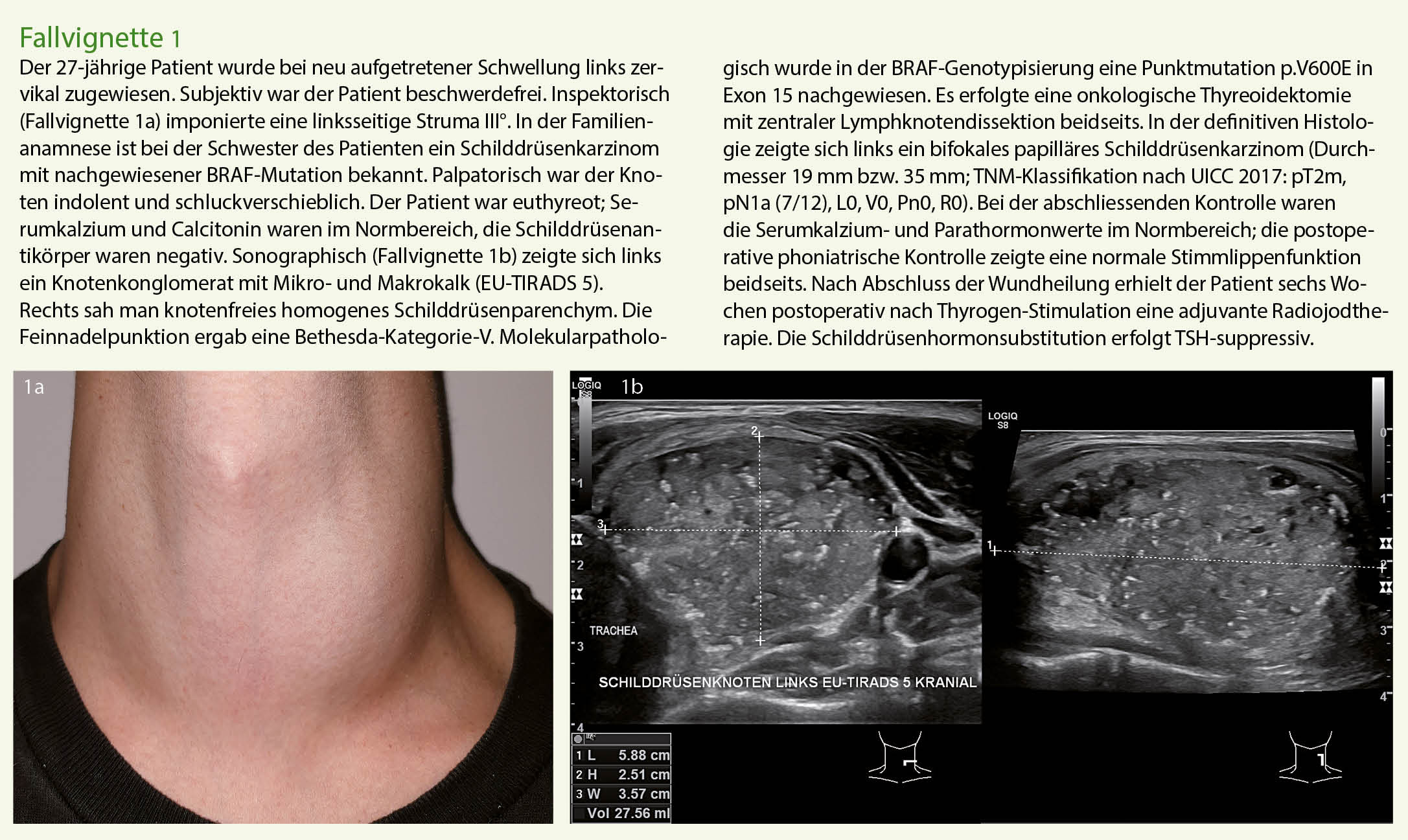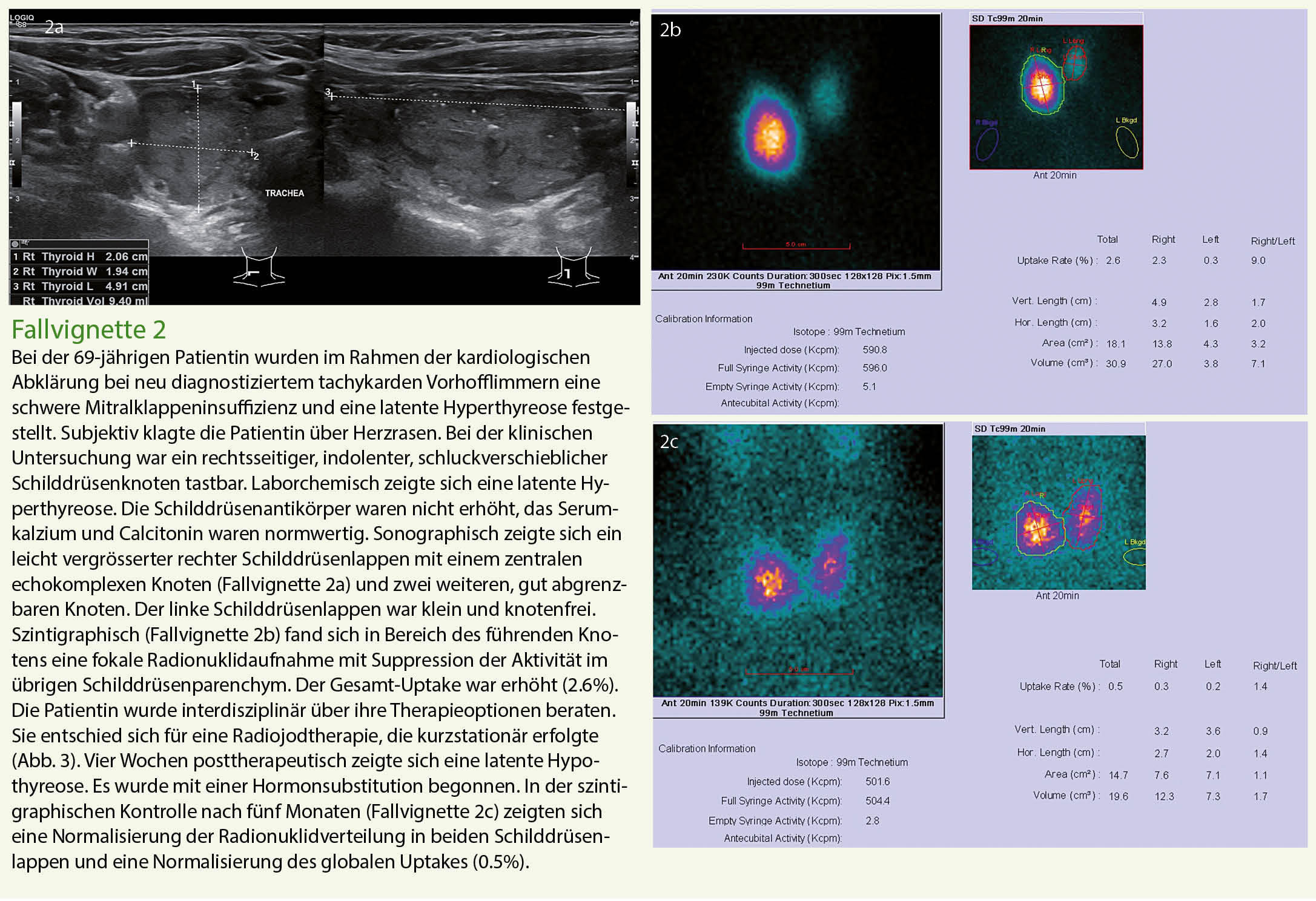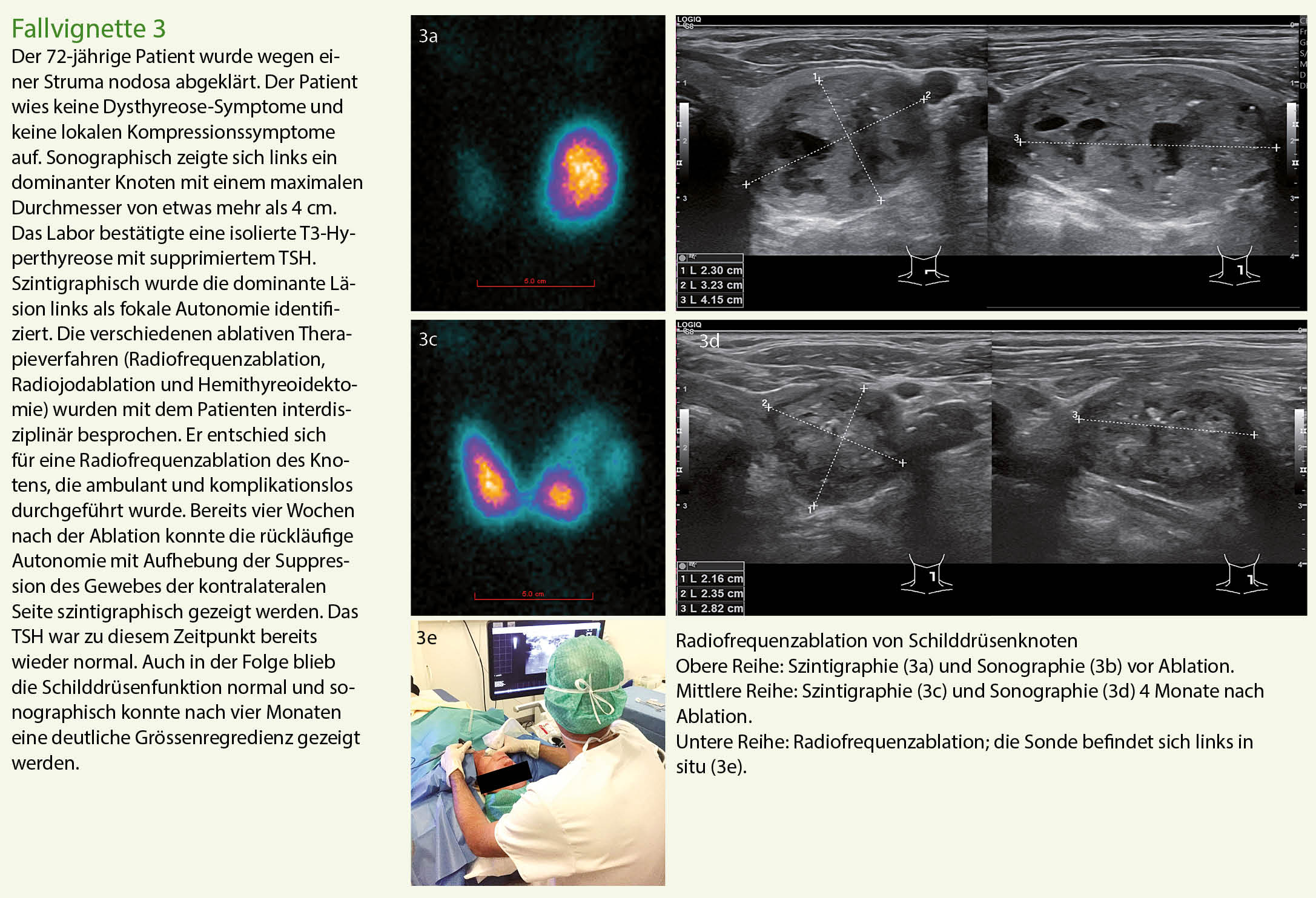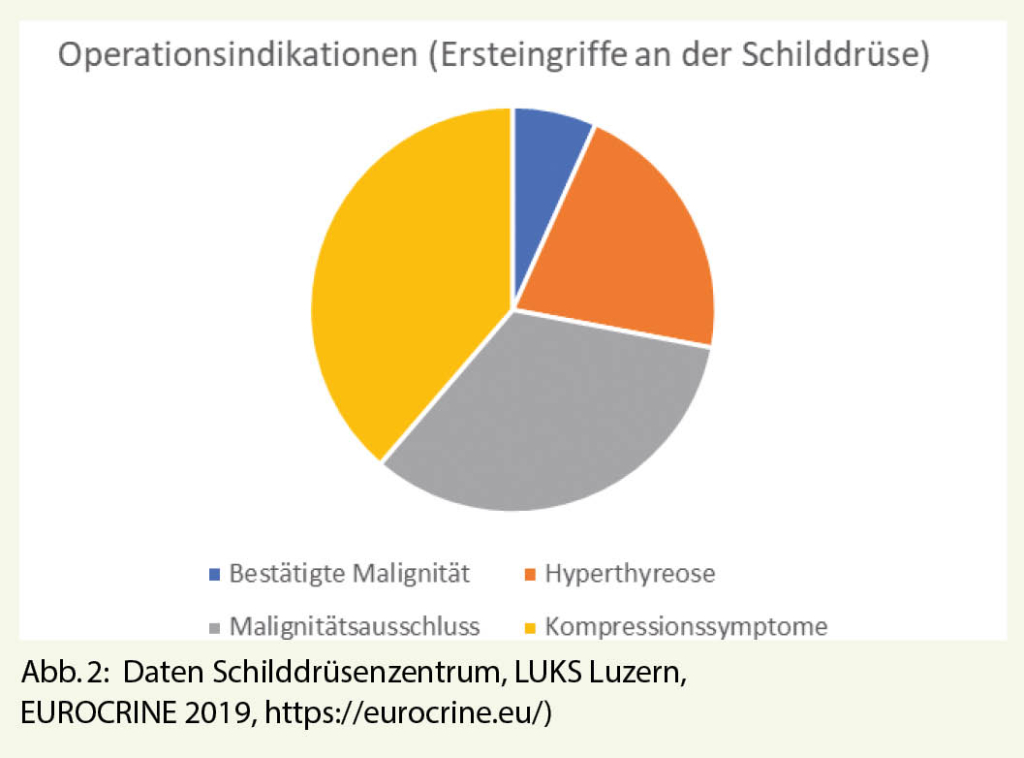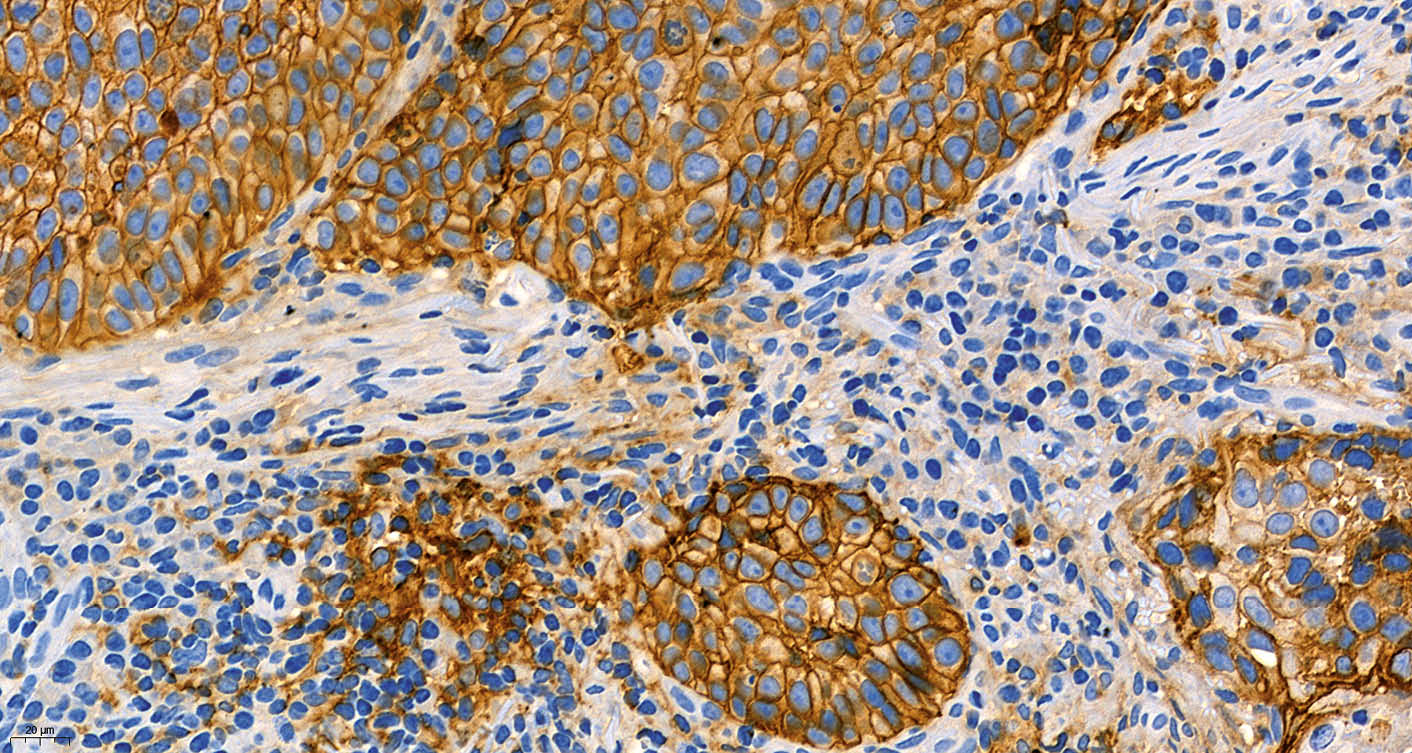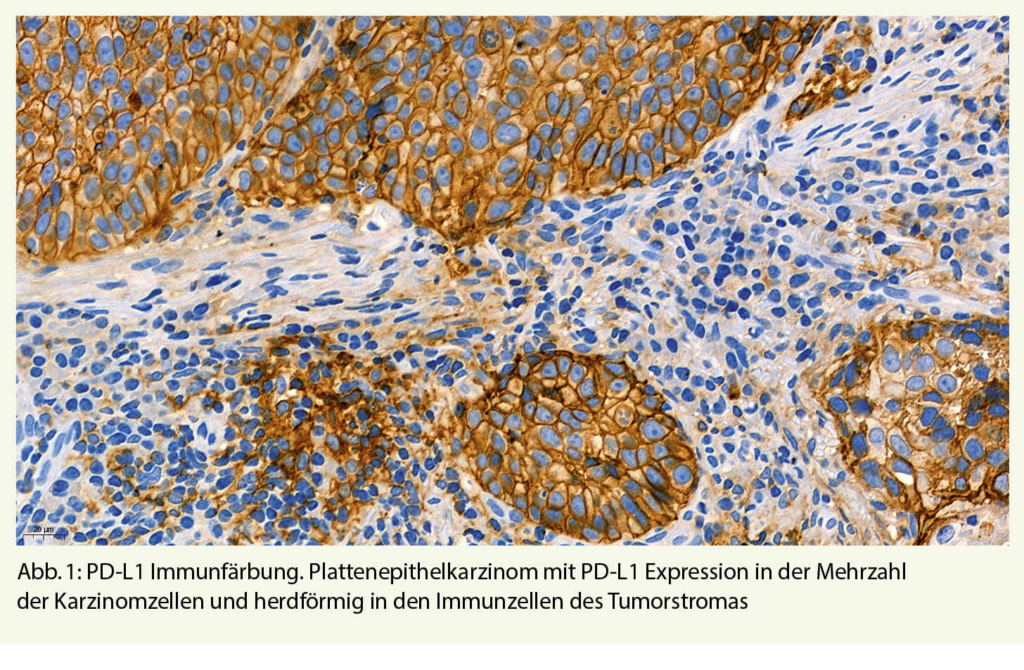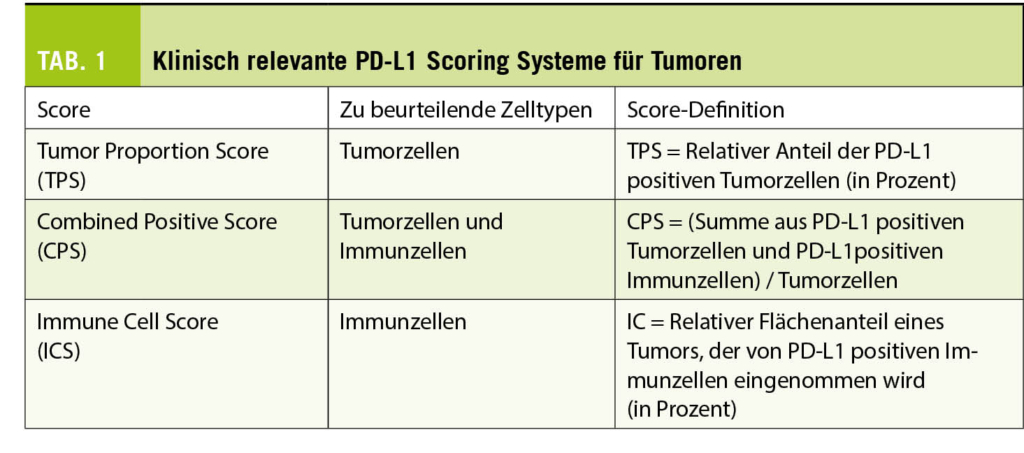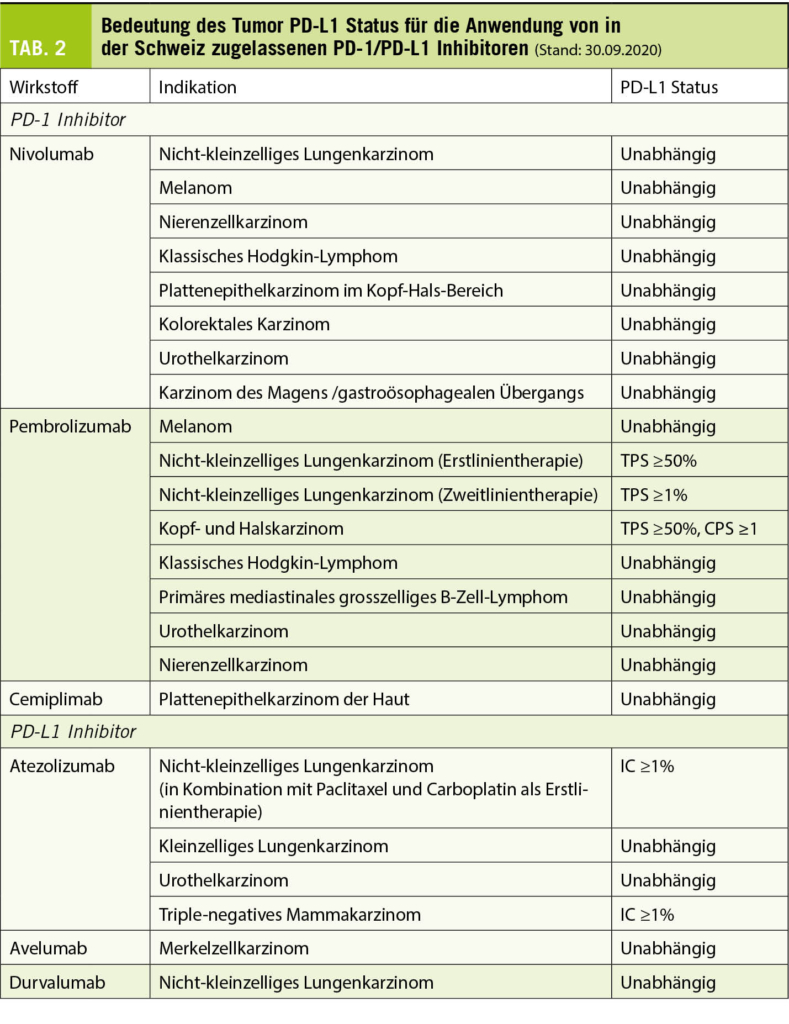Der häufige und verständliche Wunsch der Patientinnen nach einer abgeschlossenen Primärtherapie ist der, eine intensive Nachsorge zu haben um möglichst früh einen Rückfall zu erkennen und damit die Prognose zu verbessern. Obwohl dieser Wunsch schwierig zu erfüllen ist, gibt es gute andere Gründe für eine (gewisse) Nachsorge. Der Artikel gibt einen kurzen Überblick über die empfohlene Nachsorge beim Mammakarzinom.
Erfassen von Rückfällen
In verschiedensten Studien wurde versucht nachzuweisen, dass eine intensive Metastasensuche in der Nachsorge die Prognose oder die Lebensqualität verbessern kann. Leider konnte beides nicht nachgewiesen werden, auch nicht mit modernen Untersuchungsmethoden wie PET-CT (1, 2, 3). Durch ein früheres Auffinden von Metastasen zeigt sich ein so genannter «lead-time bias», d.h. die Patientinnen leben insgesamt im Anschluss nicht länger, sondern sind nur «länger krank». Was aber nachgewiesen werden konnte, mit einer intensiveren Nachsorge wird es deutlich teurer (4, 5). Ein anderer Vorteil könnte die stärkere Beruhigung der Patientinnen sein durch eine regelmässige und intensive Nachsorge. Aber auch hier zeigten verschiedene Studien, dass durch die häufigen, falsch-positiven Befunde, die dann weiter abgeklärt werden müssen, die Verunsicherung der Patientinnen steigt – ebenso wie deren Ängstlichkeit (6).
Laborchemische Tests wie z.B. Tumormarker sind nicht geeignet um Frührezidive zu erkennen und sollten ebenfalls nicht gemacht werden in der Nachsorge. Alle internationalen Guidelines wie zum Beispiel der ASCO oder ESMO empfehlen keine radiologischen, bildgebenden Untersuchungen zur Fernmetastasen-Suche ebenso wie keine laborchemischen Untersuchungen (7, 8). Hingegen soll bei Auftreten von neuen Symptomen niedrigschwellig weiter abgeklärt werden.
Im Gegensatz zur Fernmetastasen-Suche ist eine loko-regionäre Nachsorge zur Erkennung von Lokalrezidiven und Zweittumoren indiziert. In allen Guidelines wird empfohlen, dies einmal jährlich zu machen (6, 7, 8). Nach ca. 10 Jahren sollte dann aber die Frequenz individuell anhand des Alters und des Risikoprofils bestimmt werden, ob auf eine reine Vorsorge, zum Beispiel alle 2 Jahre, gewechselt werden kann. Notwendig wäre natürlich eine individualisierte und mehr risikoadaptierte Nachsorge, dafür gibt es bisher aber leider keine guten Untersuchungen. Die beste radiologische Methode für die Nachsorge sollte postoperativ individuell mit den Radiologen festgelegt werden. Nach einer brusterhaltenden Operation steht eine ipsi- und kontralaterale Mammografie im Vordergrund (eine alleinige Sonographie kann diese nicht ersetzen, sie ist komplementär), nach Rekonstruktionen bei Mastektomie eher die MR-Mammographie und/oder die Sonographie. Bei sehr hohem lokalem Rückfallrisiko kann zwischen den radiologischen Bildgebungen eine zusätzliche Sonographie sinnvoll sein.
Nebenwirkungen und Compliance (6)
Bei Frauen unter endokriner Therapie sollten Nebenwirkungen erfasst und behandelt werden, dies erhöht die Compliance wesentlich. Zu Beginn ist sicherlich auch eine Laborkontrolle unter endokriner Therapie einiger Routinewerte sinnvoll, wie zum Beispiel Leberwerte. Auch die Knochengesundheit muss beachtet werden, regelmässige Knochendichtemessungen und Erhebung des Vitamin D3- Wertes werden allseits empfohlen. Nach einem Ausgangsbefund der Osteodensitometrie wird eine 2-jährliche Kontrolle unter Aromatasehemmer-Therapie und/oder ovarieller Suppression empfohlen, je nach Befunden Einsatz von Bisphosphonaten oder Denosumab. In diese Nachsorge gehört auch das Lymphödem-Management, sowie das Erfassen und die Behandlung von Langzeit-Nebenwirkungen, z.B. von der adjuvanten Chemotherapie.
Bezüglich der Frequenz der klinischen Kontrollen wird in den meisten Guidelines empfohlen, in den ersten 2 Jahren 3-4-monatliche klinische Kontrollen durchzuführen, dann halbjährlich bis 5 Jahre und dann jährlich (7, 8). Hierfür gibt es keine klare Evidenz, ist sicherlich auch stark abhängig von individuellen Bedürfnissen und Problemen der Patientin und weiteren Faktoren wie Alter, Weg, Risikokonstellation etc.
Lifestyle und Survivorship
Die Diagnose Mammakarzinom ist ein einschneidendes Ereignis und hat oft vielerlei weitere psychosoziale Auswirkungen. Die psychologische Unterstützung in der Nachsorge ist dabei ein sehr wichtiger Faktor. Die meisten Frauen benötigen längerfristig keine psychologische Fachbetreuung, aber vom nachbetreuenden Arzt/Ärztin in regelmässigen Abständen die meist gute Prognose bestätigt zu bekommen, ist oft sehr hilfreich. Auch die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ist absolut zentral, wird teilweise auch von den Hausärzten übernommen, aber oft fehlt da der enge Kontakt. Dann gibt es viele weitere Aspekte, wie Behandlung von Ernährungsfragen, Anregung zu regelmässiger körperlicher Aktivität, Verhinderung oder Behandlung von Adipositas und vieles mehr. Für viele dieser wichtigen Faktoren ist das regelmässige Gespräch im Rahmen einer Nachsorge sehr hilfreich. Wir wundern uns häufig, wie lange diese Konsultationen in der Nachsorge bei weitgehend gesunden Frauen dauern, aber dies zeigt eben gerade, dass hier sehr viele Bedürfnisse und Fragen bei diesen «ehemaligen» Patientinnen und Patienten vorhanden sind. In einer regelmässigen klinischen Nachsorge können viele dieser Bedürfnisse aufgenommen und auch gelöst werden.
Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG
Leiter Medizinische Onkologie
Brustzentrum Ostschweiz
Schuppisstrasse 10
9016 St. Gallen
thomas.ruhstaller@bz-ost.ch
Der Autor hat im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.
1. Pennant et al Health Tech. Assessment 14; 1-103 2010
2. Palli et al. JAMA 281:1586, 1999
3. Moschetti et al. Cochrane Data Syst Rev 2016
4. Kokko et al Br Canc Res. Tr. 93: 255 2005
5. Auguste et al Health Tech. Assessment 15; iii-iv,1-54 2010
6. Hayes et al N Engl J Med 2007;356:2505-13
7. American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology Breast Cancer Survivorship Care Guideline, J Clin Oncol 2016, 611-635
8. ESMO Clinical Practical Guidelines, Annals of Oncology 30: 1194–1220, 2019