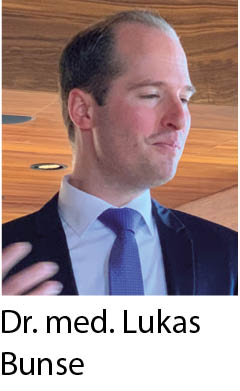Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator (Clinical Project Manager).
Therapie von Patienten mit Knochenmetastasen mit XGEVA® zur Verhinderung von symptomatischen Komplikationen am Skelett mit Denosumab 120 mg, verabreicht alle 4 Wochen gegenüber alle 12 Wochen.
Knochenmetastasen, die Ausbreitung der Krebserkrankung auf den Knochen, sind eine häufige Komplikation bei Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung und werden in der Schweiz bei mehr als 5000 Menschen jährlich neu diagnostiziert. Seit der Marktzulassung im Dezember 2011 wird Denosumab (120 mg; XGEVA®) vermehrt für die Therapie von Patienten mit Knochenmetastasen verwendet.
Das Projekt SAKK 96/12 soll zeigen, dass eine weniger häufige Dosierung des Medikaments mindestens gleich wirksam ist wie die zugelassene Standarddosierung. Das Projekt wurde lanciert, weil Studiendaten nahelegen, die zugelassene Therapie mit XGEVA® hinsichtlich Dosierung, Toxizität und Kosten-Nutzen-Verhältnis zu hinterfragen. Neben der Wirksamkeit werden auch Nebenwirkungen und Lebensqualität genau beobachtet, da angenommen wird, dass eine weniger häufige Verabreichung insgesamt zu weniger Nebenwirkungen und somit auch zu einer besseren Lebensqualität führt.
Da die steigenden Kosten im Gesundheitswesen und die Kosteneffizienz medizinischer Behandlungen zu immer grösseren gesellschaftlichen Herausforderungen führen, besteht ein weiteres Ziel dieses Projektes darin, gesundheitsökonomische Aspekte zu untersuchen. Das Projekt SAKK 96/12 wird in Zusammenarbeit mit den Krankenversicherern durchgeführt.
Diese Studie wird unterstützt von: Stiftung Krebsbekämpfung, santésuisse und Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.
Studiendesign: offene, randomisierte Nicht-Unterlegenheits-Studie der Phase III
(Open-label randomized phase III non-inferiority trial)
Studientitel: SAKK 96/12 / REDUCE: Prevention of symptomatic skeletal events with Denosumab (DN) administered every 4 weeks (q4w) versus every 12 weeks (q12w): a non-inferiority phase III trial.
Teilnehmende Zentren: Hirslandenklinik Aarau, Kantonsspital Aarau, Kantonsspital Baden, Brustzentrum Basel – Praxis Thorn, Basel/Caba Zentrum für Onkologie, Psychologie und Bewegung, Basel/Claraspital, Universitätsspital Basel, Bellinzona/EOC – Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Bern/Inselspital, Bern/Lindenhofgruppe – Engeriedspital, Spitalzentrum Biel, Hôpital du Valais/Spital Brig, Kantonsspital Graubünden, Chêne-Bougeries/Clinique des Grangettes, Spital Thurgau – Kantonsspital Frauenfeld, Hôpital Fribourgeois – Hôpital Cantonal, Clinique de Genolier, Hôpitaux Universitaires de Genève, Lausanne/CCAC – Centre de Chimiothérapie Anti-Cancéreuse, CHUV – Centre hospitalier universitaire vaudois, Kantonsspital Baselland Liestal, Locarno/Fondazione Oncologia Lago Maggiore, Lugano/Oncologia Varini&Calderoni, Luzern/Hirslandenklinik St. Anna, Luzerner Kantonsspital, Spital Männedorf, Spital Thurgau – Kantonsspital Münsterlingen, Network – Hôpital Neuchâtelois, Kantonsspital Olten – Solothurner Spitäler, Sargans/Rundum Onkologie am Bahnhofpark, Hôpital du Valais/Hôpital de Sion, Bürgerspital Solothurn – Solothurner Spitäler, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen/Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, Spital STS AG Thun, Kantonsspital Winterthur, Zürich/Brustzentrum (Seefeld), Zürich/Hirslanden Klinik Hirslanden, Zürich/Hirslanden Klinik Im Park, Zürich/Onkologie Bellevue, Zürich/Spital Limmattal, Zürich/Stadtspital Triemli, UniversitätsSpital Zürich, Landeskrankenhaus Feldkirch (AT), Universitätsklinikum Düsseldorf (DE), UKSH/Universitätsklinikum Schleswig Holstein Lübeck (DE), Universitätsklinikum Ulm (DE).
Coordinating Investigator:
Prof. Dr. med. Roger von Moos,
Kantonsspital Graubünden,
roger.vonmoos@ksgr.ch
Clinical Project Managers:
Corinne Schär, SAKK CC Bern, corinne.schaer@sakk.ch
Priska Stocker, SAKK CC Bern, priska.stocker@sakk.ch
Direktor Tumor- und Forschungszentrum
Kantonsspital Graubünden
7000 Chur
tumorzentrum@ksgr.ch