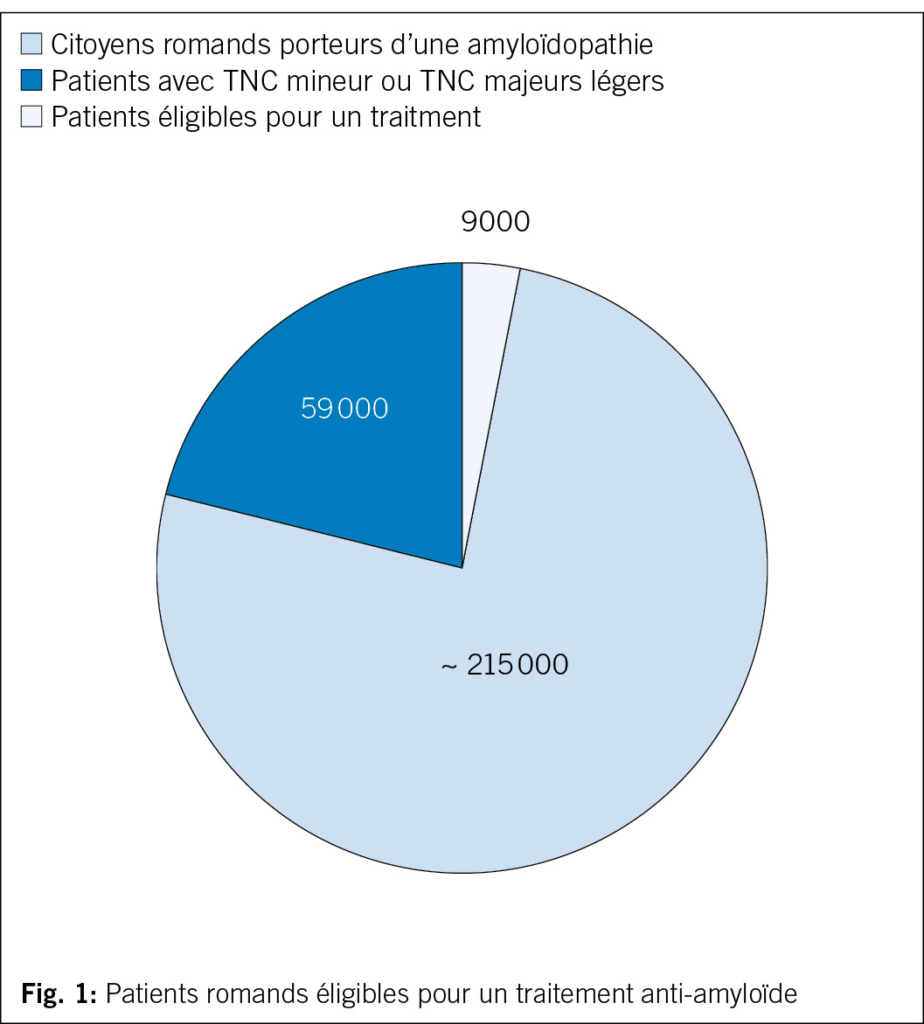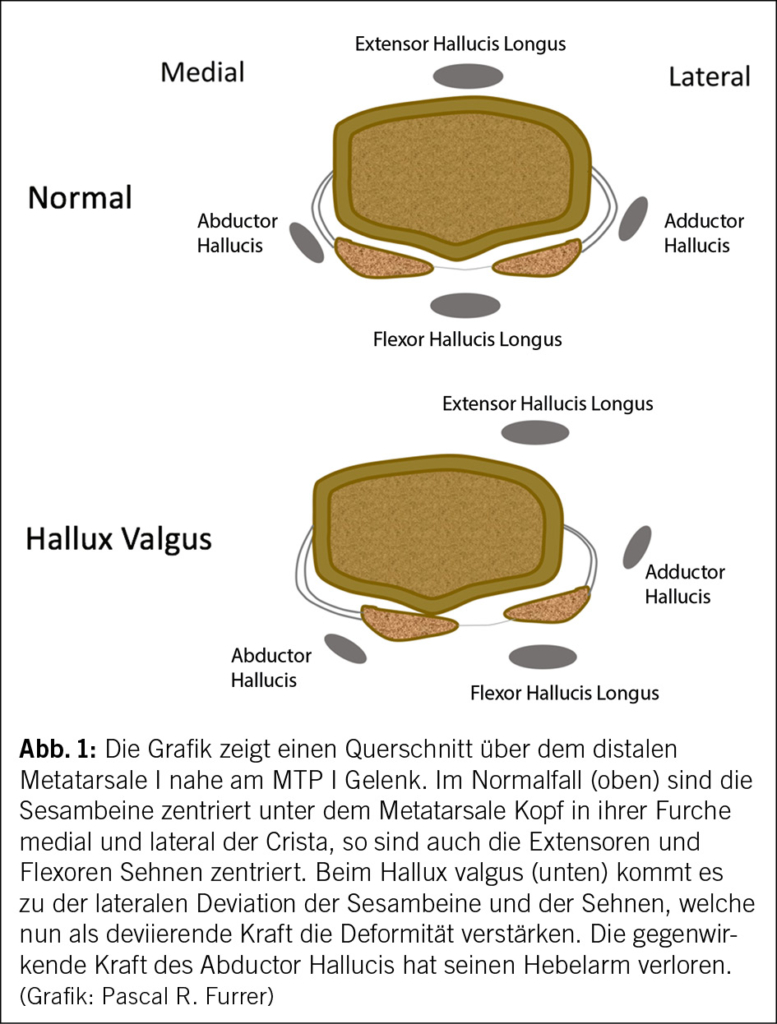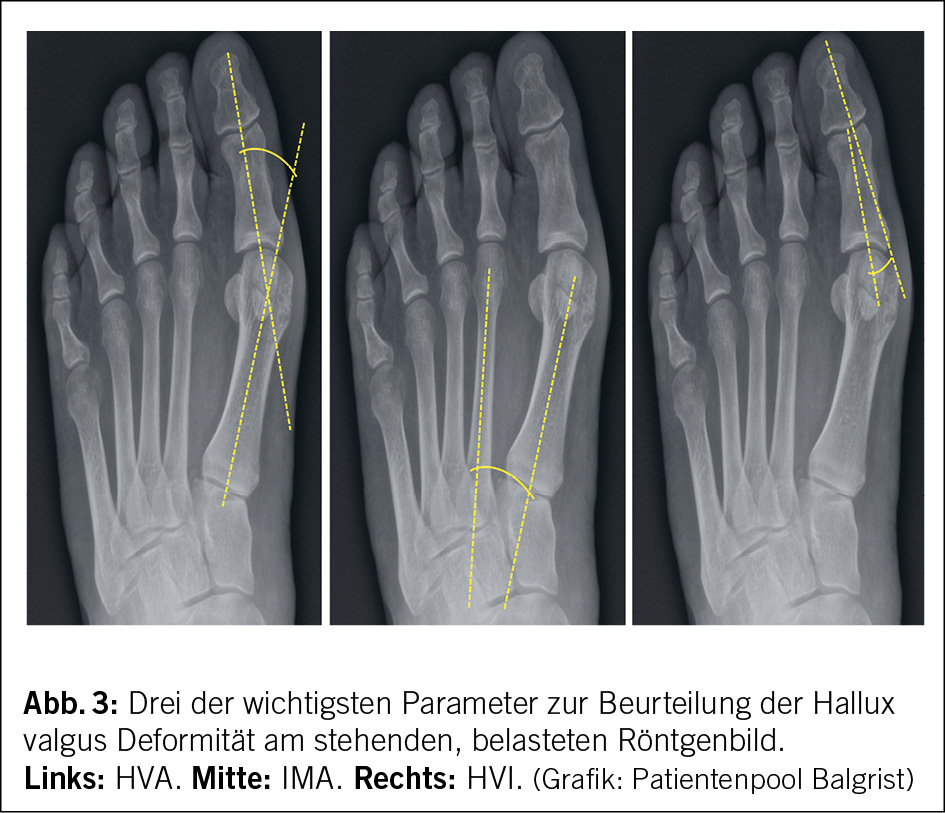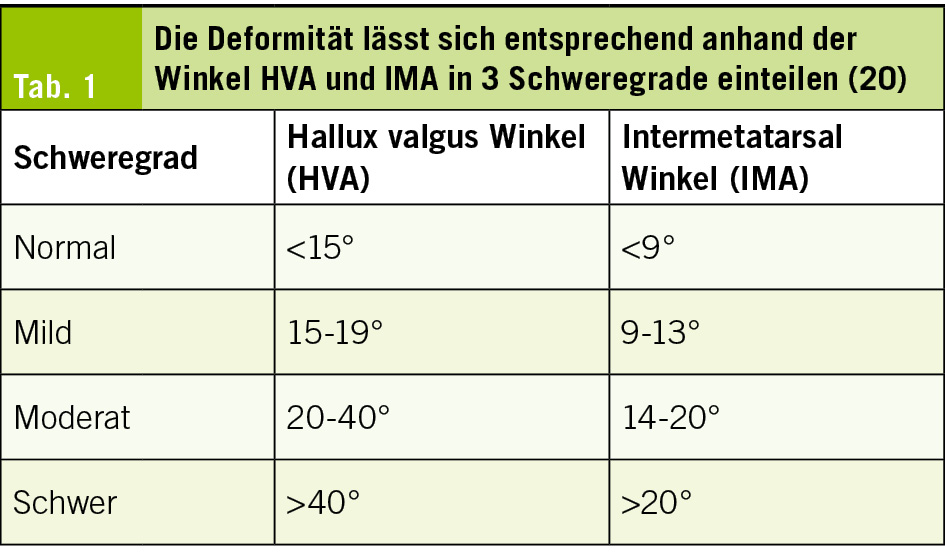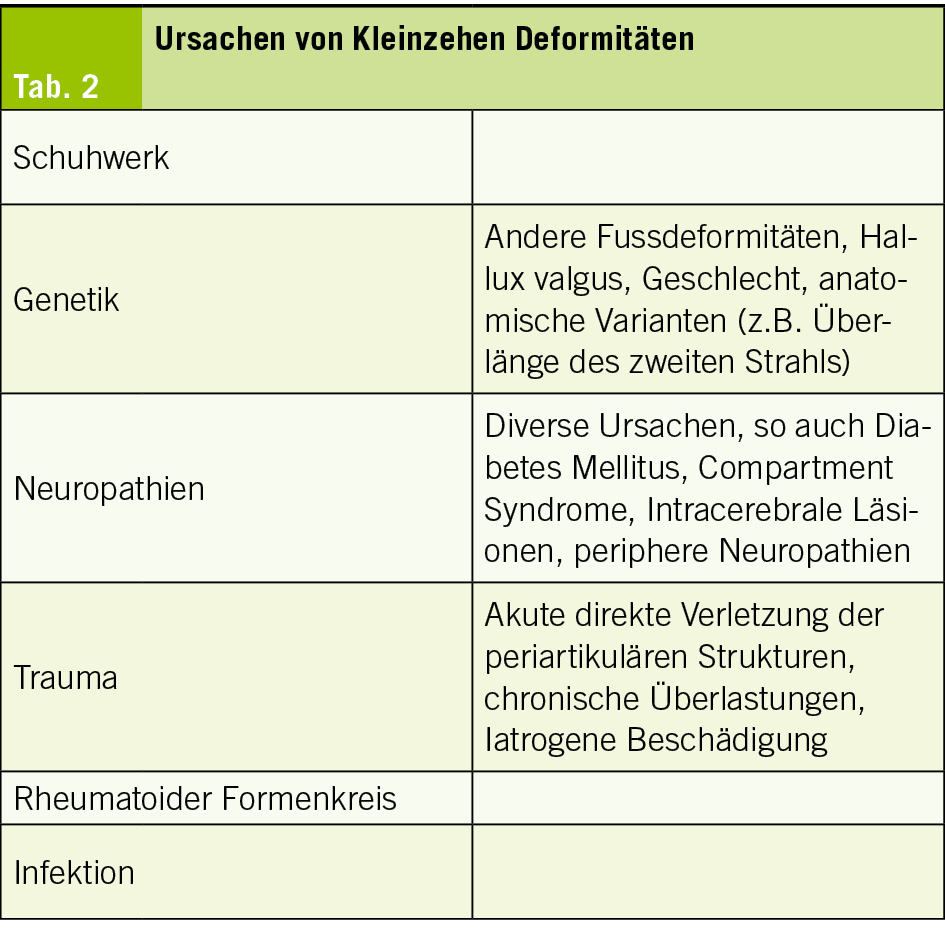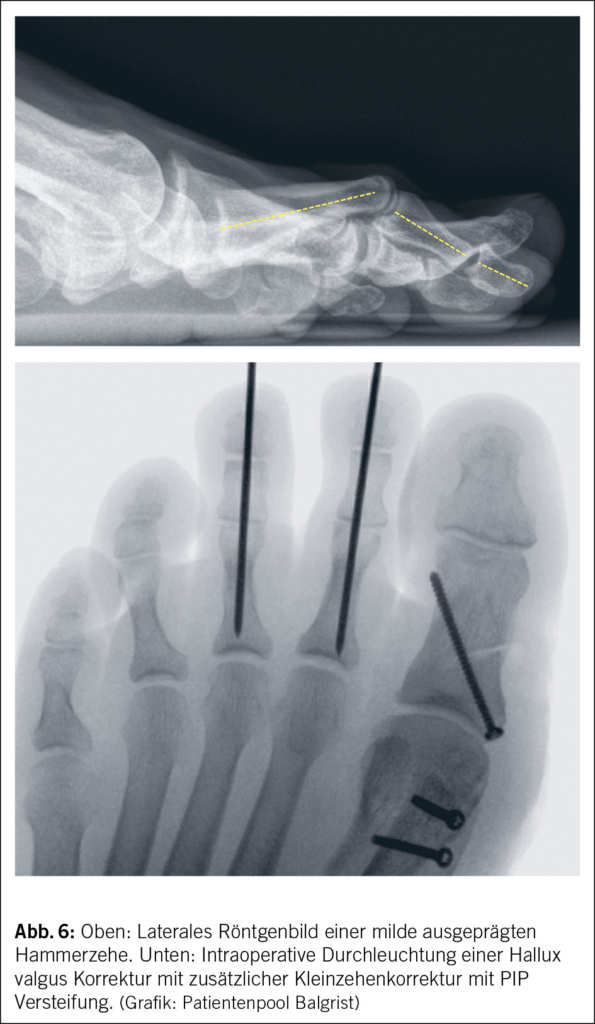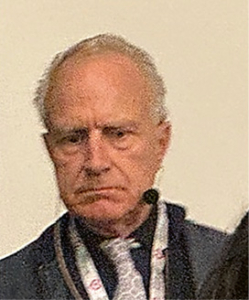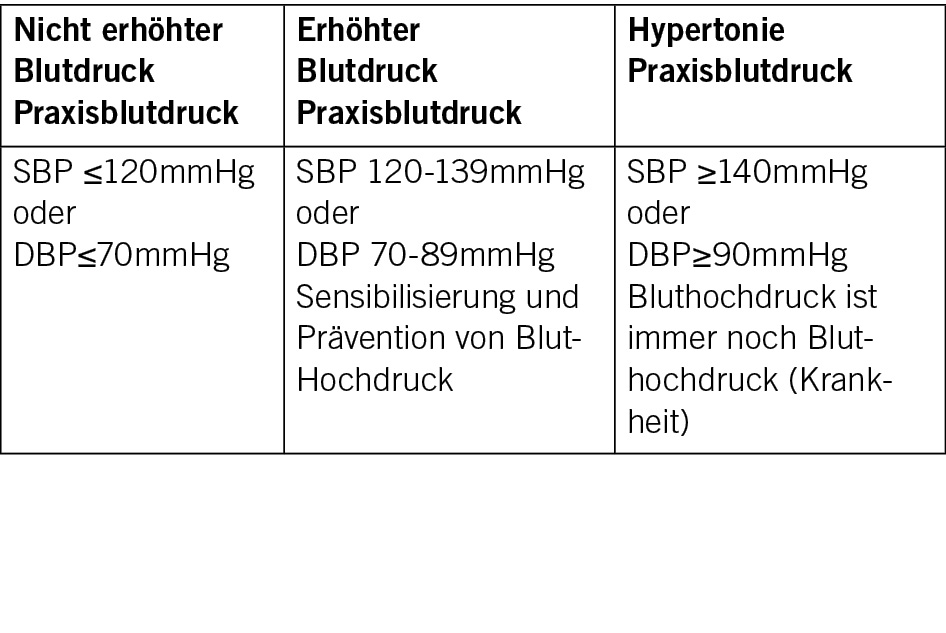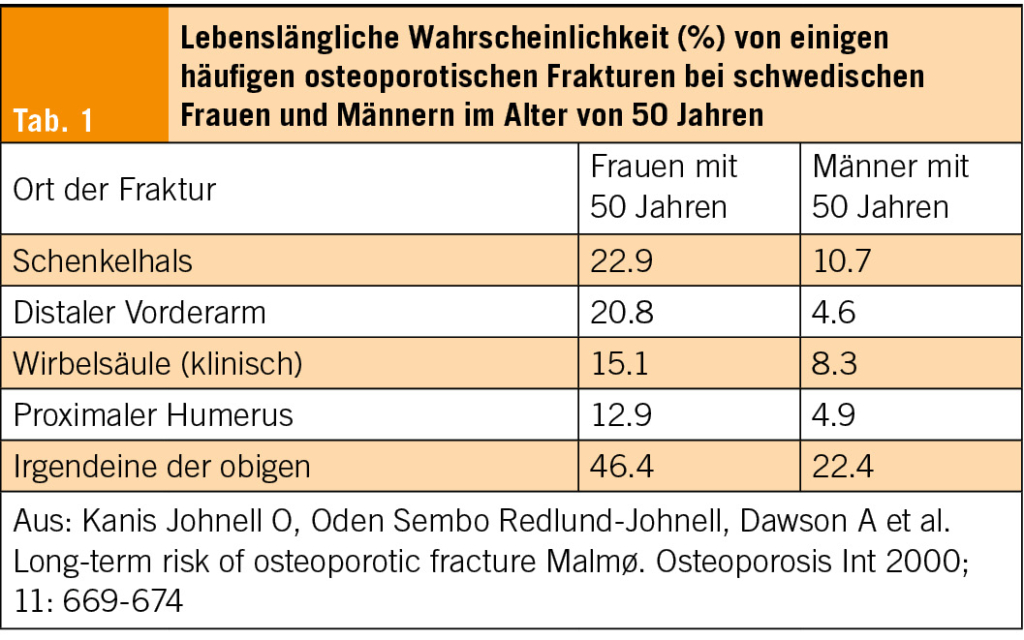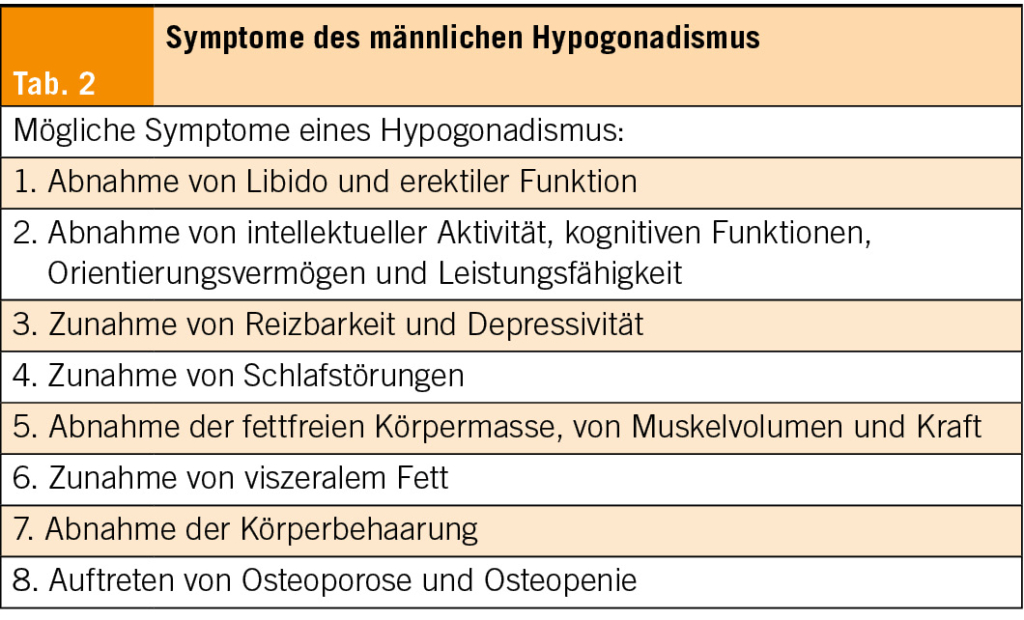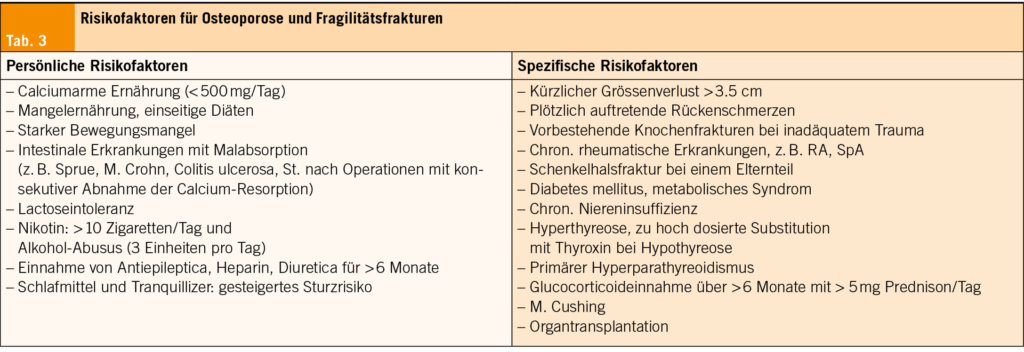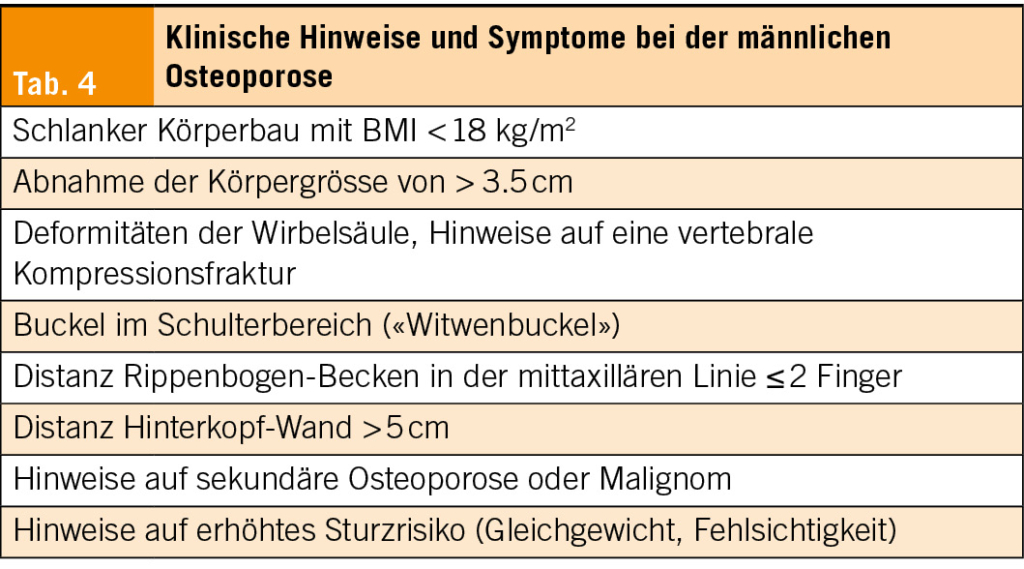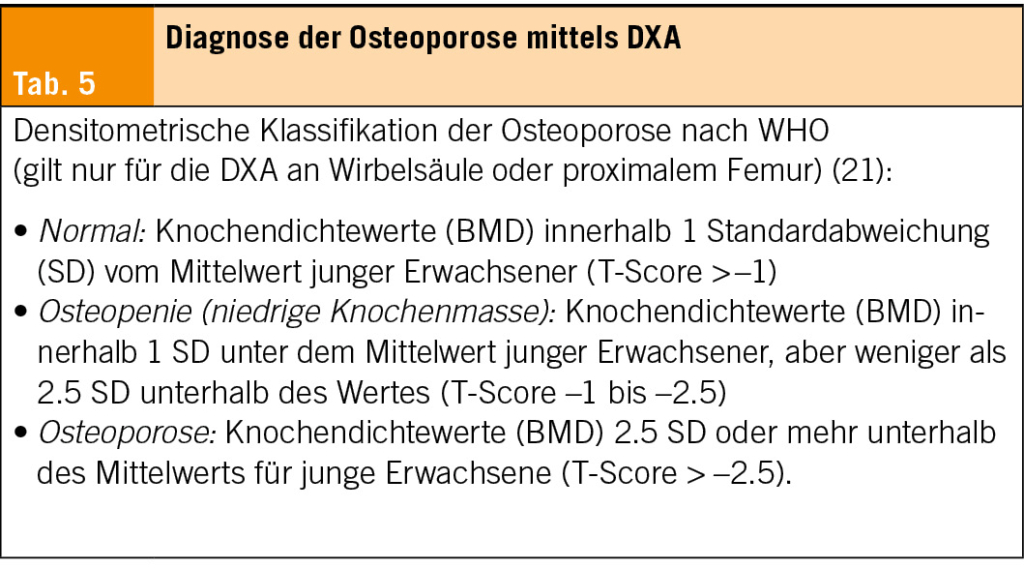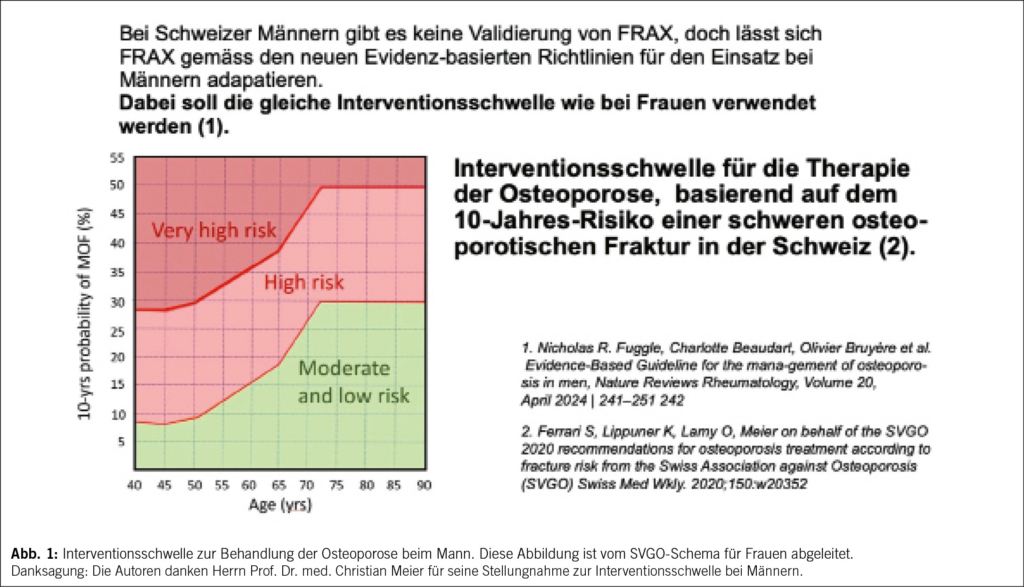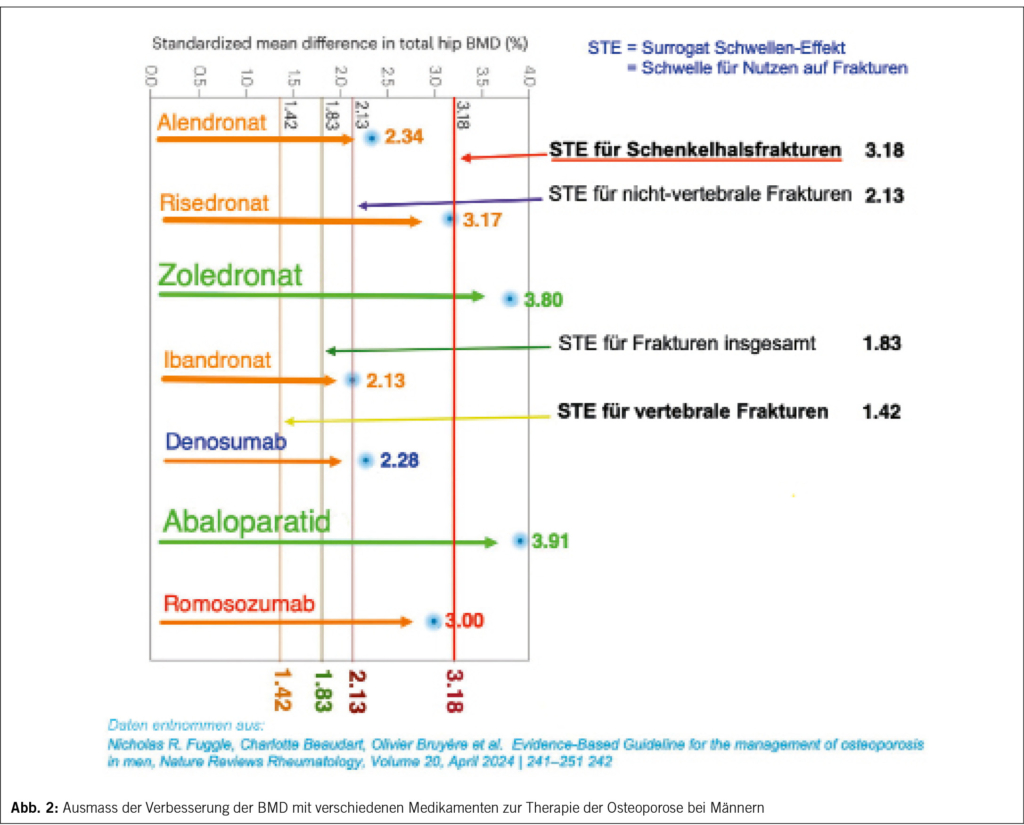Nouveau vaccin pour les patients âgés à risque – le premier vaccin contre le VRS
Chez les patients à risque plus âgés (≥ 65 ans), il faut penser en automne, en plus d‘une vaccination annuelle contre la grippe, d‘une éventuelle nouvelle vaccination Covid-19 adaptée et d‘une éventuelle vaccination unique contre les pneumocoques PCV conjugués, à la nouvelle possibilité d‘une vaccination contre le VRS, pour l‘instant unique. L‘objectif est de réduire les maladies respiratoires graves associées au VRS ainsi que les conséquences qui en découlent avec hospitalisation et décès possible. Il existe une efficacité élevée, probablement durable, et une bonne tolérance de ce premier vaccin anti-VRS au monde pour les adultes de 60 ans et plus souffrant d‘une maladie sous-jacente.
On sait qu’une vaccination annuelle contre la grippe peut prévenir les événements cardiovasculaires, tels que l’infarctus aigu du myocarde ou l’accident vasculaire cérébral, chez les patients âgés à risque, et réduire considérablement la morbidité et la mortalité. La prévention est recommandée aussi bien pour les personnes ≥ 65 ans que pour les patients souffrant d’une maladie chronique. Ces mesures sont simples, très efficaces et rentables (1).
Les virus respiratoires syncytiaux (VRS) provoquent des rhumes, des affections de type grippal et une bronchiolite principalement chez les nourrissons et les jeunes enfants au cours du semestre d’hiver dans le monde entier. Le virus infecte les cellules épithéliales porteuses de cils des muqueuses des voies respiratoires. Celles-ci fusionnent pour former ce que l’on appelle des syncytia. Les infections des voies respiratoires entraînent souvent des hospitalisations. Mais ce virus est également un problème médical croissant chez les adultes âgés en raison de l’immunosénescence, avec des infections graves et potentiellement mortelles des voies respiratoires inférieures et d’autres complications, notamment cardiovasculaires (IC, ACS, arythmies selon l’AHA dans 14-22 %). De nombreuses hospitalisations concernent des personnes âgées et des personnes immunodéprimées. Selon l’Institut Paul-Ehrlich, cela représente environ 250 000 hospitalisations par an en Europe, dont environ 17 000 décès.
C’est pourquoi différentes autorités sanitaires (CDC, Commission européenne, STIKO, RKI, EKIF et OFSP) et plusieurs sociétés spécialisées allemandes: entre autres pneumologie (DGP), hémato-oncologie (DGHO) ont également émis une recommandation de vaccination contre le VRS pour les personnes à risque. Ainsi, la recommandation de la STIKO est la suivante: « L’objectif de la recommandation de vaccination contre le VRS est de réduire les maladies respiratoires graves associées au VRS ainsi que les conséquences qui en résultent, telles que l’hospitalisation et le décès, chez toutes les personnes âgées de ≥75 ans ainsi que chez les personnes âgées de 60 à 74 ans présentant un risque nettement accru de maladie à VRS gravement évolutive en raison d’une maladie sous-jacente significativement invalidante, ainsi que chez les résidents d’établissements de soins âgés de 60 à 74 ans » (2). La vaccination contre le VRS devrait être effectuée si possible en septembre/début octobre, afin d’offrir la meilleure protection possible dès la saison VRS suivante (octobre-mars). Les maladies sous-jacentes concernées sont notamment: Asthme, BPCO, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne, diabète sucré avec complications, maladies respiratoires chroniques. L’insuffisance rénale, les maladies du foie, les maladies neurologiques et neuromusculaires chroniques, les maladies hémato-oncologiques et l’immunodéficience. L’évolution de la maladie est plus grave que celle de l’influenza. Les infections à VRS ne peuvent être traitées que de manière symptomatique. La période d’incubation dure de 2 à 8 jours. C’est pourquoi le nouveau vaccin est d’une grande pertinence.
En Suisse également, le premier vaccin contre le VRS (Arexvy®) est actuellement disponible et autorisé pour les personnes âgées de 60 ans et plus chez ces patients à risque pour une immunisation active (www.bag.admin.ch/rsv). Celui-ci contient un antigène recombinant de la protéine de fusion du VRS (RSVPreF3) issu de l’enveloppe lipidique du VRS avec un activateur (AS01E). Dans la grande étude d’homologation randomisée et contrôlée contre placebo menée auprès de 25 040 patients dans 17 pays, le taux de maladies des voies respiratoires inférieures liées au VRS chez les adultes âgés de ≥ 60 ans a été réduit de manière statistiquement significative de 82,6 % par rapport à la vaccination contre le VRS par placebo lors de la première saison. L’efficacité en termes d’évolution infectieuse sévère était de 94,1 % par rapport au placebo. En termes d’effets secondaires: douleur locale au point d’injection dans 60,9 % et fatigue dans 33,6 % (3). L’association de l’antigène RSVPreF3 et du système adjuvant permet de générer une large réponse immunitaire cellulaire et humorale spécifique à l’antigène et des anticorps neutralisants qui protègent contre les maladies des voies respiratoires inférieures associées au RSV. Ainsi, le vaccin bloque la fusion du VRS avec la membrane plasmique de la cellule hôte humaine. Selon une autre analyse de l’étude d’autorisation de mise sur le marché, les patients âgés présentant des comorbidités sont très bien protégés contre les pneumonies (94,6 %) et les infections aiguës resp. les infections (81 %) (4). La vaccination contre la grippe n’offre qu’une protection de 30 à 70 %, car le vaccin optimal contre la grippe saisonnière ne peut pas être prédit avec précision à chaque fois.
En juin 2024, le CDC américain a également mis à jour sa recommandation de vaccination contre le VRS pour les adultes âgés, en recommandant que toute personne âgée de ≥ 75 ans et toute personne âgée de 60 à 74 ans présentant un risque accru de maladie grave liée au VRS reçoivent une dose unique de vaccin contre le VRS. Chez les adultes âgés de 60 ans et plus, la vaccination contre le VRS était associée à une probabilité plus faible d’hospitalisation pour VRS dans 19 États américains, par rapport à l’absence de vaccination. L’efficacité contre les hospitalisations liées au VRS était de 75 % (5).
Une co-administration, à un autre endroit du corps, de vaccins contre le VRS et de vaccins grippaux quadrivalents est également possible (2, 6, Compendium). Sur la base des données actuelles, il n’est pas encore possible de se prononcer définitivement sur la nécessité/le moment des vaccinations répétées. Le niveau des titres d’anticorps après une vaccination unique a assuré un effet protecteur durable pendant au moins deux saisons hivernales. C’est ce qu’a montré une autre évaluation très récente des données chez les participants à l’étude d’homologation après une deuxième saison (7).
D’autres vaccins contre le VRS (8, 9) sont en cours d’homologation par la CFV ou l’OFSP. Parmi ces derniers, on trouve des vaccins contre le VRS destinés aux personnes âgées (Abrysvo®, ARNm-1345) ainsi qu’un vaccin préfusionnel bivalent destiné aux femmes enceintes à partir de la 24e semaine (Abrysvo®) pour protéger leurs enfants nouveau-nés. Ce dernier vient d’être autorisé par Swissmedic. Les vaccinations avec des vaccins inactivés pendant la grossesse sont considérées comme sûres et sont explicitement recommandées depuis quelques années déjà par la Commission permanente pour les vaccinations (STIKO) pour protéger la mère et son enfant à naître, notamment contre la grippe saisonnière et la coqueluche.
Un vaccin contre le VRS pour les nourrissons et les jeunes enfants est en cours de développement, mais ne devrait pas encore être disponible dans les prochaines années. Dans le courant du mois d’octobre 2024, l’anticorps monoclonal Nirsevimab (Beyfortus®) devrait être disponible pour une immunisation passive des nouveau-nés et des nourrissons pendant le semestre d’hiver selon la SGGG/SSP.
Dr Urs Dürst
Literatur:
Dürst U., Grippe und Herz, der informierte Arzt 2023, Vol. 13, Nr.10; 24-26
Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 32|2024 8. August 2024
Papi A. et al., RSV Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults, N Engl J Med 2023,388:595-608
Feldmann R.G. et al., Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine Is Efficacious in Older Adults With Underlying Medical Conditions, Clin Infect Dis 2024,78:202-209
Surie D. et al., Efficacy of RSV vaccine against hospitalization in adults aged 60 years and older in the US, JAMA. Online 4. September 2024. doi:10.1001/jama.2024.15775
Blickpunkt Medizin, RSV: Wirksamer Impfschutz für ältere Erwachsene, 2023 Thieme
Ison MG et al., Efficacy and Safety of Respiratory Syncytial Virus (RSV) Prefusion F Protein Vaccine (RSVPreF3 OA) in Older Adults Over 2 RSV Seasons, Clin Infect Dis 2024 Jun 14;78(6):1732-1744. doi: 10.1093/cid/ciae010.
Walsh EE. et al., Efficacy and Safety of a Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults, N Engl J Med 2023;388:1465-1477
Kampmann B et al., Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants, N Engl J Med 2023;388:1451-1464
Une exposition prolongée à la lumière du soleil chez les écoliers évite la myopie
Déjà en novembre 2022, un groupe de chercheurs de Shanghai a publié, chez 6295 élèves âgés de 6 à 9 ans, issus de 24 écoles primaires de Shanghai, sur une période de 2 ans, que le risque d’apparition de la myopie diminuait lorsque le temps passé à l’extérieur augmentait. Les enfants du groupe de contrôle ont continué à passer leur temps habituel à l’extérieur et ceux du groupe test I ont bénéficié d’un temps supplémentaire de 40 minutes de temps à l’extérieur et ceux du groupe test II, 80 minutes de temps à l’extérieur supplémentaires. 120 à 150 minutes supplémentaires à l’extérieur à 5000 lux ont entraîné une diminution de 15 à 24 % des nouvelles myopies.
En Asie de l’Est, près de 90 % des enfants sont myopes à l’âge de 12-13 ans. La cause en est la croissance en longueur du globe oculaire, qui déplace le point focal de la lumière devant la rétine.
L’étude de cohorte prospective randomisée d’un an qui vient d’être publiée a porté sur les enfants de la deuxième année de l’étude ci-dessus qui ont porté une smartwatch au moins 6 heures par jour et qui ont tenu au moins 90 jours. Afin d’établir un lien entre les modèles d’exposition à l’extérieur et l’apparition d’une myopie chez les enfants, le temps passé à l’extérieur et l’intensité du rayonnement solaire ont été mesurés, ainsi que le changement absolu de la réfraction entre l’équivalence sphérique initiale et l’équivalence sphérique ultérieure.
Les 2976 élèves (âgés de 7,2 ans ; 51 % de filles) ont passé en moyenne 90 minutes par jour à l’extérieur, avec une intensité de lumière solaire de 2345 lux. Sur les 12 schémas d’exposition en plein air, seuls deux ont été couronnés de succès, le paramètre le plus important étant la durée d’au moins 15 minutes à l’extérieur. Seuls les schémas d’au moins 15 minutes à l’extérieur, accompagnés de pas moins de 2000 lux (jour modérément lumineux et nuageux), ont été associés à une moindre incidence de la myopie (pour ≥ 15 minutes et 2000-3999 lux: -0,007 dioptries et pour ≥ 15 minutes et ≥ 4000 lux (soleil): -0.006 dioptries).
Conclusion: le temps passé à l’extérieur avec une exposition suffisante à la lumière du soleil est déterminant pour le développement de l’œil chez les enfants de 6 à 9 ans. Les enfants ne doivent pas rester à l’intérieur de l’école pendant les pauses. Toutefois, les pauses habituelles à l’école suffisent à peine à assurer le temps d’exposition souhaité de > 15 minutes avec > 2000 lux. Les activités de loisirs (le mercredi après-midi et le week-end) devraient se dérouler autant que possible à l’extérieur. Le pourcentage élevé d’enfants myopes est peut-être lié à une exposition insuffisante à la lumière du soleil.
Dr Marcel Weber
Références
Chen J. et al. Smartwatch Measures of Outdoor Exposure and Myopia in Children. JAMA Netw Open 2024 Aug 1;7(8):e2424595. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.24595. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39136948/He X. et. al. Time Outdoors in Reducing Myopia: A School-Based Cluster Randomized Trial with Objective Monitoring of Outdoor Time and Light Intensity. Ophthalmology 2022;129(11):1245-1254. doi.org/10.1016/j.ophtha.2022.06.024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35779695/