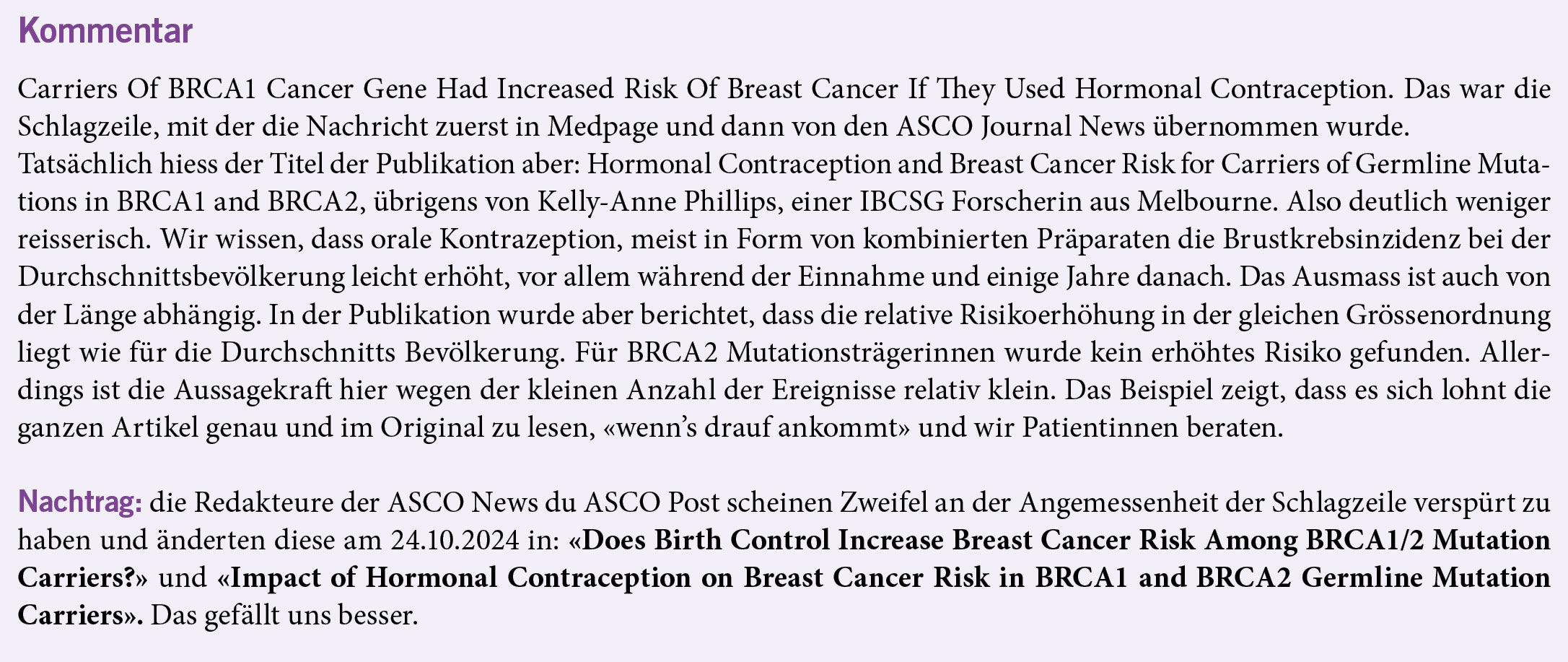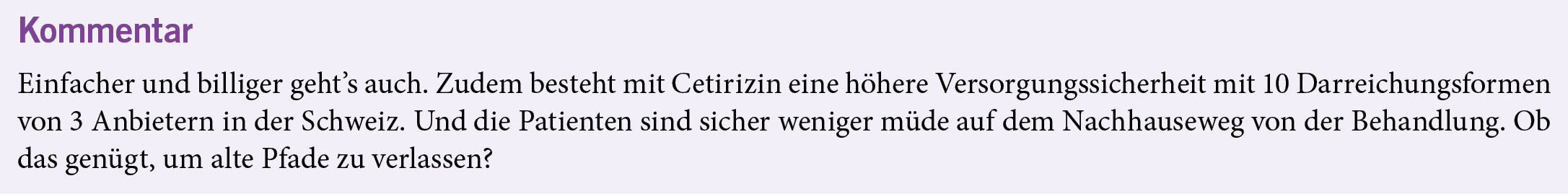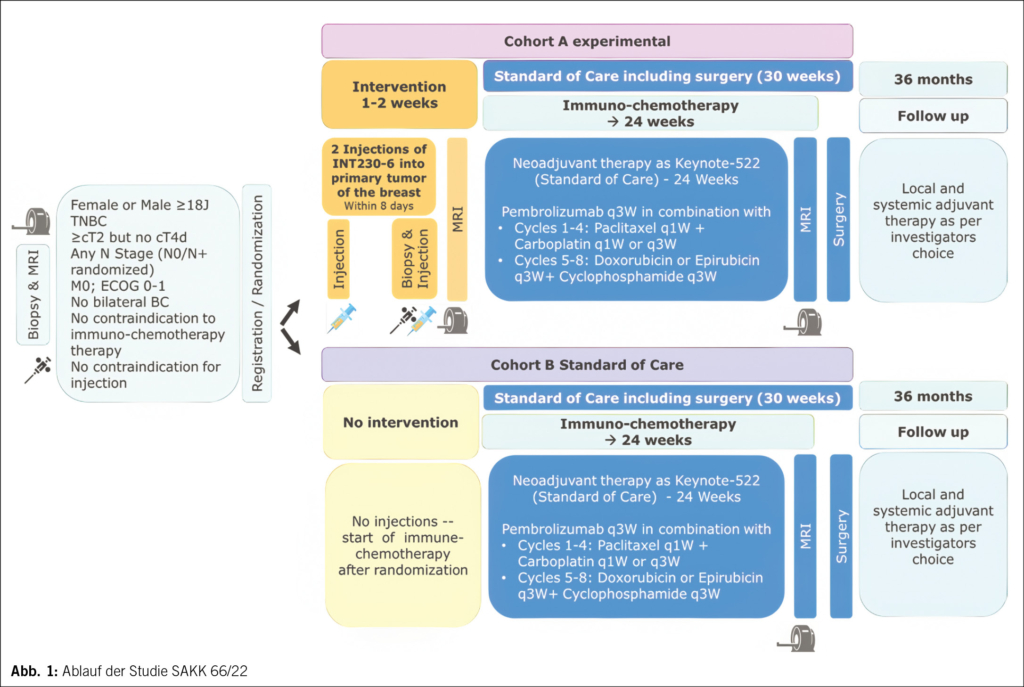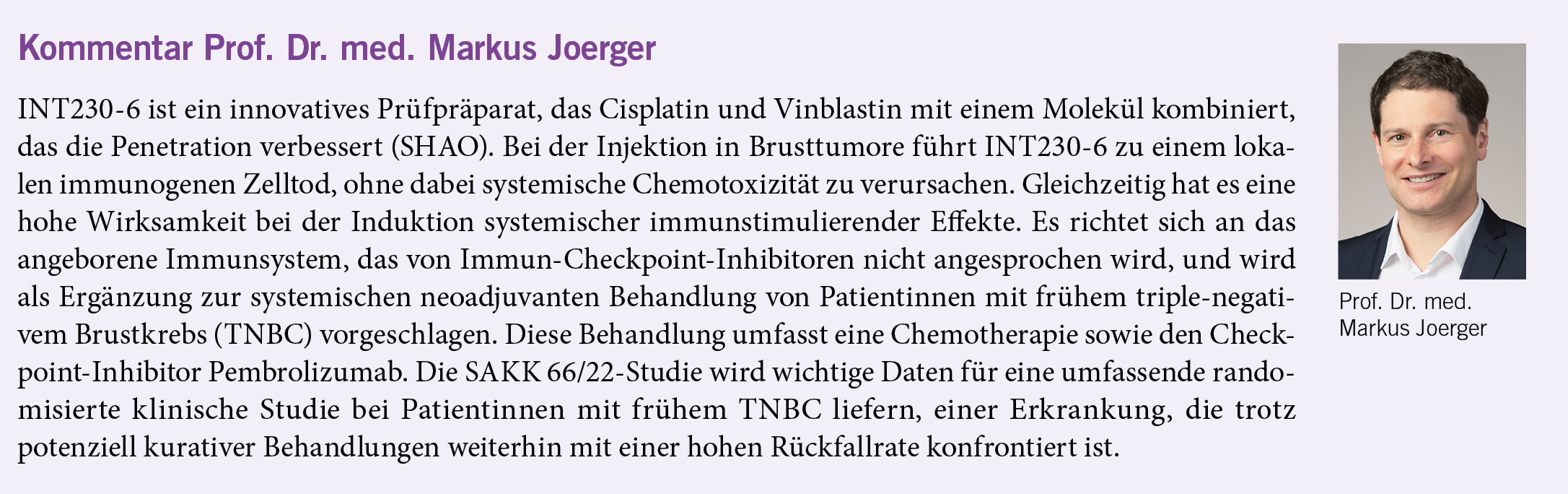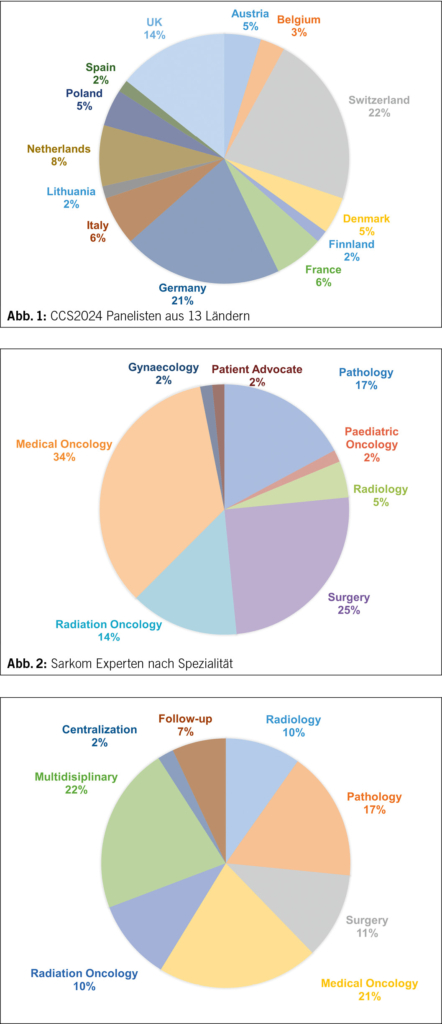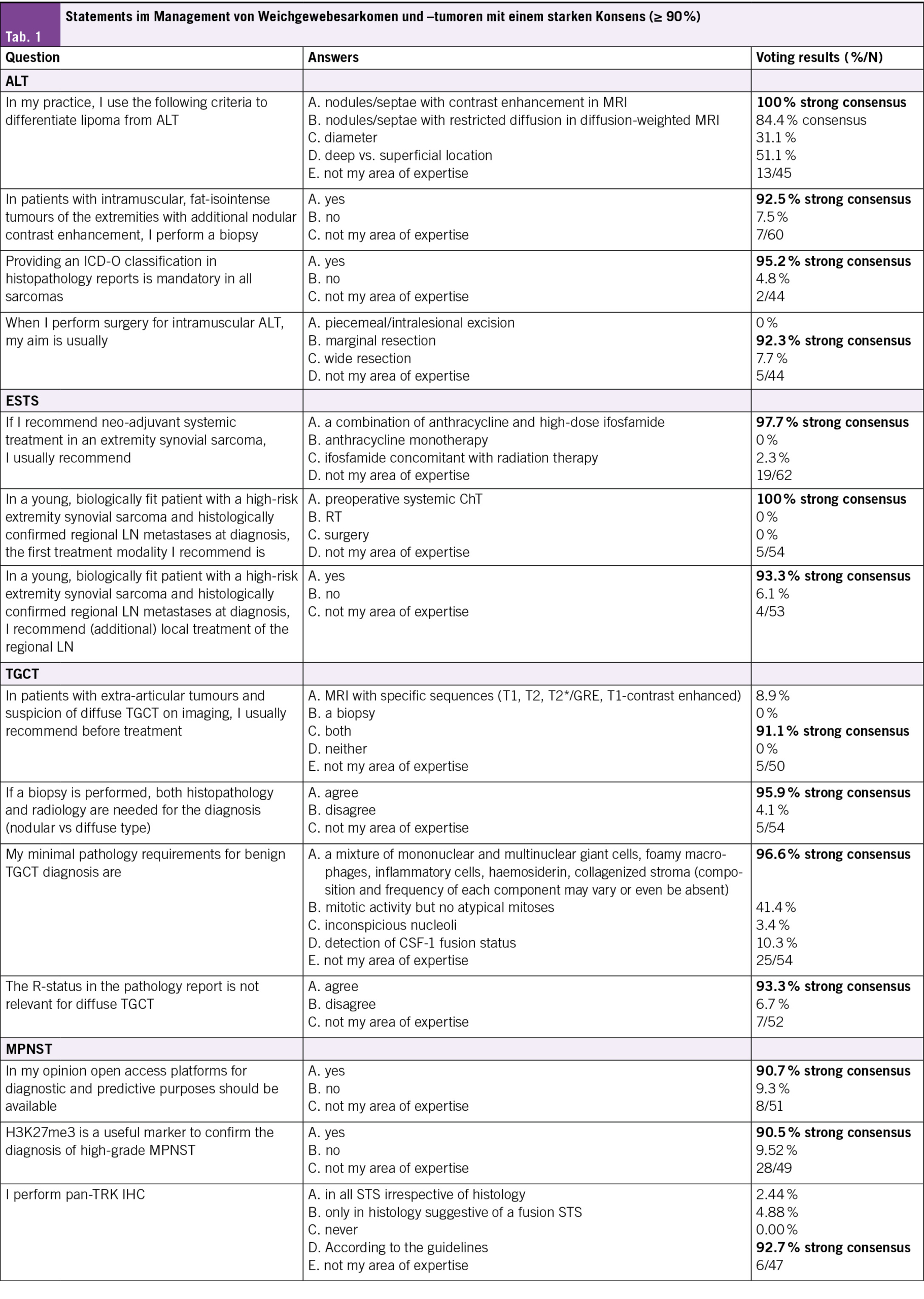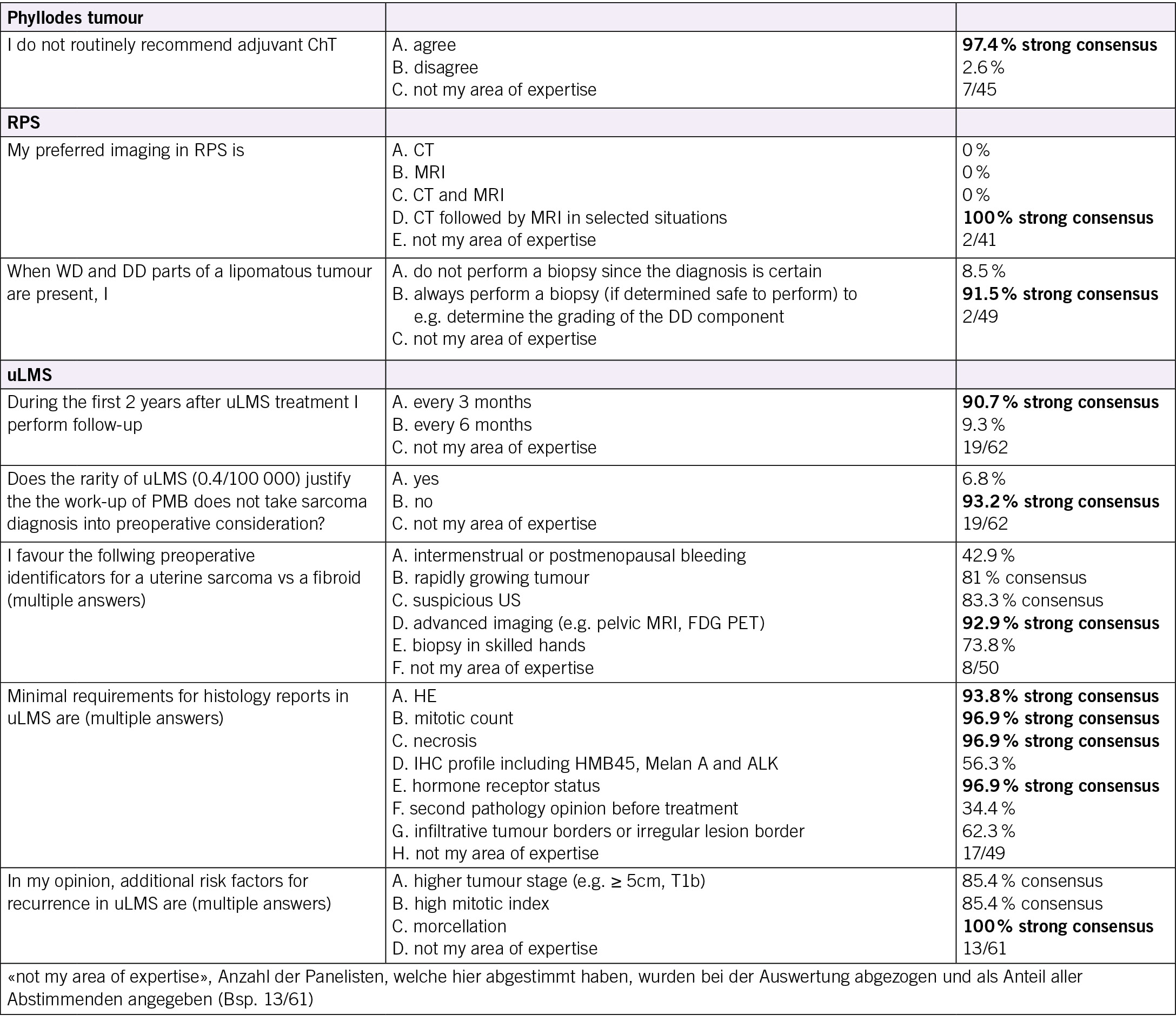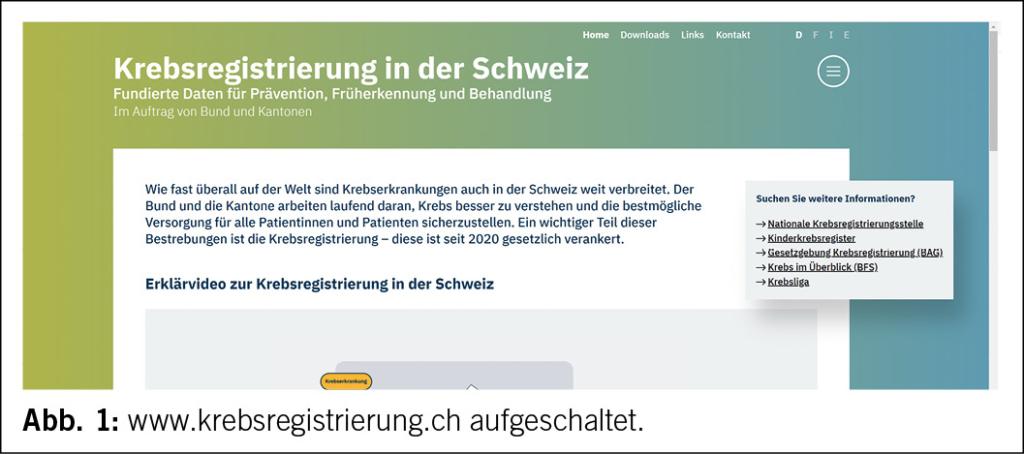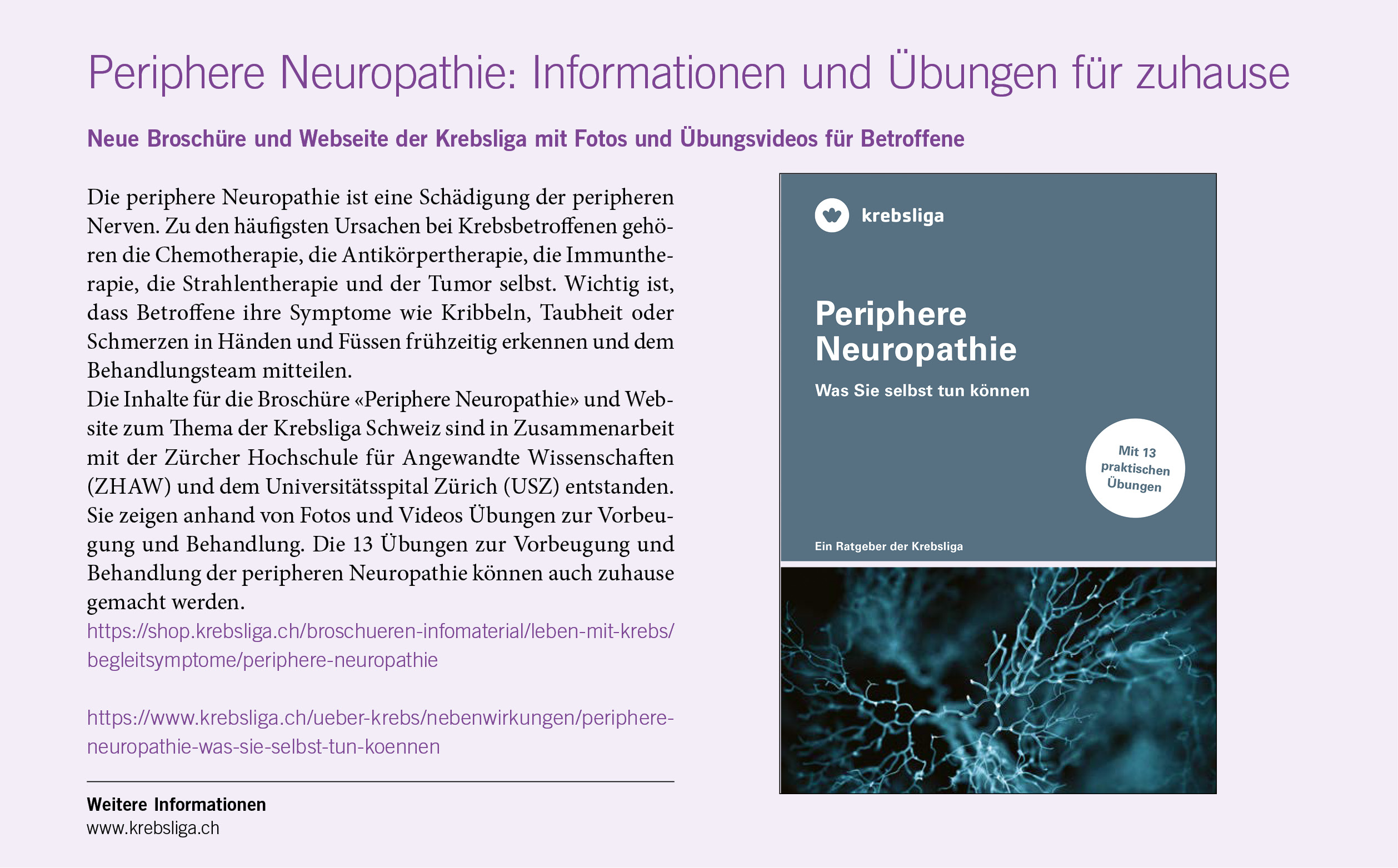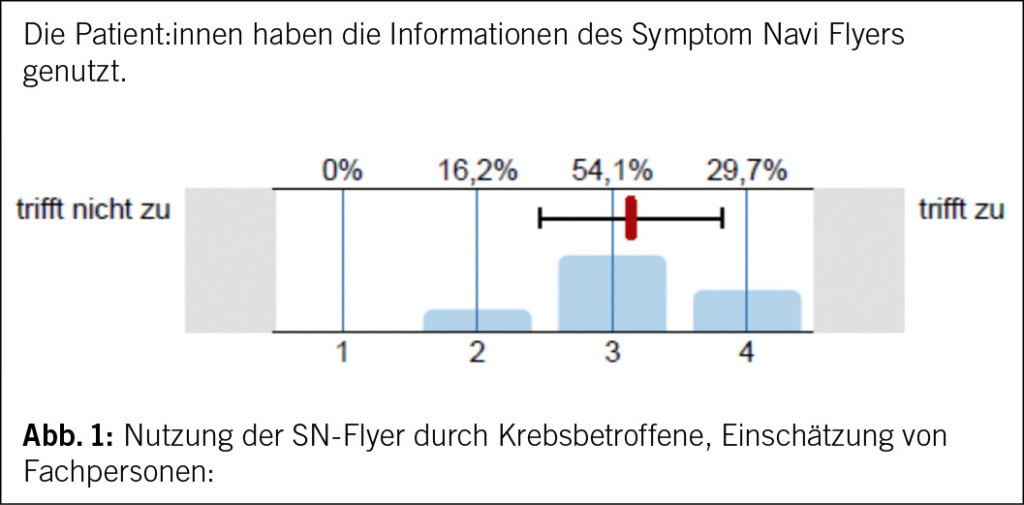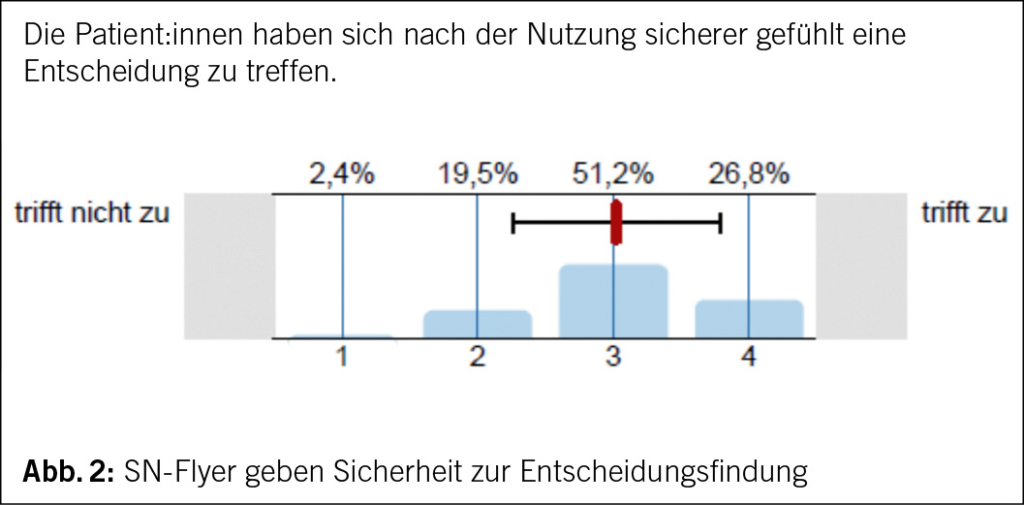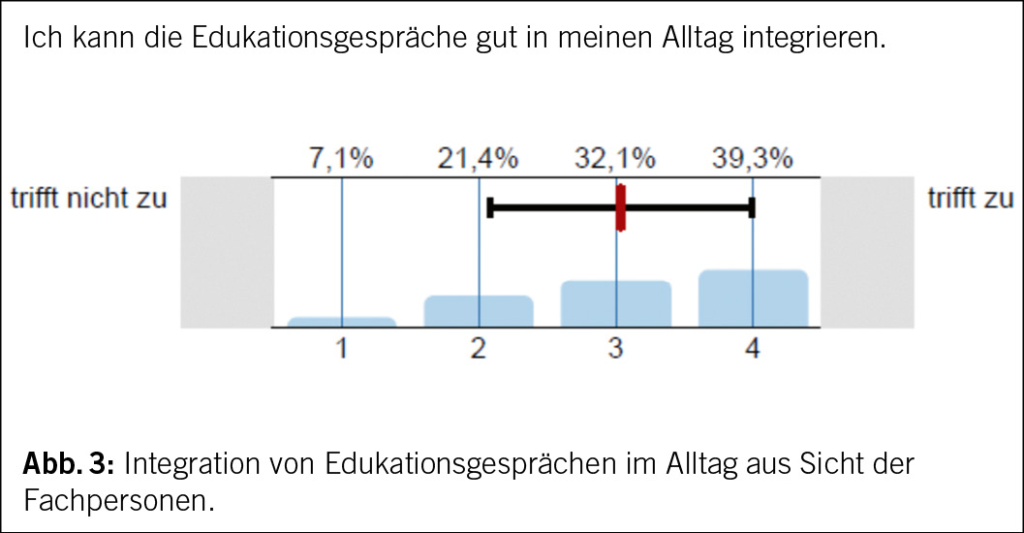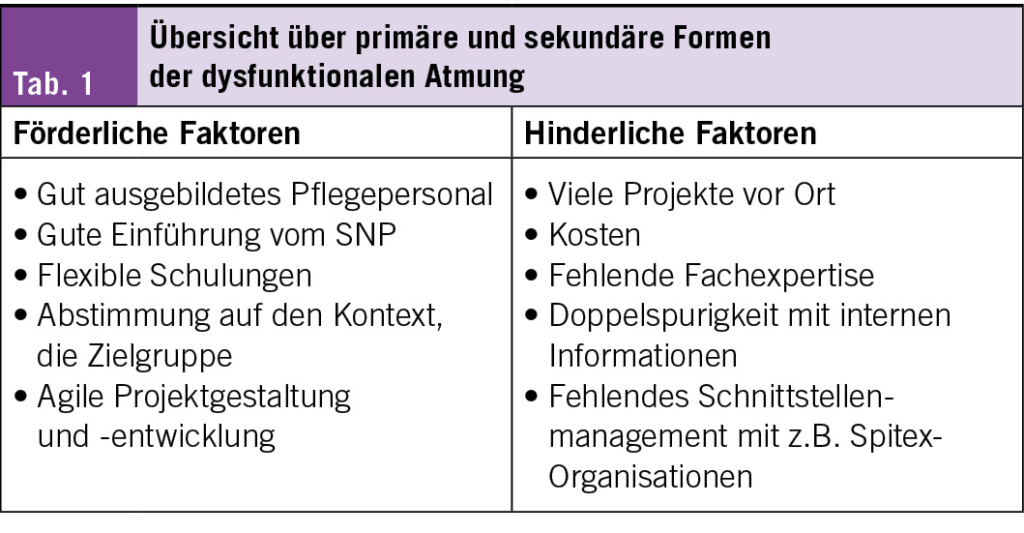Hormonelle Empfängnisverhütung und Brustkrebsrisiko bei Trägerinnen von Keimbahnmutationen in BRCA1 und BRCA2
Ausgangslage
Es ist unklar, ob und in welchem Ausmass hormonelle Verhütungsmittel das Brustkrebsrisiko für Keimbahnträgerinnen mit BRCA1- oder BRCA2-Mutation erhöhen. Dieser Frage ging eine kürzlich publizierte Studie (Quelle) nach.
Methoden
Anhand gepoolter Beobachtungsdaten aus vier prospektiven Kohortenstudien wurde der Zusammenhang zwischen der Anwendung hormoneller Verhütungsmittel und dem Brustkrebsrisiko für nicht betroffene BRCA1- und BRCA2-Mutationsträgerinnen mittels Cox-Regression untersucht.
Ergebnisse
Von 3882 BRCA1- und 1509 BRCA2-Mutationsträgerinnen hatten 53 % bzw. 71 % mindestens ein Jahr lang hormonelle Verhütungsmittel anwendet (mediane kumulative Anwendungsdauer: 4.8 bzw. 5.7 Jahre). Insgesamt entwickelten 488 BRCA1- und 191 BRCA2-Mutationsträgerinnen während einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 5.9 bzw. 5.6 Jahren ein BC. Obwohl bei BRCA1-Mutationsträgern weder die derzeitige noch die frühere Verwendung hormoneller Verhütungsmittel für mindestens ein Jahr statistisch signifikant mit dem BC-Risiko verbunden war (Hazard Ratio [HR], 1.4 [95 % CI, 0.94 bis 2.08], P = 0.1 für die derzeitige Verwendung; 1.16 [0.8 bis 1.69], P = 0.4, 1.4 [0.99 bis 1.97], P = 0.05, und 1.27 [0.98 bis 1.63], P = 0.07 für früheren Konsum vor 1–5, 6–10 bzw. > 10 Jahren), und jeder Konsum war mit einem erhöhten Risiko verbunden (HR, 1.29 [95 % CI, 1.04 bis 1.6], P = 0.02). Darüber hinaus stieg das BC-Risiko mit längerer kumulativer Anwendungsdauer an, mit einem geschätzten proportionalen Anstieg des Risikos von 3 % (1 %–5 %, P = 0.002) für jedes zusätzliche Jahr der Anwendung. Bei BRCA2-Mutationsträgern gab es keine Hinweise darauf, dass die aktuelle oder frühere Anwendung mit einem erhöhten BC-Risiko verbunden war (HR, 0.7 [95 % CI, 0.33 bis 1.47], P = 0.3 bzw. 1.07 [0.73 bis 1.57], P = 0.7).
Schlussfolgerung
Hormonelle Kontrazeptiva sind mit einem erhöhten BC-Risiko für BRCA1-Mutationsträgerinnen verbunden, insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Bei der Entscheidung über ihre Anwendung bei Frauen mit BRCA1-Mutationen sollten die Risiken und Vorteile für jede einzelne Person sorgfältig abgewogen werden.
Literatur
Phillipps KA et al.Hormonal Contraception and Breast Cancer Risk for Carriers of Germline Mutations in BRCA1 and BRCA2. Journal of Clinical Oncology https://doi.org/10.1200/JCO.24.00176
Wirkung der Umstellung des Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten Clemastin auf Cetirizin in Paclitaxel-Prämedikationsregimen: Die H1-Switch-Studie
Allen Patienten, die mit einer Paclitaxel-Chemotherapie behandelt werden, wird eine Prämedikation mit einem Histamin-1-Rezeptor (H1)-Antagonisten empfohlen, um das Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (HSR) zu verringern. Die wissenschaftliche Grundlage für diese Prämedikation ist jedoch nicht solide, so dass es Möglichkeiten zur Optimierung gibt. Die Substitution eines intravenös verabreichten H1-Antagonisten der ersten Generation durch einen oral verabreichten H1-Antagonisten der zweiten Generation könnte die Nebenwirkungen verringern und die Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern. Diese Studie untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit des Ersatzes von intravenösem Clemastin durch orales Cetirizin als Prophylaxe für Paclitaxel-induzierte HSRs.
Methoden
In dieser prospektiven Nichtunterlegenheitsstudie wird eine historische Kohorte, die ein Prämedikationsschema mit intravenösem Clemastin erhielt, mit einer prospektiven Kohorte verglichen, die orales Cetirizin erhielt. Primärer Endpunkt der Studie ist HSR-Grad ≥ 3. Der Unterschied in der Inzidenz wurde zusammen mit dem 90 %-KI berechnet. Wir legten fest, dass der zweiseitige 90 %-KI der Inzidenz von HSR-Grad ≥ 3 in der oralen Cetirizin-Kohorte im Vergleich zur intravenösen Clemastin-Kohorte nicht mehr als 4 % höher sein sollte (d. h. die Nichtunterlegenheitsgrenze).
Ergebnisse
Zweihundertzwölf Patienten wurden in die orale Cetirizin-Kohorte (Juni 2022 und Mai 2023) und 183 in die intravenöse Clemastin-Kohorte eingeschlossen. Die Inzidenz von HSR- Grad ≥ 3 betrug 1.6 % (n = 3) in der intravenösen Clemastin-Kohorte und 0.5 % (n = 1) in der oralen Cetirizin-Kohorte, was einer Differenz von –1.2 % (90 % CI, –3.4 bis 1.1) entspricht.
Schlussfolgerung
Eine Prämedikation mit oralem Cetirizin ist bei der Verhinderung einer Paclitaxel-induzierten HSR-Grad ≥ 3 ebenso sicher wie eine Prämedikation mit intravenösem Clemastin. Diese Ergebnisse könnten dazu beitragen, die Versorgung der Patienten zu optimieren und die Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.
Literatur
Malmberg R et al. Effect of Switching the Histamine-1 Receptor Antagonist Clemastine to Cetirizine in Paclitaxel Premedication Regimens: The H1-Switch Study. JCO Oncology Practice2024 ;20, Number 9. https://doi.org/10.1200/OP.24.00110
SwissBreastCare
Bethanienspital
Toblerstrasse 51
8044 Zürich