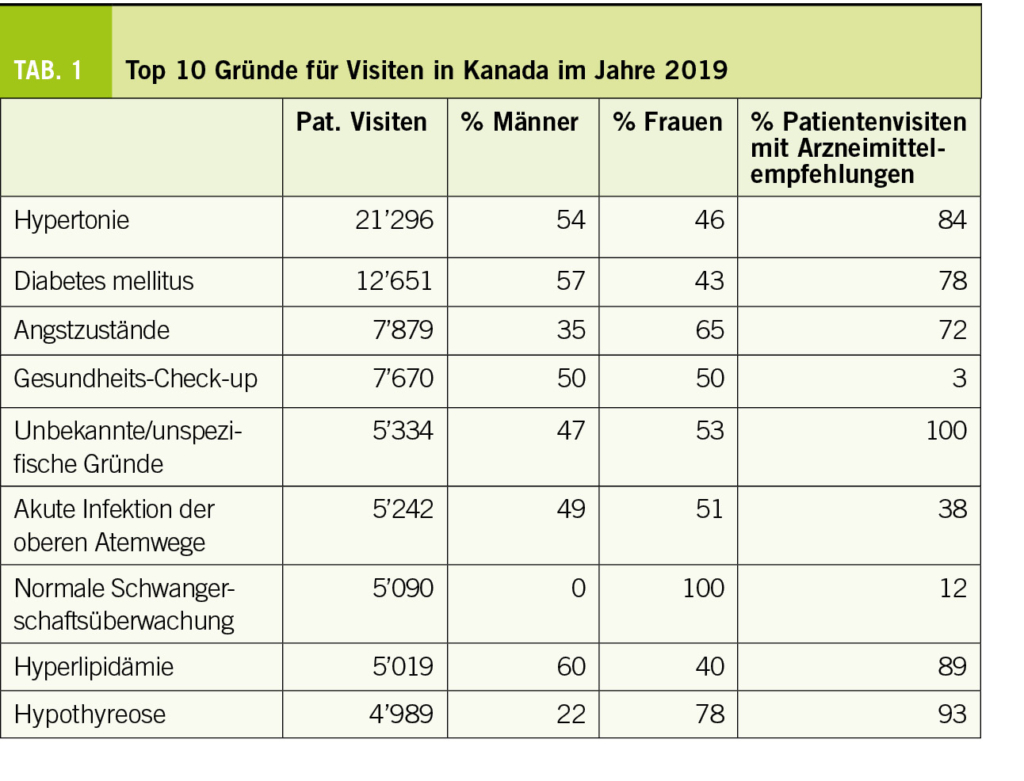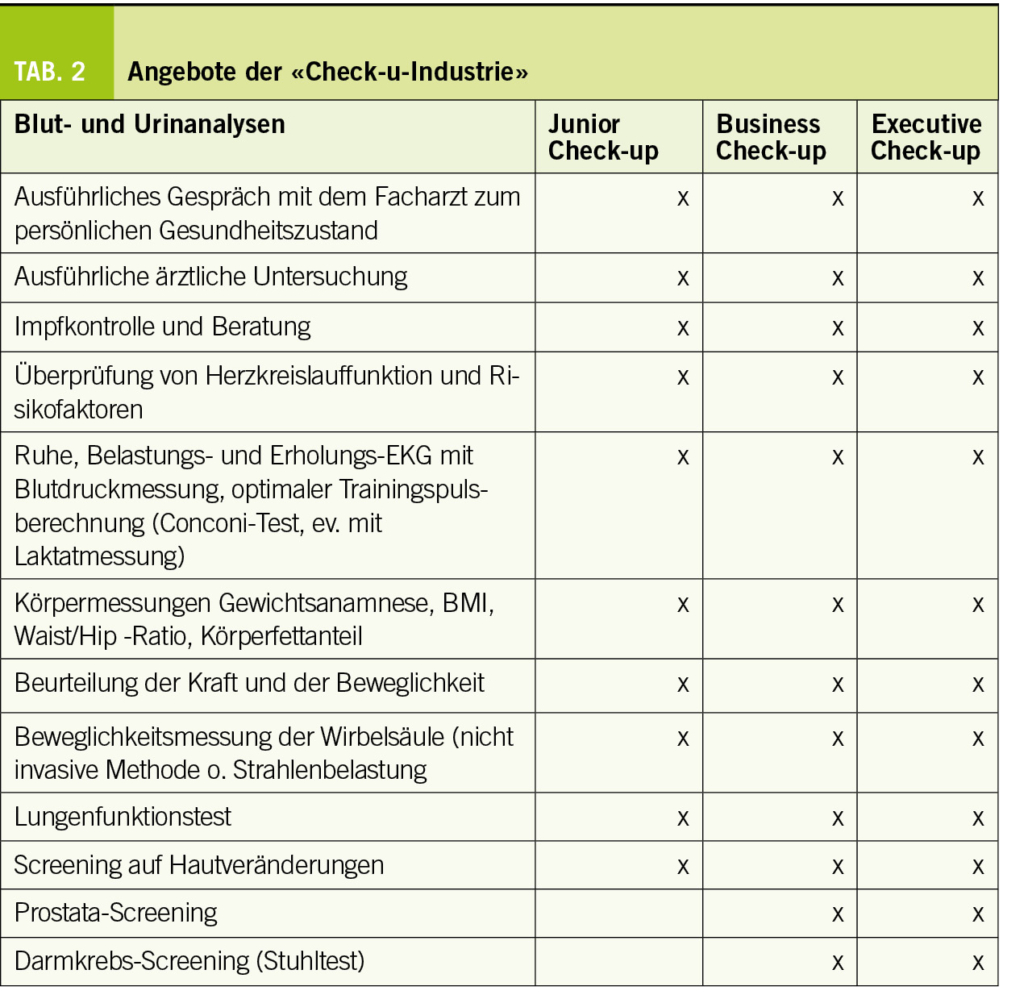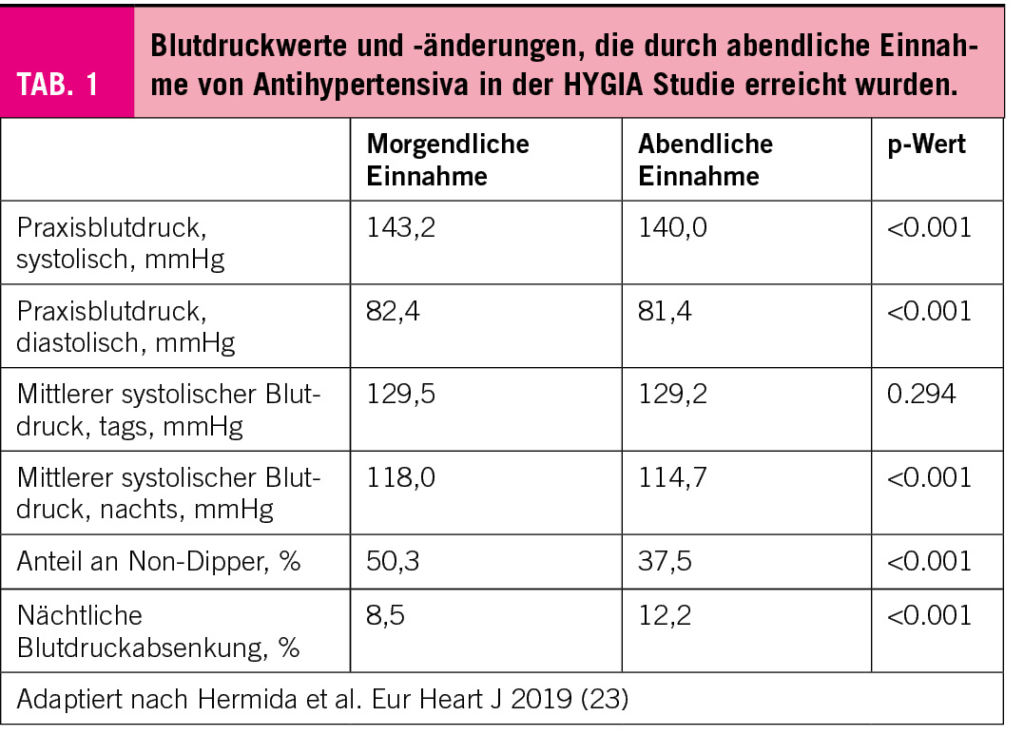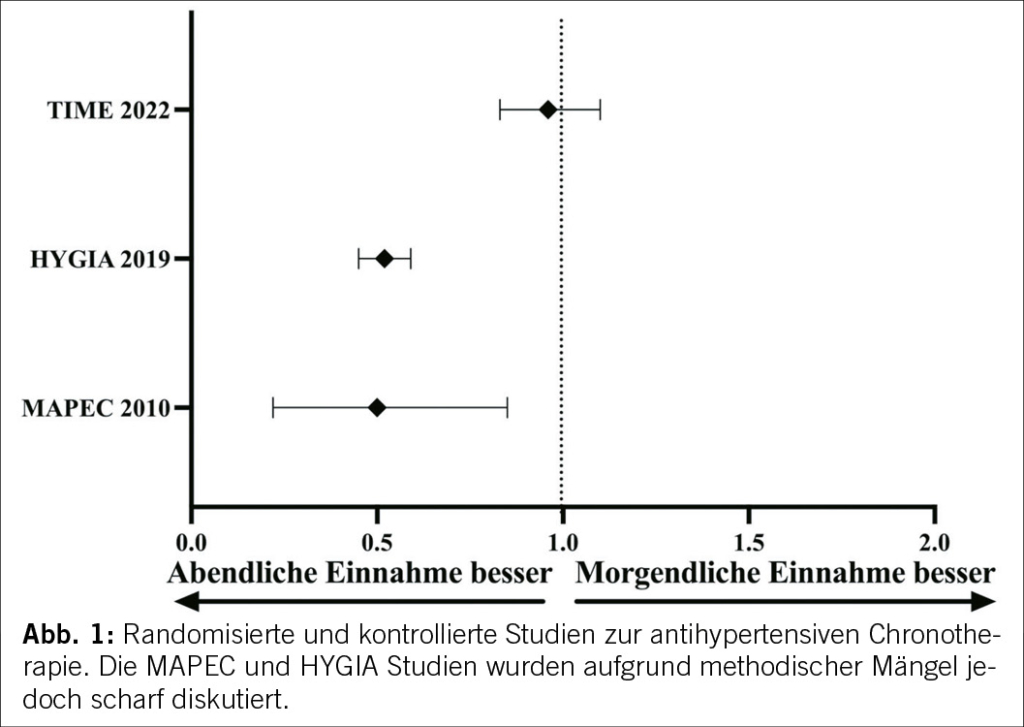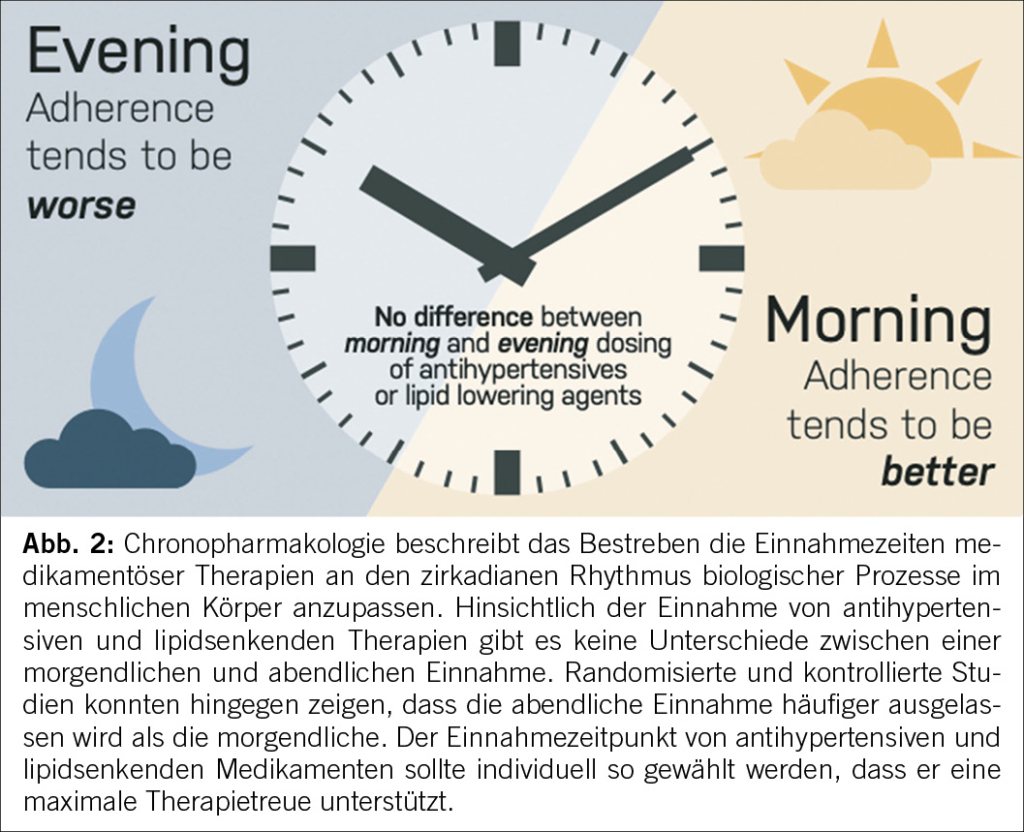Die Gelenkpunktion bzw. -Infiltration ist eine häufige medizinische Prozedur, die insbesondere von Rheumatologen durchgeführt wird. An Nummer eins steht das Kniegelenk, da es gross und gut erreichbar ist bzw. häufig von rheumatischen oder mechanischen Erkrankungen betroffen ist. Daneben werden die Schulter, Handgelenk, Hüfte, Sprunggelenk, aber auch kleinere Gelenke wie Fingergelenke am häufigsten punktiert bzw. infiltriert. Im folgenden Artikel soll auf einige Grundlagen sowie Kontroversen der Gelenkpunktion und Infiltration eingegangen werden.
Joint punctures and infiltrations are frequent medical procedures, particularly carried out by rheumatologists. First and foremost is the knee, due to its large size and accessibility, as well as its frequent involvement in rheumatic or mechanical diseases. The shoulders, wrists, hips, ankles and small joints such as the finger joints are also often punctured or infiltrated. This article will look at some of the basic principles and controversies surrounding joint puncture and infiltration.
Key Words: joint infiltration, arthrocnetesis, arthritis
Technische Aspekte
Wir unterscheiden zwischen der diagnostischen Punktion, die am häufigsten durchgeführt wird, und der therapeutischen Punktion. Bei einem klaren klinischen Bild wie z.B. einer Chondrokalzinose und gutem Allgemeinzustand erfolgt die diagnostische Punktion und therapeutische Infiltration hier von Glucocorticoiden gleichzeitig. Der Ultraschall hat die Gelenkpunktion entschieden vereinfacht. Ein gut punktiertbarer Gelenkerguss ist gut durch eine hypoechogene Struktur erkennbar. In den wenigsten Fällen (z.B. im Hüftgelenk, bei bestimmten Bursae oder wenig Erguss) muss die Gelenkpunktion unter sonographischer Beobachtung erfolgen. Meist reicht eine entsprechende Markierung aus. Bei wenig Erguss kann übrigens die nicht-schallende oder nicht-punktierende Hand dazu genutzt werden, die Gelenkflüssigkeit von kontralateral in Richtung Schallkopf bzw. Nadel zu drücken. Ein willkommener Nebeneffekt ist die so durchgeführte «Gate Control», d.h. der Druck der Hand sendet schmerzhemmende Afferenzen in Richtung Rückenmark. Man kennt dies vom Reiben einer Körperstelle bei Schmerzen. Natürlich müssen die sterilen Kautelen eingehalten werden, zumindest die empfohlene No-touch Technik. Generell empfehlen wir, die Nadel mit einer Hand zu halten und damit während der Punktion einen Unterdruck zu erzeugen, um das Aspirat möglichst schnell und atraumatisch zu erhalten.
Pro Gelenkpunktion und Infiltration
1. Diagnostischer Nutzen
Klare Nummer eins ist der Ausschluss einer septischen bzw. bakteriellen Arthritis. Cave: Das Grampräparat hat eine Sensitivität von nur 50%. Der Goldstandard ist die Kultur. Bei bestimmten Fragestellungen, wie z.B. beim Nachweis der Borreliose oder Tropheryma whipplei wird eine PCR durchgeführt (1). Als häufige Ursache der Arthritis können in der Polarisationsmikroskopie Kristalle (z.B. Urat, Calciumpyrophosphat) nachgewiesen werden (Abb. 1). Die Zellzahl differenziert zwischen einem entzündlichen Status (>2000 Zellen pro mm3) und einem nicht entzündlichen Status, wie meistens bei der Arthrose. Eine aktivierte Arthrose sollte aus unserer Sicht zumindest einmal diagnostisch mittels Punktion abgeklärt werden. Durch die Injektion von Lokalanästhetika (oft gemischt mit Steroiden) kann abgeklärt werden, ob die Schmerzursache tatsächlich intraartikulär liegt und nicht extraartikulär. Letzteres ist in ca. 10% die Schmerzursache bei der Gonarthrose (z.B. Bursitiden).
2. Zielgerichtete Behandlung
Da das Medikament direkt in das betroffene Gelenk injiziert wird, kann es gezielt auf den problematischen Bereich wirken, ohne den Rest des Körpers zu beeinflussen und weniger mit anderen Medikamenten zu interagieren. Bei einer Monarthritis, z.B. reaktiv, bei einer rheumatoiden Arthritis oder auch bei einer aktivierten Arthrose kann die Entzündung so gezielt durch die Infiltration von Glucocorticoiden behandelt werden. Dies ist zwar nicht krankheitsmodifizierend, kürzt aber Schmerzen und Immobilität entschieden ab. In einer neuen Studie hat ein lang wirksames intraartikulär appliziertes Steroid eine signifikante Wirkung bei der Arthrose über 52 Wochen gezeigt (2). Bei der RA können Steroide auch adjuvant zur Basistherapie verwendet werden (3). Noch gibt es keine wirklichen «Disease-modifying Osteoarthritis Drugs». Die Hyaluronsäure wirkt über Ihren CD44-Rezeptor anti-entzündlich, dieser Effekt ist vielleicht sogar stärker als der rheologische Effekt als «Gelenkschmiere» (4). Das Platelet Rich Plasma (PRP) wird ebenfalls aufgrund der anti-entzündlichen und regenerativen Effekte eingesetzt. Allerdings fehlen für beide Medikamente nachhaltige Daten, um diese in die Routine einzusetzen. Bei Patienten mit kardiovaskulären, gastroenterologischen oder anderen Komorbiditäten kann die Gelenkinfiltration mit Glukokortikoiden oder Hyaluronsäure eine Alternative zu systemisch verabreichten Medikamenten sein, um Nebenwirkungen oder Interaktionen zu vermeiden.
Contra Gelenkinfiltration
1. Risiko von Infektionen:
Zwar ist das Risiko sehr gering, aber jede Gelenkinfiltration birgt die Gefahr einer septischen Arthritis. Risikofaktoren hierfür sind u.a. wiederholte Infiltrationen am selben Gelenk, Immunsuppression und mangelnde Hygiene. Dies muss immer in Abwägung mit dem möglichen Nutzen gestellt werden. Bei der diagnostischen Punktion stellt sich diese Frage meist nicht.
2. Mögliche Nebenwirkungen:
Bei der Infiltration von oberflächlichen Gelenken wie Fingergelenke kann es durch Steroide zu Hautatrophien und Depigmentierungen kommen (Abb. 2). Meist trifft dies 2-3 Monate nach der Infiltration auf und normalisiert sich innerhalb von bis zwei Jahren selbstständig (5). Dies kann auch bei tiefen Gelenken wie den Facettengelenken an der Lendenwirbelsäule passieren.
Nicht nur die orale, sondern auch die wiederholte intraartikuläre Gabe von Depot-Steroiden kann zu einem Cushing, bzw. anderen Kortison-induzierten Schäden führen wie Osteoporose, Pergamenthaut, etc. Allerdings muss beachtet werden, dass die Alternative zur Gelenksinfiltration oft orale Entzündungshemmer sind, die bekannterweise auch Nebenwirkungen haben, die in den Kontext gestellt werden müssen.
3. Kurzfristige Lösung:
Oftmals bietet die Gelenkinfiltration nur eine temporäre Linderung, z.B. Steroide bei der aktivierten Arthrose oder Kristallarthritis. Die Ursache wird, abgesehen von der Harnsäuresenkung bei der Gicht, bislang nicht behandelt. Für den einzelnen Patienten kann aber bereits die kurzfristige Schmerzlinderung einen sehr grossen Wert haben.
4. Potentielle Schädigung des Gelenkgewebes:
Häufige Gaben von Glukokortikoiden, aber auch Lokalanästhetika können das Knorpelgewebe schädigen. Manche Zentren infiltrieren generell keine Lokalanästhetika mehr in das Gelenk (6). Allerdings beruhen diese Daten v.a. auf in vitro Experimenten und sind in klinischen Studien so nicht unbedingt nachvollziehbar.
5. Fragliche Evidenz für Viscosupplementation bei der Arthrose
Verschiedene Fachgesellschaften wie z.B. ACR raten aufgrund der Datenlage nicht zur intraartikulären Behandlung mit Hyaluronsäure (7). OARSI spricht sich für eine solche Behandlung bei Patienten mit Komorbiditäten aus, die nicht für eine NSAR-Behandlung oder intraartikuläre Steroide in Frage kommen (8).
Zusammenfassung und Ausblick
Die Gelenkinfiltration ist ein wichtiges diagnostisches Tool bei Gelenkerkrankungen und kann für viele Patienten mit Arthritis eine effektive Methode zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung sein. Dies gilt für kristallinduzierte Arthritiden, Arthrose, aber auch bei Arthritiden aus dem rheumatischen Formenkreis. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Risiken und Nebenwirkungen zu berücksichtigen und diese mit dem Patienten zu besprechen.
Bei der Behandlung der Arthrose sollte immer ein ganzheitliches Konzept vorliegen. Das heisst, biomechanische Faktoren müssen berücksichtigt werden und gleichzeitig, z.B. bei Malalignment, durch eine Orthese behandelt werden. Besonders bei chronischen Schmerzsyndromen und der Fibromyalgie ist bei der (repetitiven) Gelenkinfiltration Vorsicht geboten. Dies gilt insbesondere auch für die Infiltration der Wirbelsäule, z.B. der Facettengelenke. Neuere Therapieansätze bei der Arthrose einzelner Gelenke zielen durchaus auf eine intraartikuläre und nicht systemische Gabe ab. Es ist zu hoffen, dass aus diagnostischer Sicht neben der Zellzahl, Kristallanalyse und Bakteriologie auch neuere Biomarker der Synovialflüssigkeit erhältlich sind, z.B. um eine reaktive Arthritis von einer rheumatoiden Arthritis abzugrenzen oder die Prognose und das Ansprechen bei der rheumatoiden Arthritis besser vorherzusagen.
Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG
Hôpital orthopédique CHUV
Avenue Pierre Decker
1011 Lausanne
Der Autor hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.
1. Aguero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwartz I, Wormser GP. Diagnosis of lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev. Jul 2005;18(3):484-509. doi:10.1128/CMR.18.3.484-509.2005
2. Spencer-Green G, Hunter D, Schnitzer T, et al. A Phase 3 Study of Repeat Injection of TLC599 in Osteoarthritis of the Knee: Benefits to 52 Weeks. ABSTRACT NUMBER: L19. ACR Convergence 2023 San Diego.2023.
3. Mueller RB, Spaeth M, von Restorff C, Ackermann C, Schulze-Koops H, von Kempis J. Superiority of a Treat-to-Target Strategy over Conventional Treatment with Fixed csDMARD and Corticosteroids: A Multi-Center Randomized Controlled Trial in RA Patients with an Inadequate Response to Conventional Synthetic DMARDs, and New Therapy with Certolizumab Pegol. J Clin Med. Mar 3 2019;8(3)doi:10.3390/jcm8030302
4. Wang CT, Lin YT, Chiang BL, Lin YH, Hou SM. High molecular weight hyaluronic acid down-regulates the gene expression of osteoarthritis-associated cytokines and enzymes in fibroblast-like synoviocytes from patients with early osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. Dec 2006;14(12):1237-47. doi:10.1016/j.joca.2006.05.009
5. Dhinsa H, McGuinness AE, Ferguson NN. Successful treatment of corticosteroid-induced cutaneous atrophy and dyspigmentation with intralesional saline in the setting of keloids. JAAD Case Rep. Oct 2021;16:116-119. doi:10.1016/j.jdcr.2021.08.022
6. Jayaram P, Kennedy DJ, Yeh P, Dragoo J. Chondrotoxic Effects of Local Anesthetics on Human Knee Articular Cartilage: A Systematic Review. Pm r. Apr 2019;11(4):379-400. doi:10.1002/pmrj.12007
7. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. Feb 2020;72(2):220-233. doi:10.1002/art.41142
8. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. Nov 2019;27(11):1578-1589. doi:10.1016/j.joca.2019.06.011