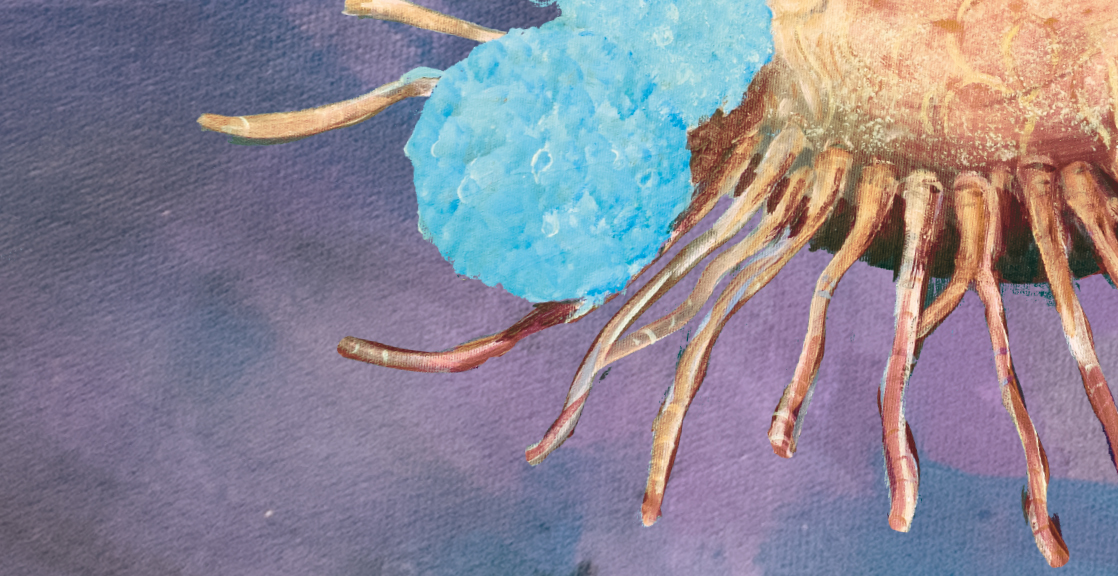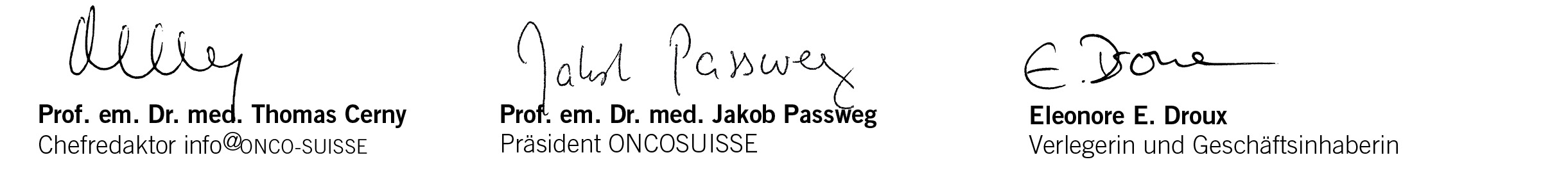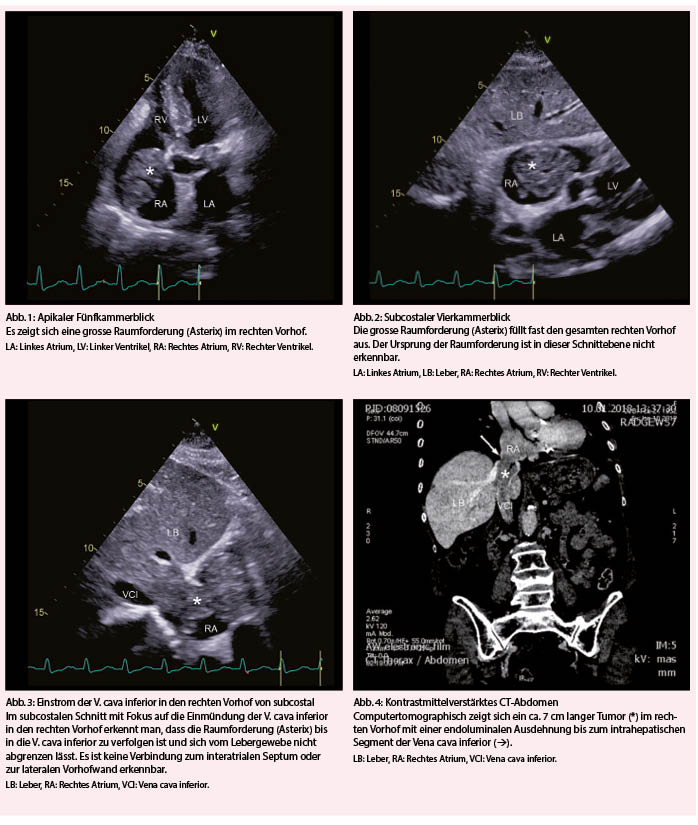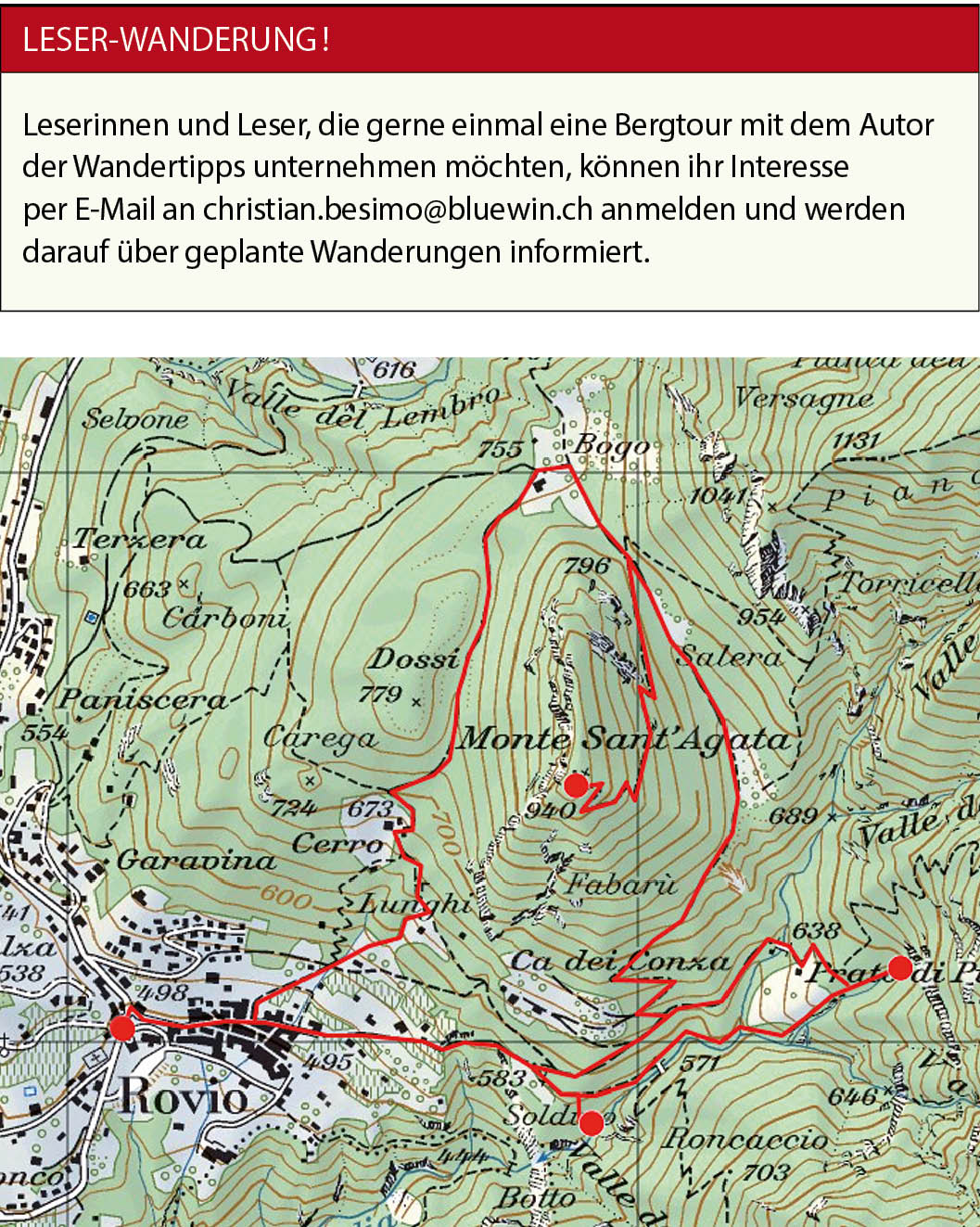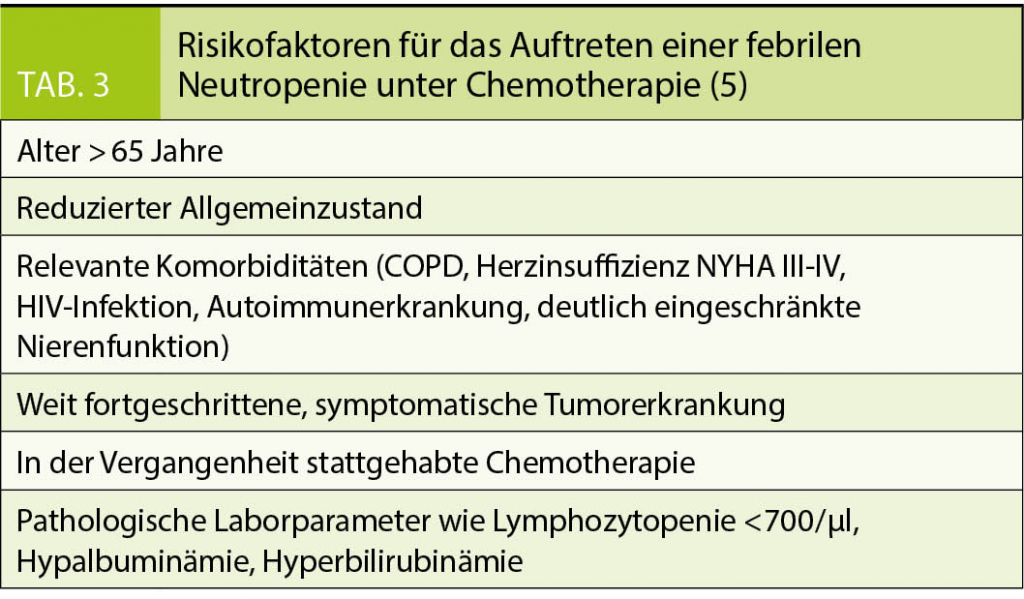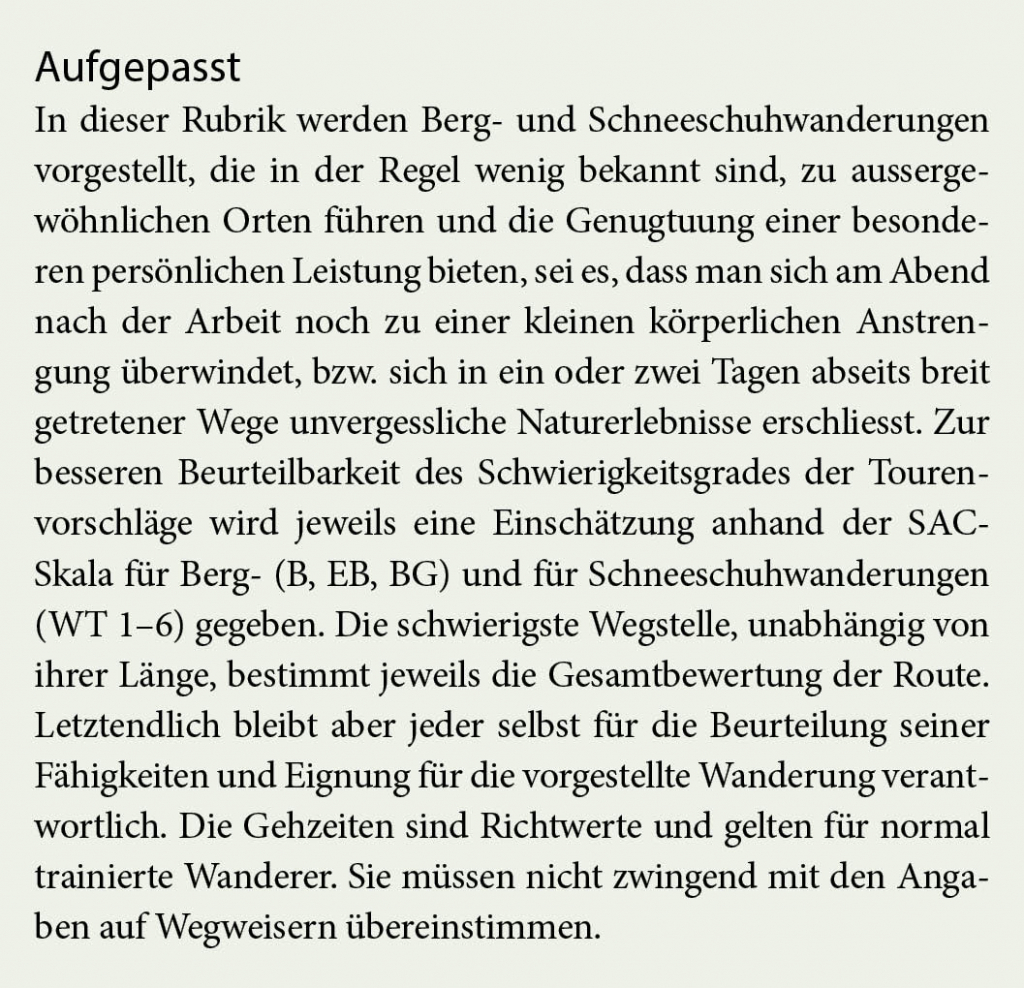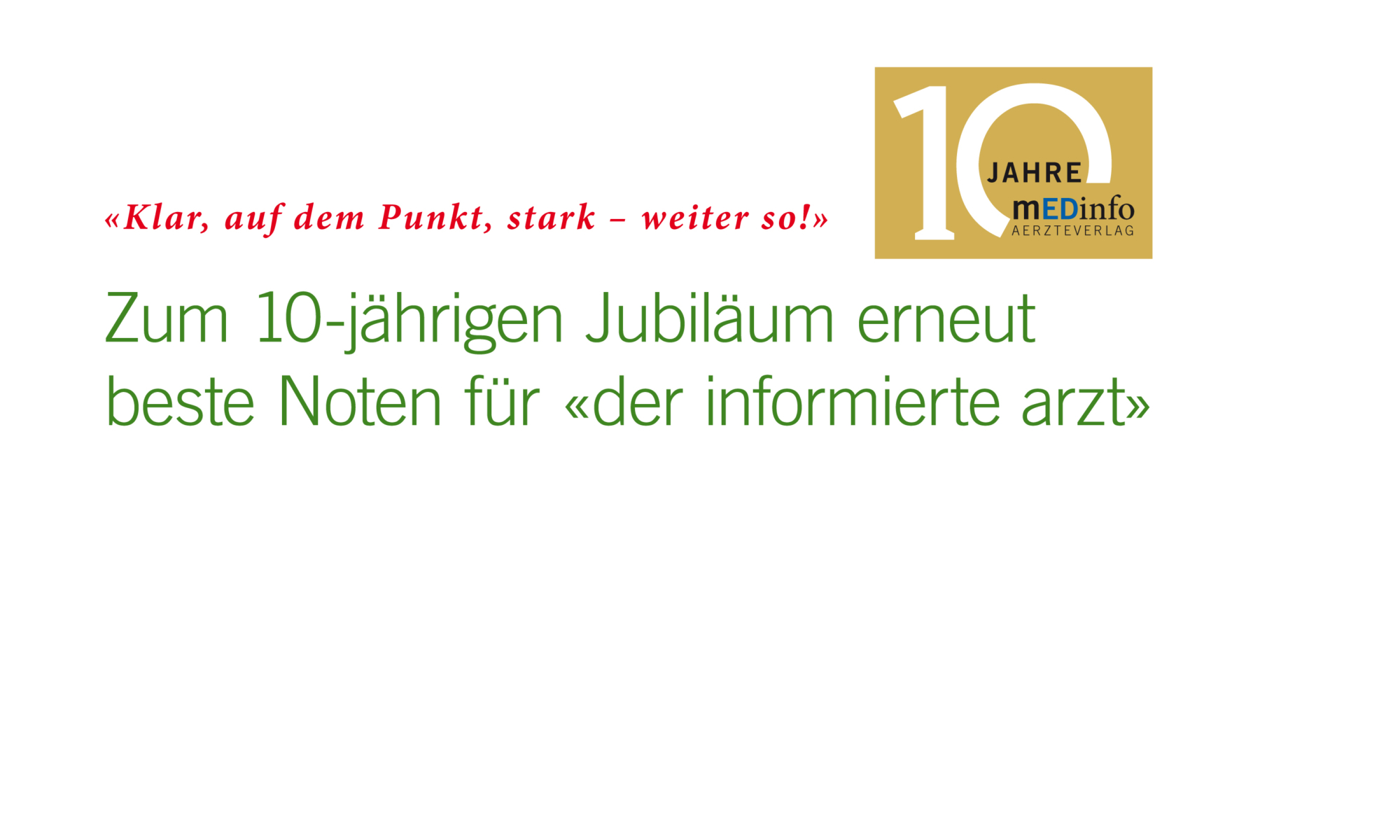Hunderte von Studien, Registern und systematischen Analysen sind unternommen worden, um herauszufinden, wie man Patienten mit atherothrombotischen Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit (KHK) oder periphere Verschlusskrankheit (PAD) am besten schützt. Niedrig dosiertes ASS wurde etabliert, mit sehr niedrigen Blutungsraten. Clopidogrel erwies sich als etwas wirksamer (1). Es folgte die duale Plättchenhemmung nach akutem Koronarsyndrom oder Stent. Weiter wurde ASS plus Warfarin untersucht und verworfen, da das Blutungsrisiko zu stark anstieg (2). Auch die Triple-Therapie mit ASS, Clopidogrel und Warfarin erwies sich als zu riskant bezüglich Blutungen.
Der Weg in die Zukunft wies schliesslich die ATLAS ACS 2-TIMI 51-Studie (3), zunächst bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom. Dabei zeigte sich, dass das Antikoagulans (Rivaroxaban) bei Zugabe zu Thrombozytenhemmern sehr niedrig dosiert werden muss. Der Erfolg waren erniedrigte Raten an kardiovaskulärem Tod, Herzinfarkt und Schlaganfall, bei zwar erhöhtem Blutungsrisiko, welches aber beherrschbar war. Insgesamt resultierte eine niedrigere Gesamtmortalität.
ASS plus niedrig-dosiertes Rivaroxaban – das COMPASS-Regime
Die COMPASS-Studie (4) ging nun einen Schritt weiter vom akuten Koronarsyndrom zur Sekundärprävention. Mehr als 27 000 Patienten mit stabiler atherosklerotischer Gefässerkrankung (61% Herzinfarkt, 91%KHK, 27% PAD, 4% Schlaganfall, 37% Diabetes, 21% Herzinsuffizienz) hatten an COMPASS teilgenommen. Sie wurden randomisiert auf 3 Behandlungsstrategien:
1) ASS 100 mg,
2) 2 x täglich 2.5 mg Rivaroxaban plus einmal täglich 100 mg ASS
3) 2 x täglich 5 mg Rivaroxaban ohne ASS
Primärer Endpunkt waren die üblichen drei schweren Komplikationen kardiovaskulärer Tod, Herzinfarkt oder Schlaganfall (MACE). Rivaroxaban plus ASS ergab dabei im Vergleich zu ASS allein eine Risikoreduktion für MACE von 24% (p < 0.001). Rivaroxaban allein vs. ASS allein ergab keinen signifikanten Unterschied (Hazard Ratio 0.90).Aufgrund der «überwältigend positiven Ergebnisse» wurde die Studie nach nur 23 Monaten Dauer vorzeitig abgebrochen.
Eine Substudie von COMPASS (5))mit 6391 Patienten mit peripherer Verschlusskrankheit wurden mit dem gleichen Regime (2 x 2,5 mg Rivaroxaban + ASS 100 mg) behandelt. Die Resultate ergaben eine 24% relative Risikoreduktion für sämtliche peripheren vaskulären Outcomes , aber es mussten vermehrte Blutungen in Kauf genommen werden ( HR 1,61) vor allem gastrointestinale Blutungen.
ASS plus low-dose Rivaroxaban – ein bedeutender Schritt für die Gerinnungs-Kardiologie. Dies der Kommentar von Prof. Dr. med. Eugene Braunwald in seinem Editorial im New England Journal of Medicine (6) zur COMPASS-Studie.
Schlaganfallrisiko um 42% reduziert
Eine neue Analyse der COMPASS Studie rückt nun noch speziell die Wirkung auf Schlaganfälle in den Blickpunkt (7). Während der durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 23 Monaten hatten weniger Patienten Schlaganfälle in der Rivaroxaban plus Aspirin-Gruppe als in der Aspirin-Gruppe (83,0% pro Jahr gegenüber 142,1% pro Jahr, HR 0.58), was einer relativen Risikoreduktion von 42% entspricht. Ischämische/unbestimmte Schlaganfälle wurden durch die Kombination im Vergleich zu Aspirin um fast die Hälfte reduziert (68,0,7% pro Jahr gegenüber 132,1,4% pro Jahr; HR, 0,51). Es wurde dagegen kein signifikanter Unterschied beim Auftreten eines Schlaganfalls in der Rivaroxaban-Gruppe allein im Vergleich zu Aspirin festgestellt. Das Auftreten von tödlichem und deaktivierendem Schlaganfall (modifizierte Rankin-Skala, 3-6) wurde durch die Kombination (32,0,3% pro Jahr] gegenüber 55,0,6% pro Jahr) reduziert; HR, 0,58;
Niedrig dosiertes Rivaroxaban plus Aspirin ist damit eine wichtige neue antithrombotische Option zur primären und sekundären Schlaganfallprävention bei Patienten mit klinischer Atherosklerose.
Fazit
Das duale COMPASS-Regime mit niedrig dosiertem Rivaroxaban plus niedrig dosiertem ASS ist von zumindest ähnlichem oder grösserem Nutzen als in bisherigen Studien zu antithrombotischen Therapien zur Reduktion von kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall festgestellt wurde. Darüberhinaus reduzierte es die MALE (major adverse limb events), die kardiovaskuläre und die Gesamtmortalität. Trotz erhöhtem Risiko von Blutungen war der klinische Nutzen günstig.