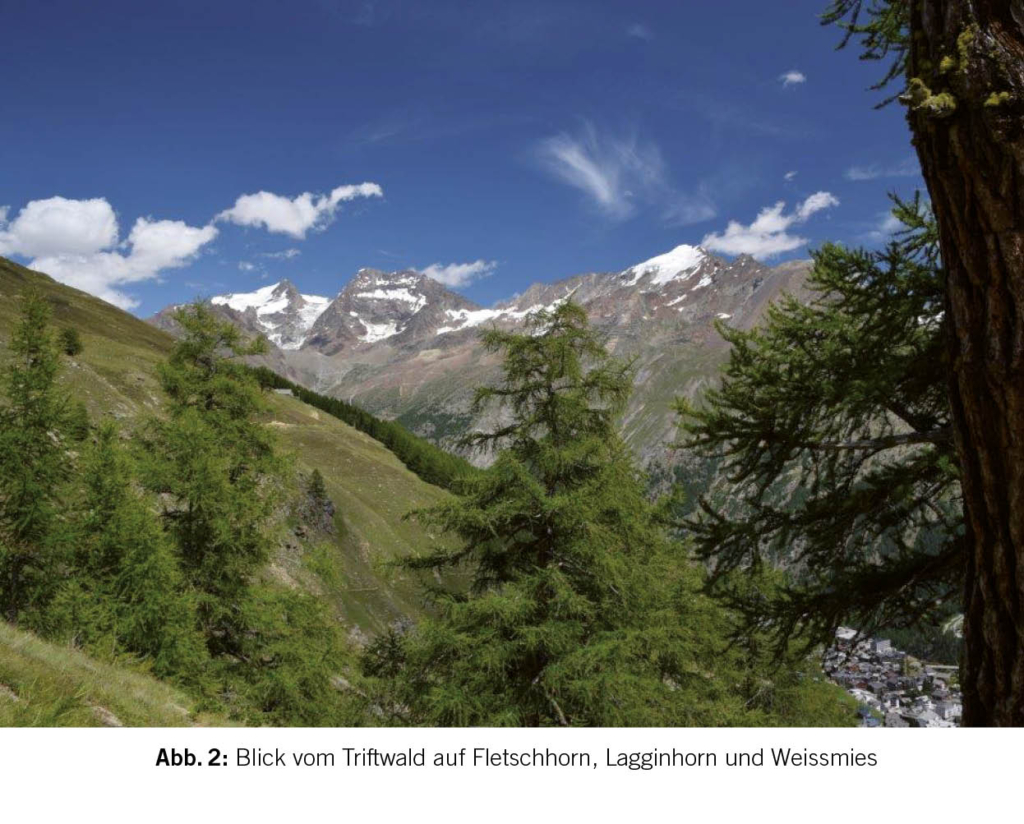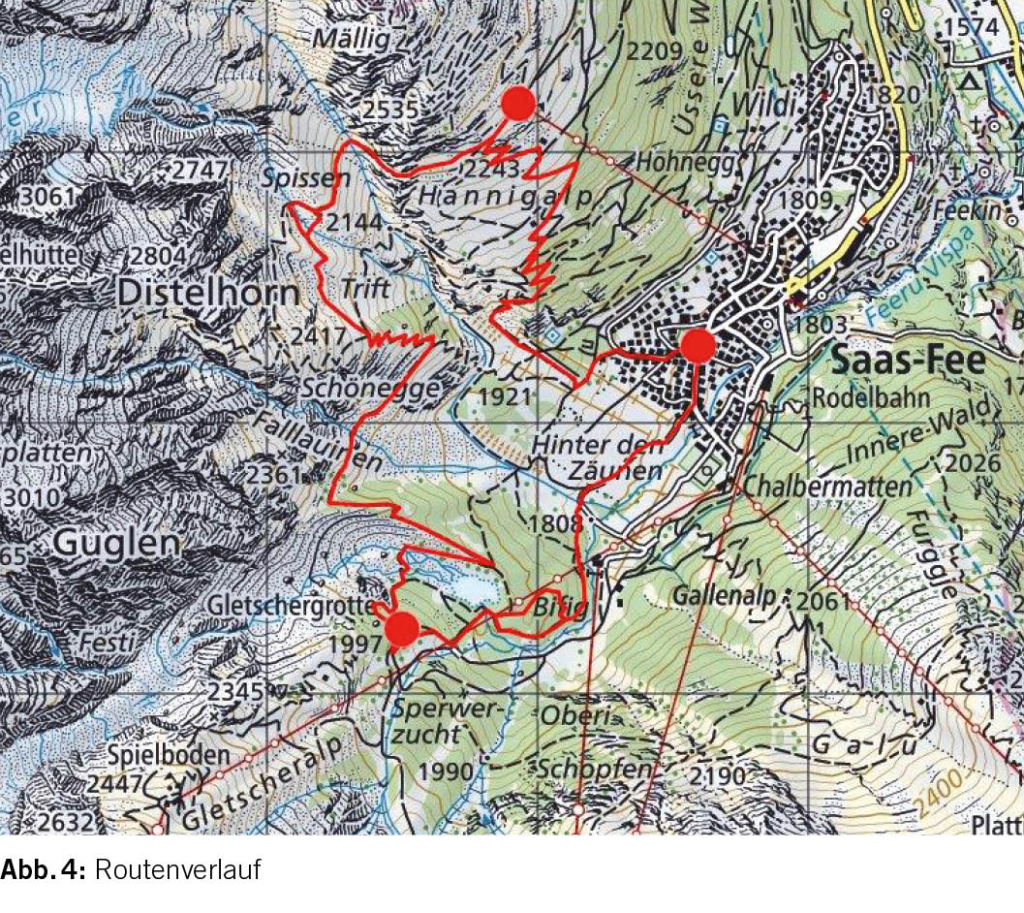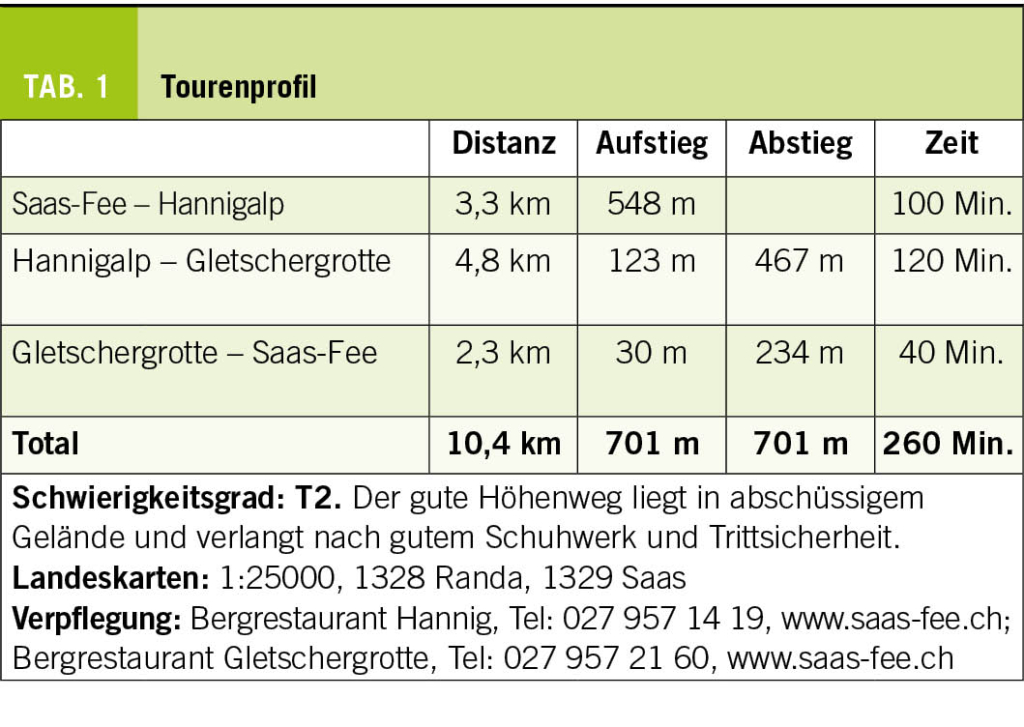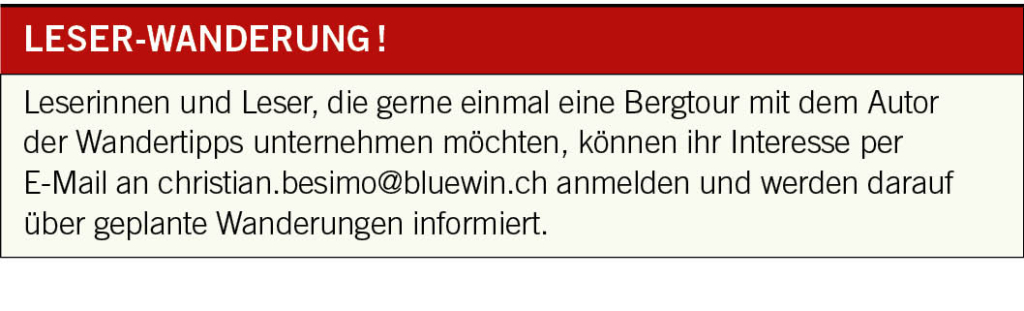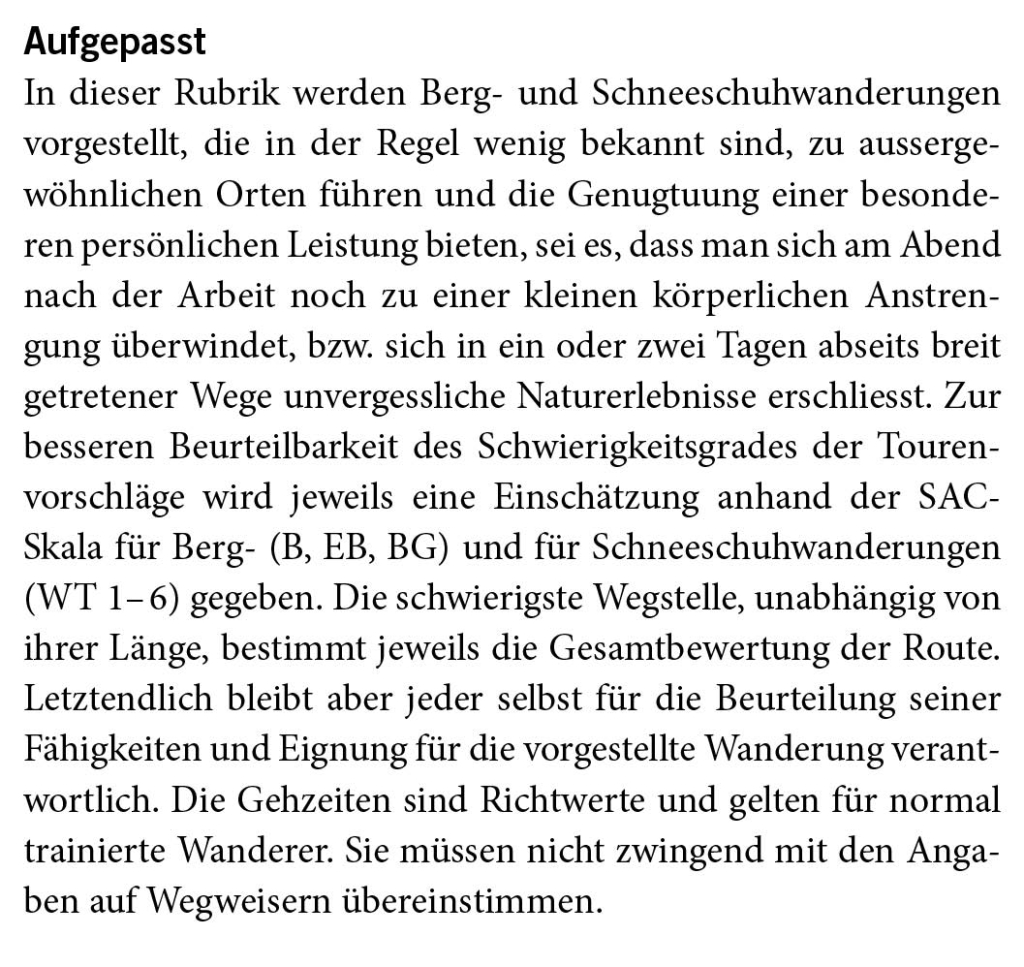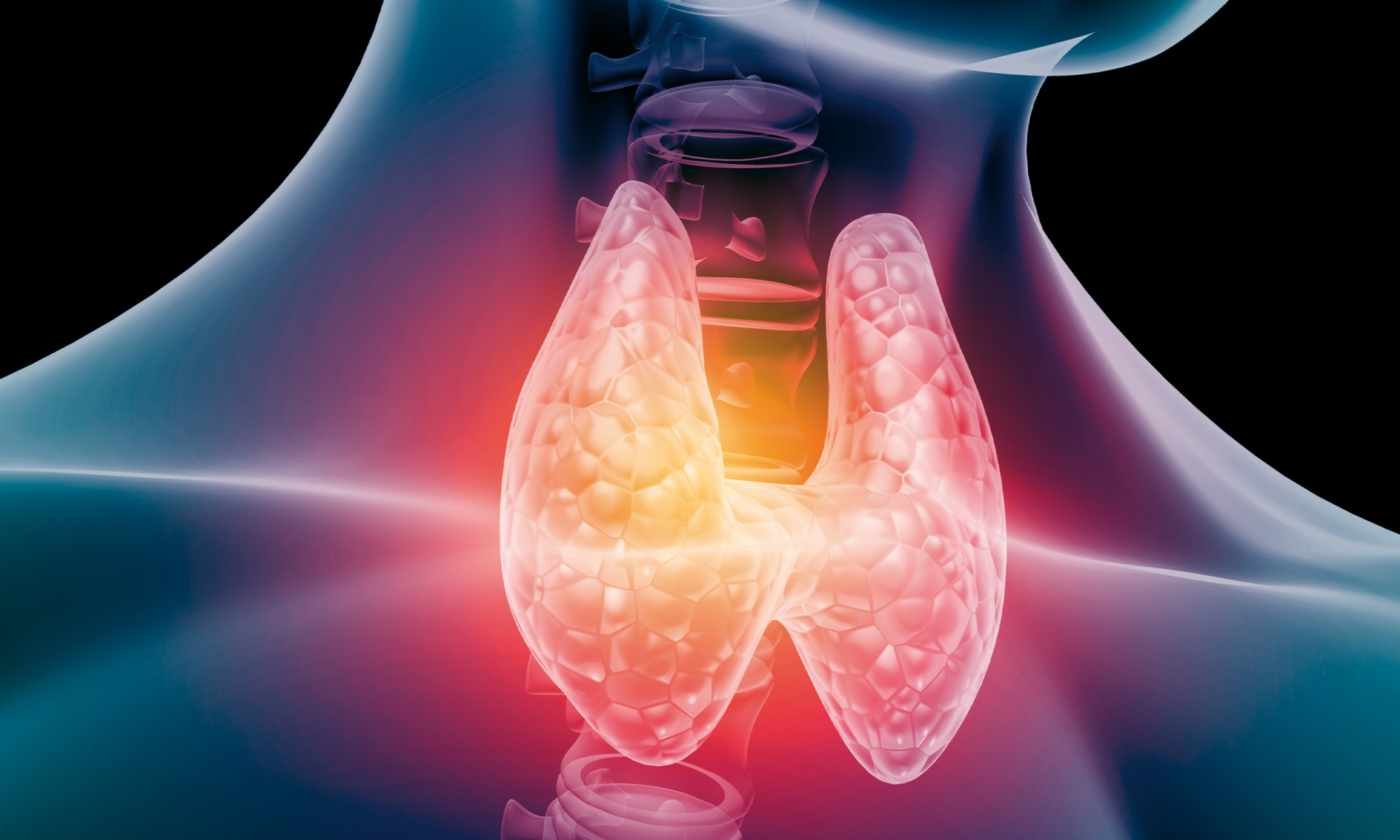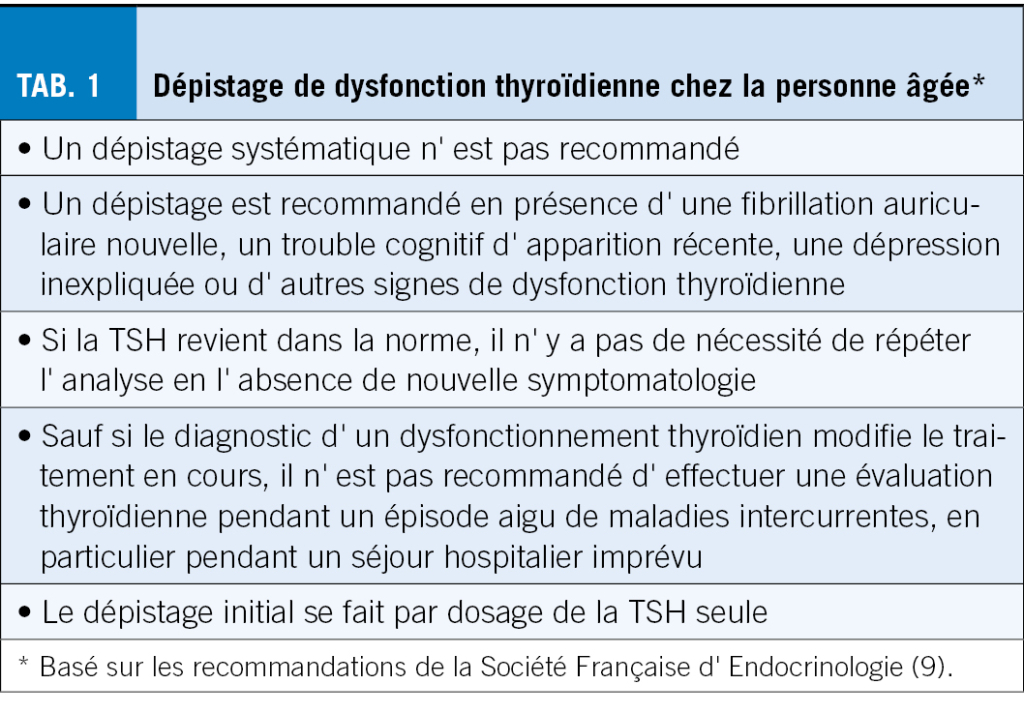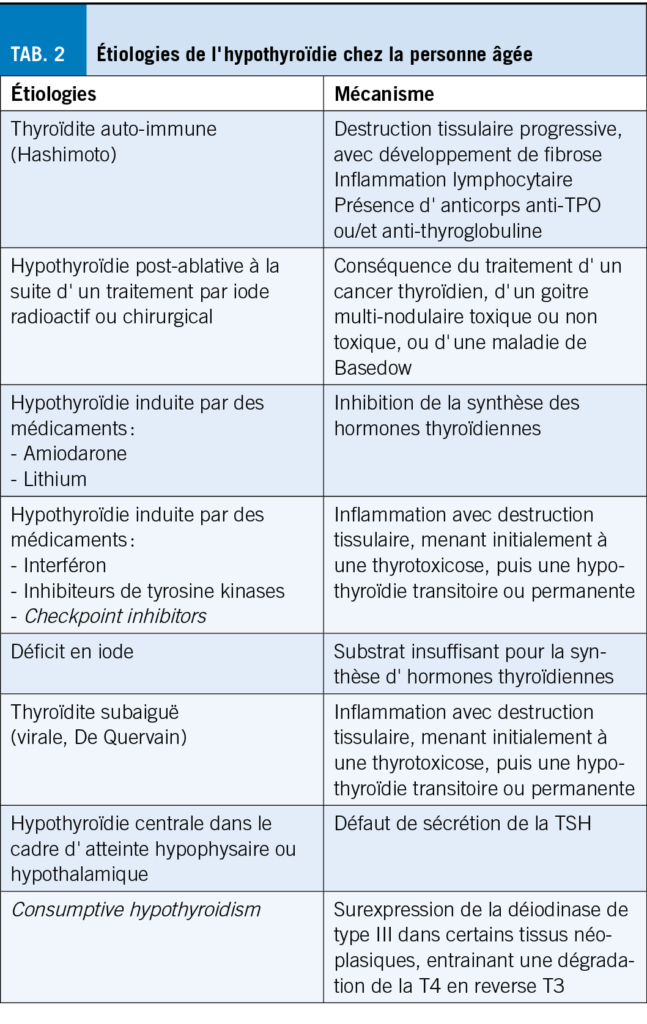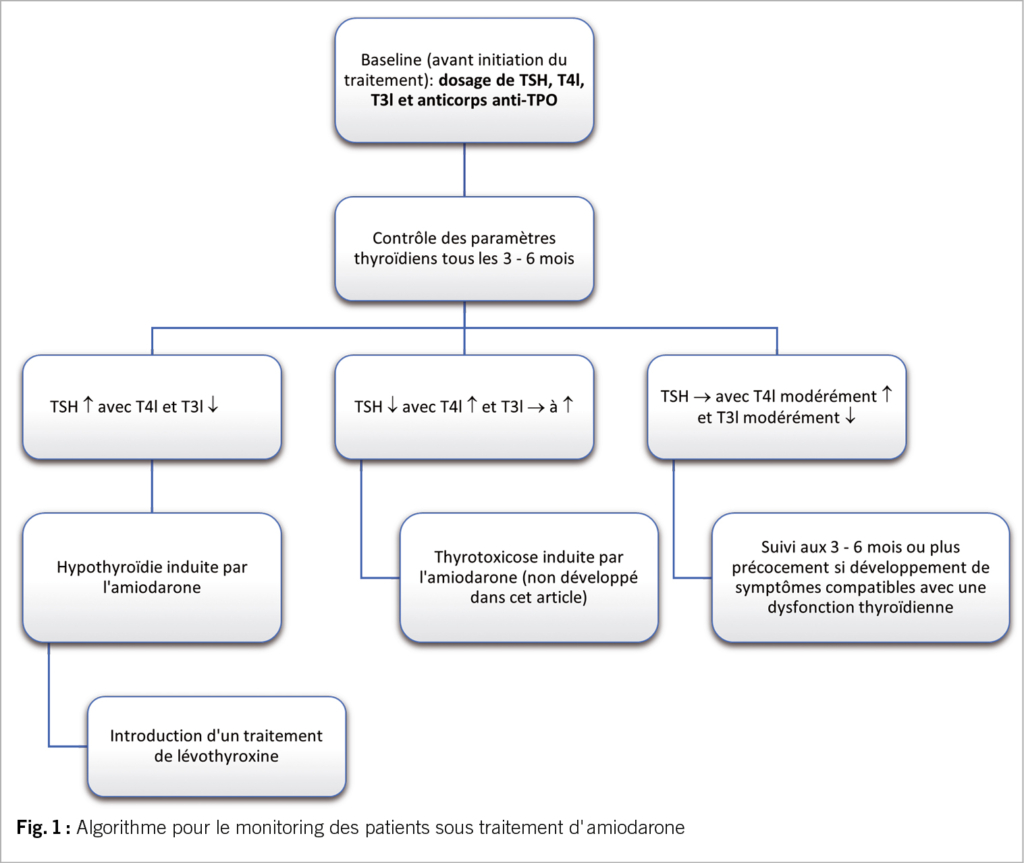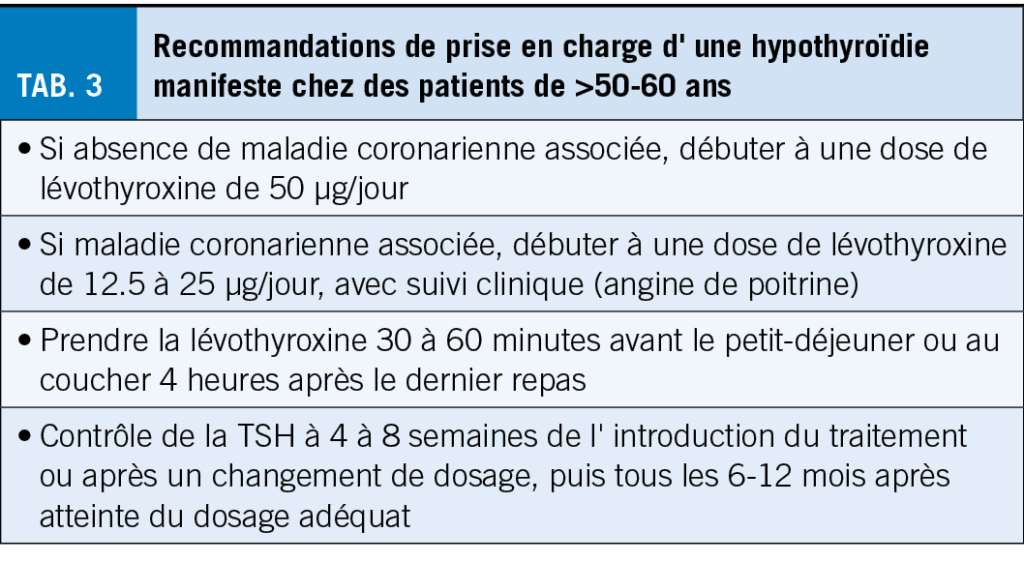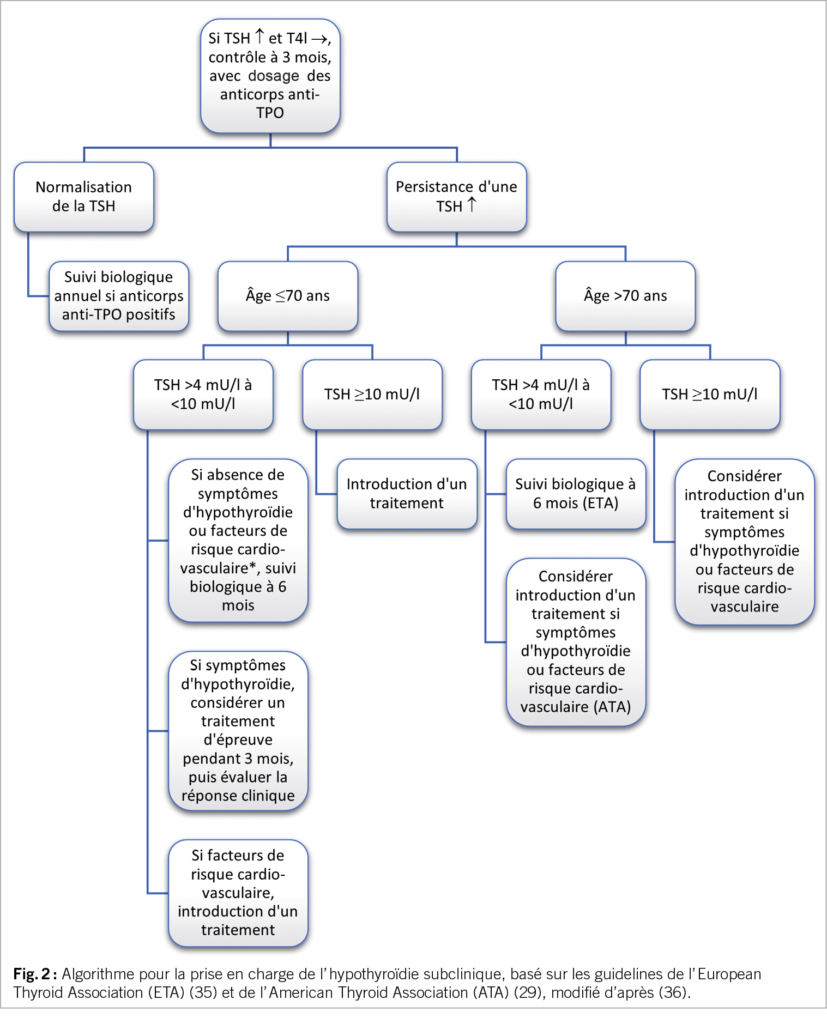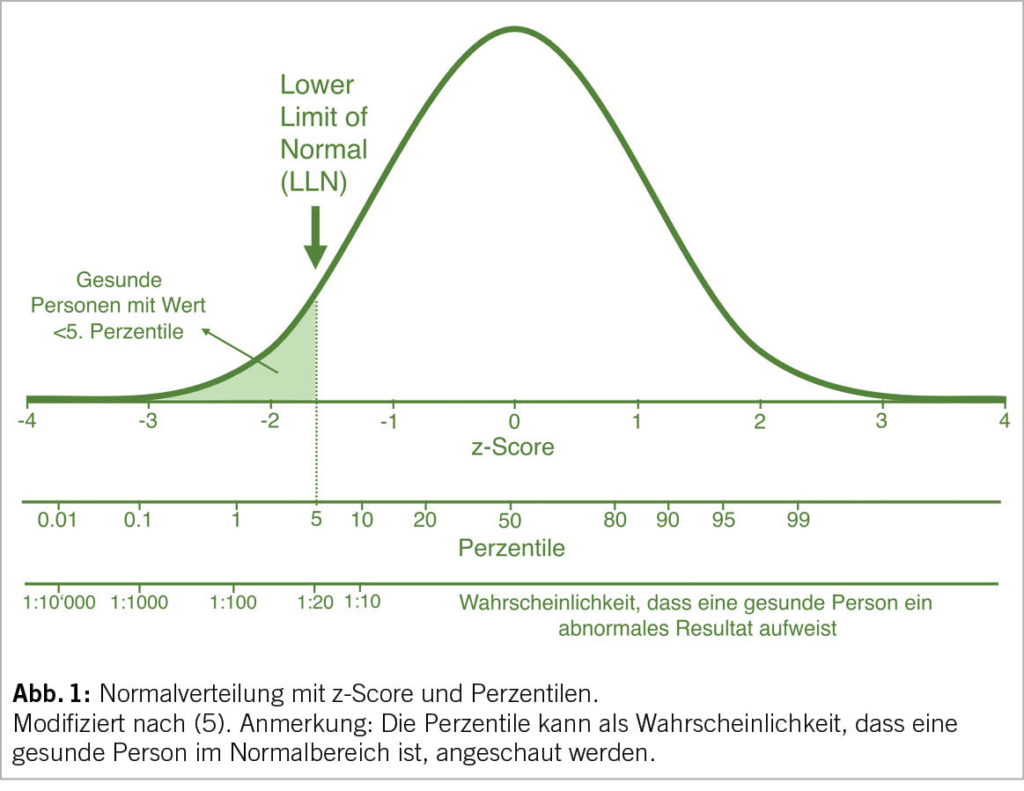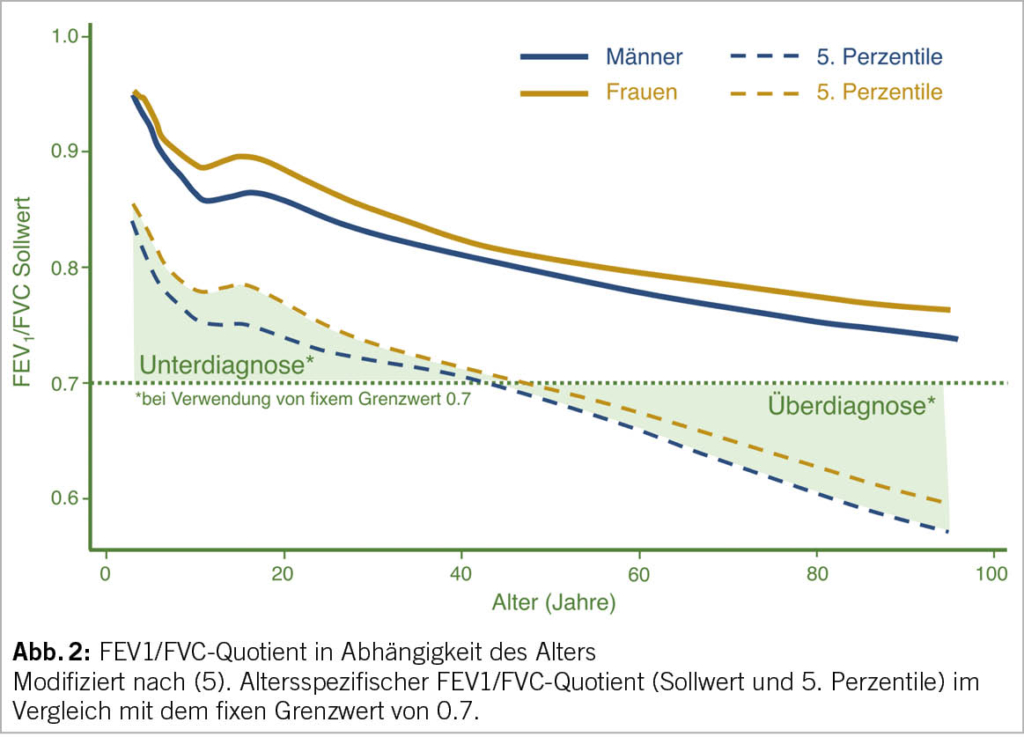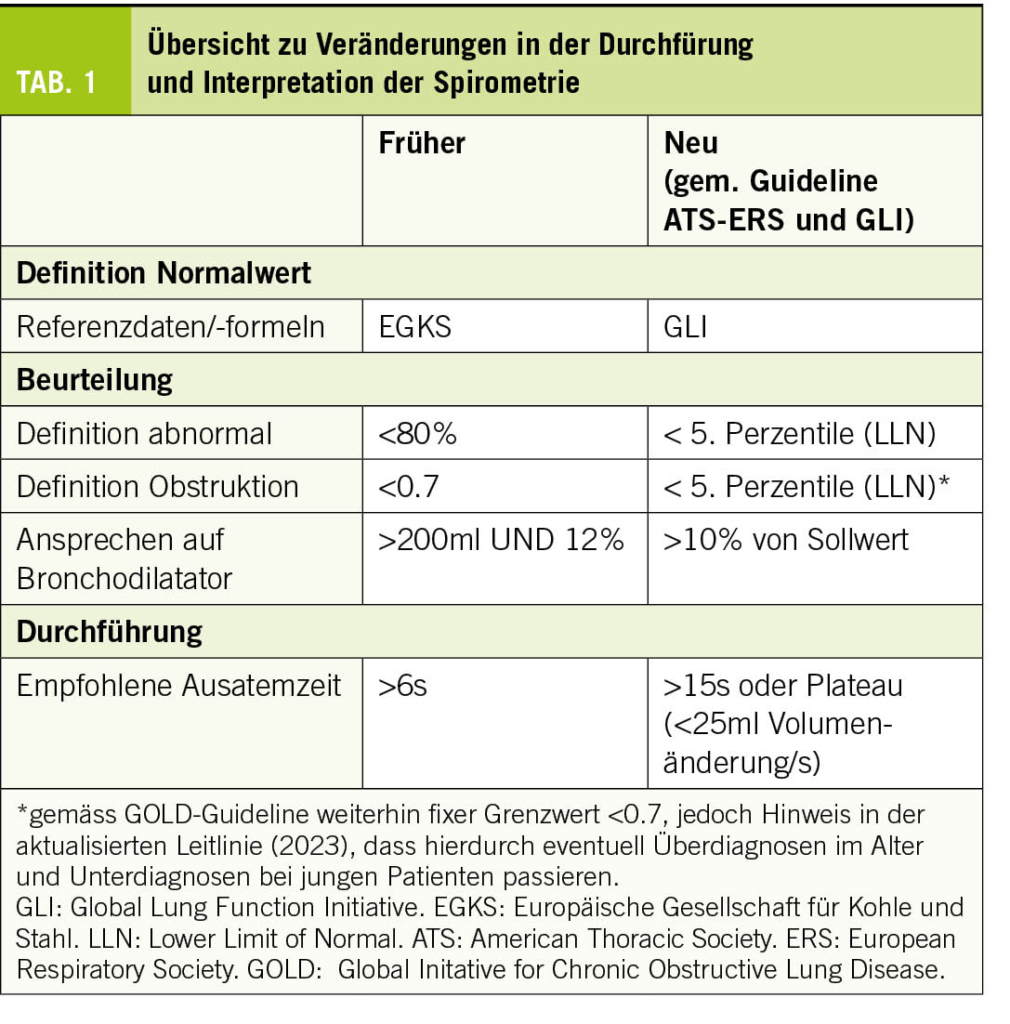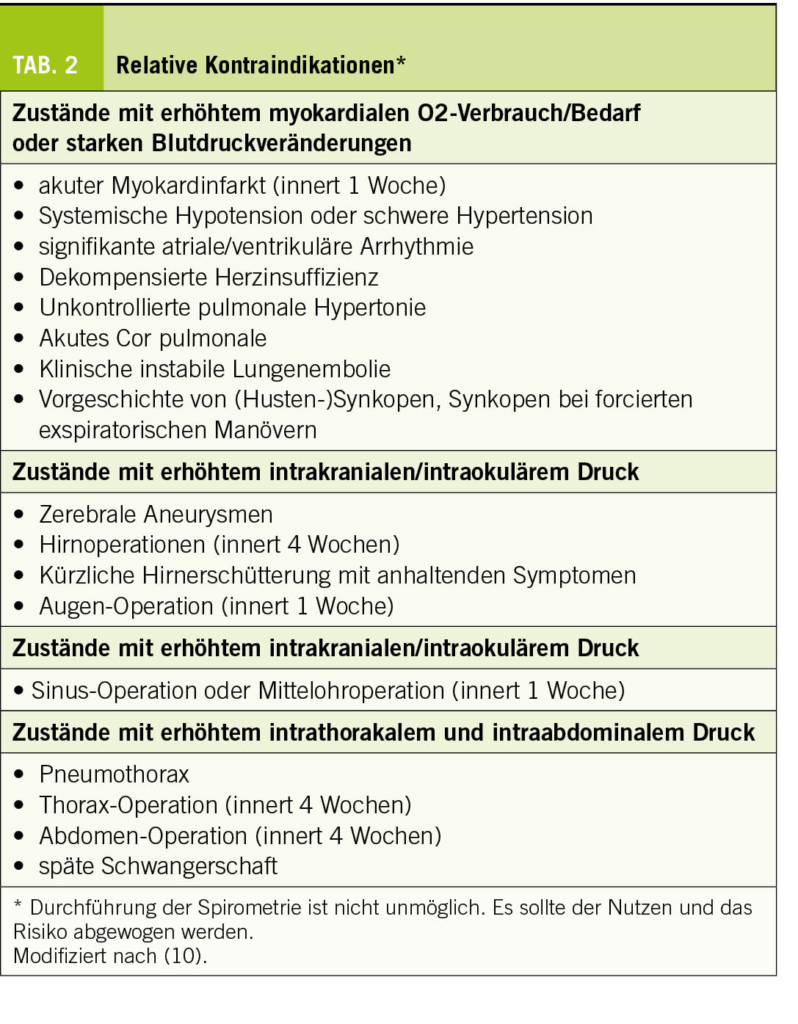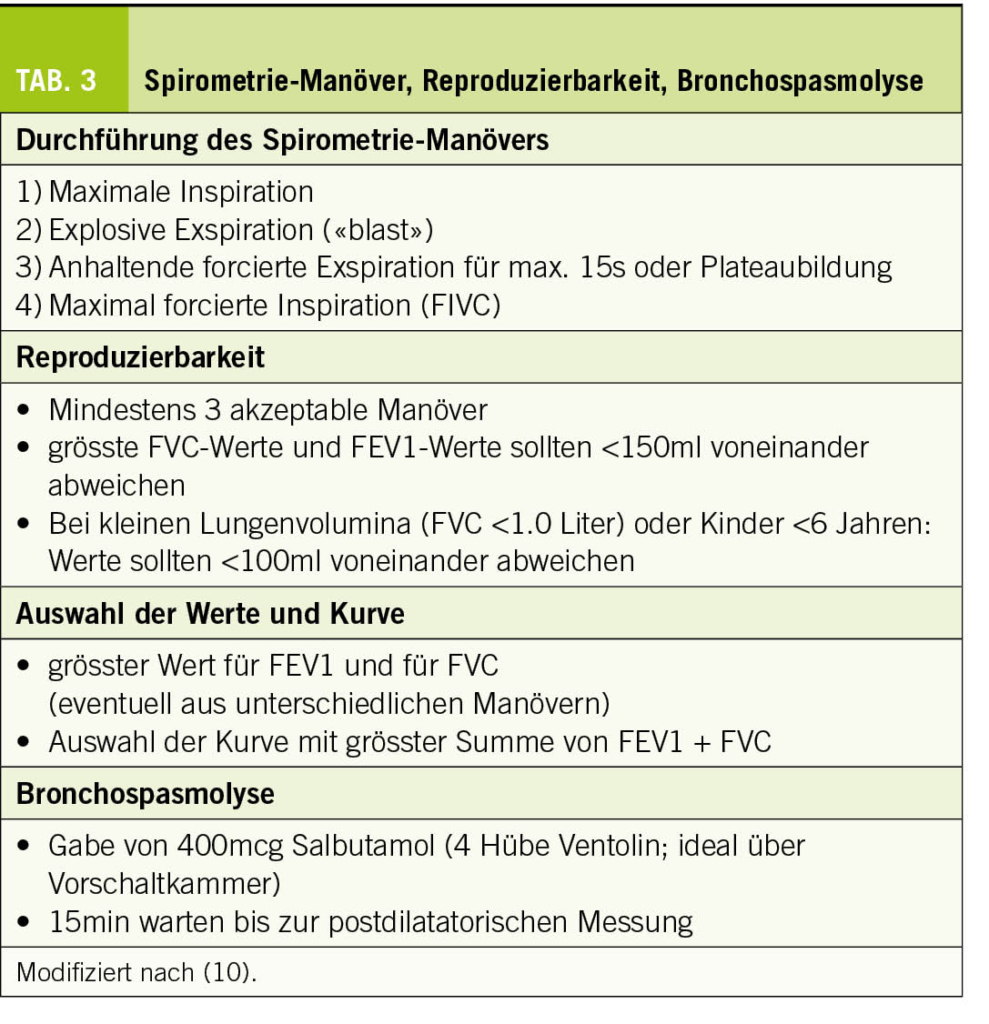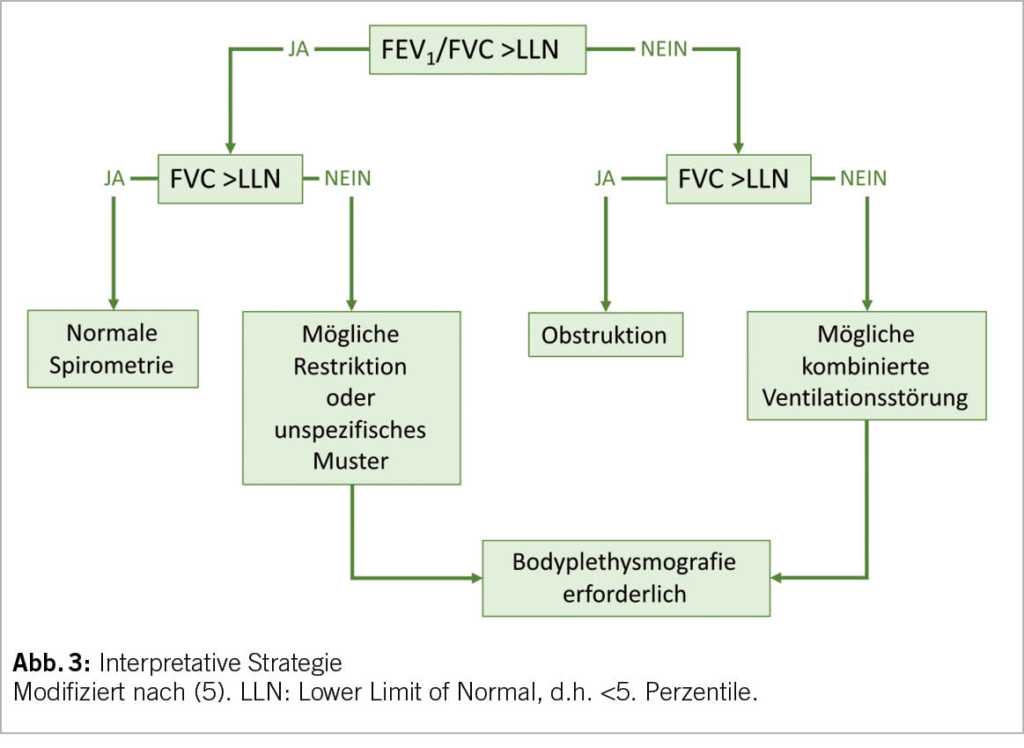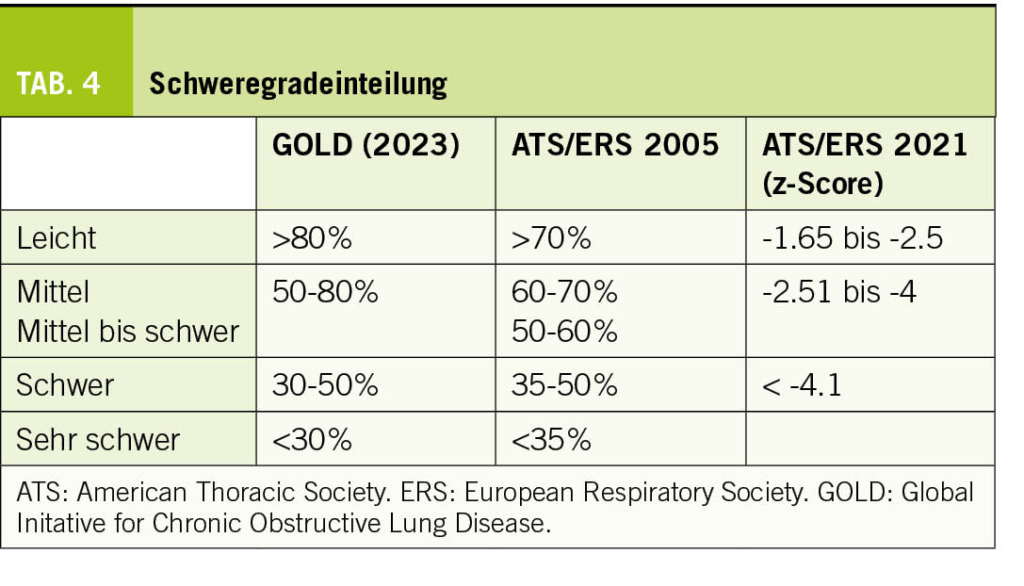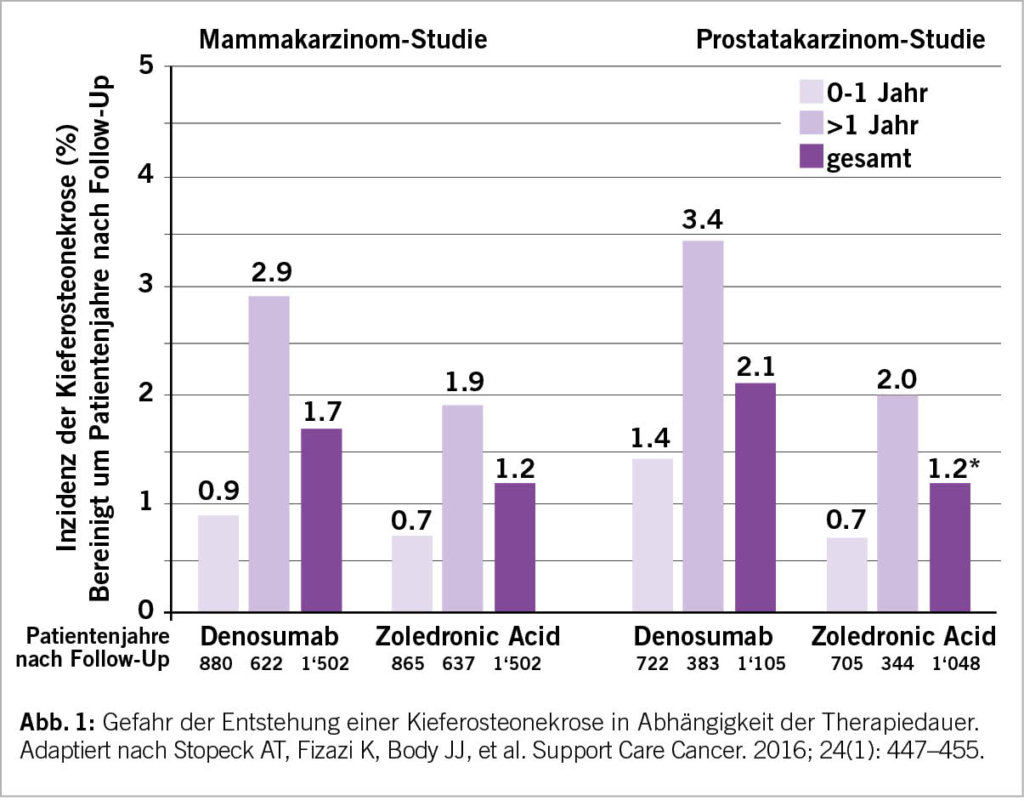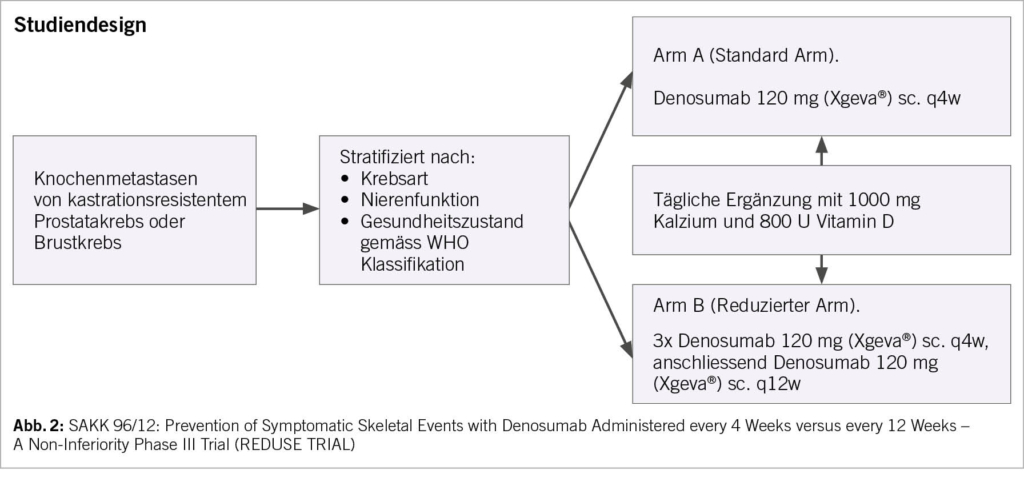Seit bald zwanzig Jahren wird über den Einsatz von Single Pills (SP/Polypills) diskutiert. Im Jahre 2022 sind weitere bedeutende Studien zu diesem Thema erschienen. Zusammenfassend verbessert eine Einzeltablette mit verschiedenen Wirkstoffen (u.a. BD-Senker, Statin, Aspirin) die Adhärenz resp. die Compliance (Therapietreue), dadurch kommt es u.a. zu einer Verbesserung der kardiovaskulären Risikofaktoren Blutdruck und LDL. Diese und zusätzliche pleiotrope und vaskuläre Effekte führen zu einer deutlichen Verbesserung des Outcomes mit Senkung der kardiovaskulären (cv) Ereignisse und der Mortalität. Auch die Folgekosten werden durch diese Therapie-Strategie deutlich gesenkt. Der Einsatz von SP ist daher wirtschaftlich und zweckmässig.
Aktuell gibt es bei uns im Alltag verschiedene Kombinationstabletten bei der Behandlung der Hypertonie. Diese werden auch gemäss Leitlinien primär empfohlen. Nur 50% aller Hypertoniker erreichen den geforderten Ziel-BD. Dabei erhalten leider nur ca. 1/3 eine Kombinationstherapie als SP. Es gibt in der Schweiz nur wenige Antihypertensiva z.B. in Kombination mit Atorvastatin als SP. Bekannt ist auch die Kombination eines Statins mit Ezetimib. Da diese Substanzen als Generika zur Verfügung stehen, ist eine SP nicht wesentlich teurer. Die Adhärenz der Patienten wird leider deutlich überschätzt. Nach einem Myokardinfarkt nehmen weniger als 50% das für die sekundäre cv-Prävention verschriebene Multimedikamentenregime konsequent ein. Daher sollte eine oder mehrere SP in Zukunft der Normalfall sein.
Neuere Studien belegen klar den Nutzen mit obigen Resultaten (1-8). In der START- und START 2.0-Studie (1, 2) wurden Krankenversicherungsdaten bei 29’668 Herzkreislauf-Patienten (Hypertoniker) in Deutschland retrospektiv analysiert. Die Real Life Daten ergeben, dass die Gesamtmortalität, verschiedene cv-Ereignisse und die Hospitalisationsrate durch sieben Kombinationen von SP mit Antihypertensivas, Lipidsenkenden Medikamenten und auch Aspirin signifikant reduziert wurde, verglichen mit der Gabe von losen Einzelsubstanzen. Die Zeit bis zum ersten Ereignis wurde verlängert. Die Therapietreue war signifikant besser und die Gesamtkosten waren deutlich tiefer.
In der spanischen Studie NEPTUNO (3) wurden Daten elektronischer Krankengeschichten, ebenfalls retrospektiv, in der Sekundärprävention wegen atherosklerotischen, kardiovaskulären Erkrankungen analysiert. Durch eine Kombinationstablette von Aspirin 100mg, Atorvastatin 20 oder 40mg und Ramipril 2,5/5/10mg wurden die cv-Ereignisse über zwei Jahre um 15% vermindert verglichen mit der Gabe von Monosubstanzen. Auch traten diese später auf. Die Risikofaktoren BD und LDL waren bei guter Therapietreue besser eingestellt.
In der SECURE Study (4), der ersten prospektiven europäischen Interventions-Studie, ergaben sich eindrucksvolle Resultate in der Sekundärprävention nach einem Myokardinfarkt vor max. 6 Monaten und einem weiteren cv-Risikofaktor. Diese wurde am ESC 2022 in Barcelona vorgestellt. Verglichen wurde eine Single Pill mit drei Wirkstoffen vs. der Einnahme dieser drei Wirkstoffe als Einzelsubstanzen: Aspirin 100mg, Atorvastatin 20 oder 40mg und Ramipril in aufsteigender Dosierung 2,5-10mg bei insgesamt 2499 Patienten (Durschnitt 76 Jahre, 31% Frauen). Der primäre Endpunkt (nicht tödlicher Myokardinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall, cv-Tod und Notfallrevaskularisationen) wurde um 24% über 3 Jahre gesenkt. Der härteste Endpunkt: der cv-Tod um 33%. Es werden bei gleichem BD und LDL in beiden Gruppen zusätzliche pleiotrope Effekte der Statine und vaskuläre Effekte von Aspirin und Ramipril vermutet. Bei einer längeren Nachbeobachtung wäre der Unterschied wahrscheinlich noch grösser.
In einer Arbeit aus Italien (5) bei arterieller Hypertonie konnten die kardiovaskulären Ereignisse und die Gesamtmortalität in fünf verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten über 10 Jahre deutlich gesenkt werden.
In der PolyIran Studie (6) konnte mit einer niedrig dosierten Fixkombination von 4 Wirkstoffen bei Menschen älter als 50 Jahre meist ohne bekannte Herzkreislauferkrankungen über 5 Jahre im ländlichen Iran die Ereignisrate um 1/3 gesenkt werden. Lebensstilintervention vs. Lebensstilintervention und Polypill. In der Primärprävention und bei hoher Compliance relative Risikoreduktion sogar um 40%.
Die TIPS-3 Studie von S. Yusuf et al. zeigte in der Primärprävention, dass eine kombinierte Behandlung mit einer SP plus Aspirin zu einer geringeren Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse führte als Placebo bei Teilnehmern ohne Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ein mittleres kardiovaskuläres Risiko hatten (7). Die primärpräventive Wirkung hatte gemäss HOPE-3 Studie bei intermediärem cv Risiko und einem Alter >55 Jahren vor allem die Lipidsenkung (8).
Somit zeigen uns diese Publikationen, dass eine Single Pill im Praxisalltag ein sehr hilfreiches und einfaches Instrument ist, um die Adhärenz des Patienten/der Patientin deutlich zu verbessern und dadurch Outcome und Folgekosten positiv zu beeinflussen. Es ist zu hoffen, dass weitere Wirkstoff-Kombinationen in verschiedenen Dosierungen als Single Pill, neben den bereits vorhandenen Kombinationen in der Hypertoniebehandlung, in der Primär- und Sekundär-Prävention zum Wohle unserer Patienten auch in der Schweiz auf den Markt kommen und von uns Ärzten vermehrt gezielt und richtig eingesetzt werden. Es bedarf einem Konzeptwechsel von vielen Einzeltabletten auf eine oder mehrere SP. Durch verschiedene Dosierungen und Kombinationen ist auch eine individualisierte Medizin möglich. Eine Medibox kann für die Therapietreue und damit ein besseres Outcome ebenfalls behilflich sein.
Zelglistrasse 17
8127 Forch
u.n.duerst@ggaweb.ch
1. Wilke T. et al.: Effects of Single Pill Combinations compared to identical Multi Pill Therapy on Outcomes in Hypertension, Dyslipidemia and Secondary Cardiovascular Prevention: The Start-Study; Integrated Blood Pressure Control 2022:15-21
2. Weisser B. et al.: Single pill treatment in daily practice is associated with improved clinical outcomes and all-cause mortality in cardiovascular diseases: results from the START project. Poster presented at the ESC Congress 2022, 26. August 2022, Barcelona
3. González-Juanatey JR. et al.: The CNIC-Polypill reduces recurrent major cardiovascular events in real-life secondary prevention patients in Spain: The NEPTUNO study; Int J Cardiol 2022; 361:116-123
4. Castellano J.M. et al.: Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention; NEJM 2022;387:967-977
5. Borghi C. et al.: International Journal of Cardiology Cardiovascular Risk and Prevention 2021; 10:200102
6. Roshandel G et al.: Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran): a pragmatic, cluster-randomised trial. Lancet 2019; 394:672-83
7. Yusuf S. et al.: Polypill with or without Aspirin in Persons without Cardiovascular Disease NEJM 2021;384: 216-228
8. Yusuf S. et al.: Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk Persons without Cardiovascular Disease. NEJM 2016; 374: 2021-2031.