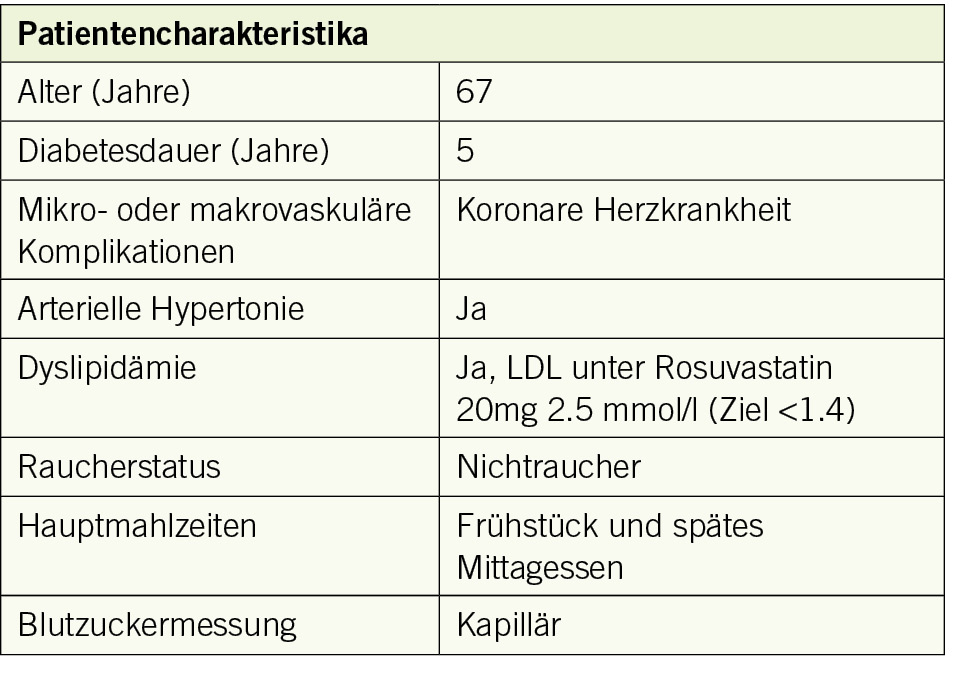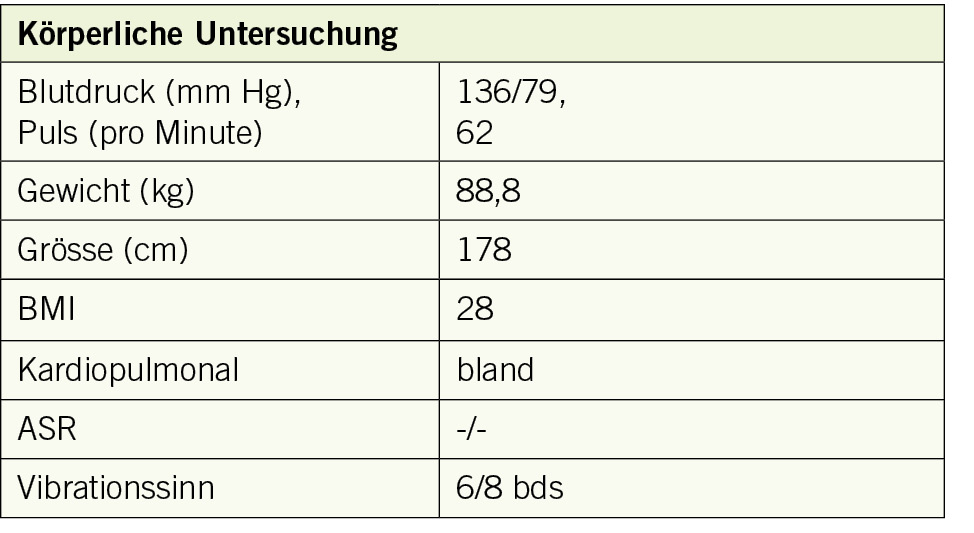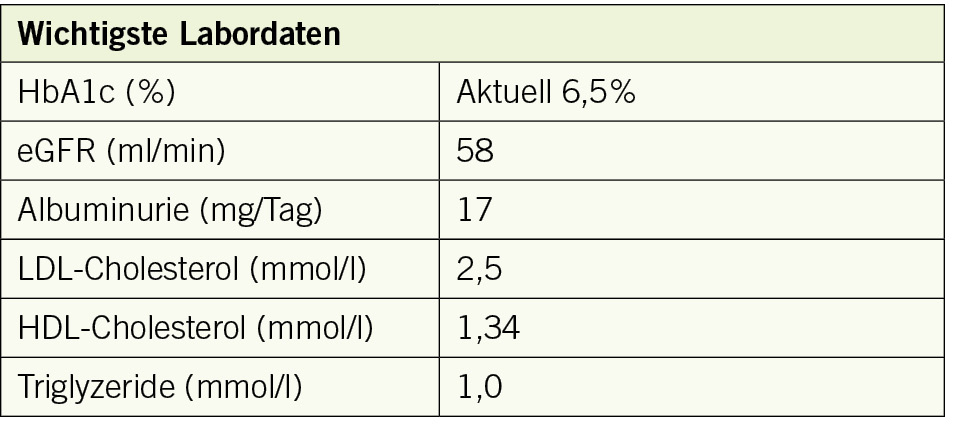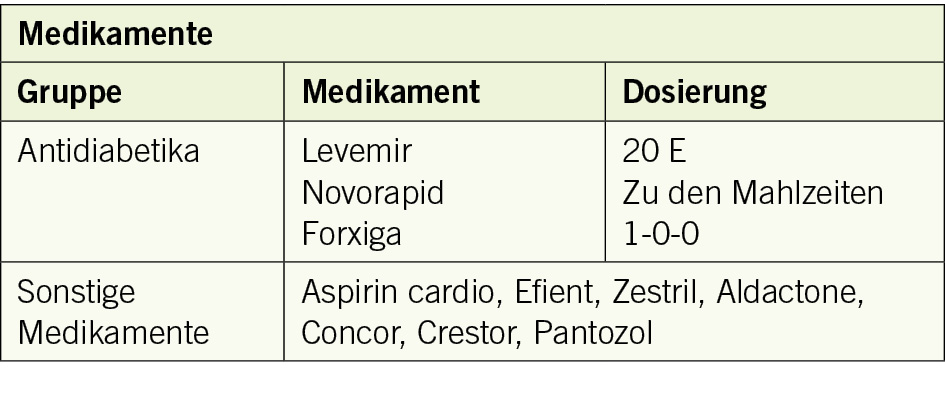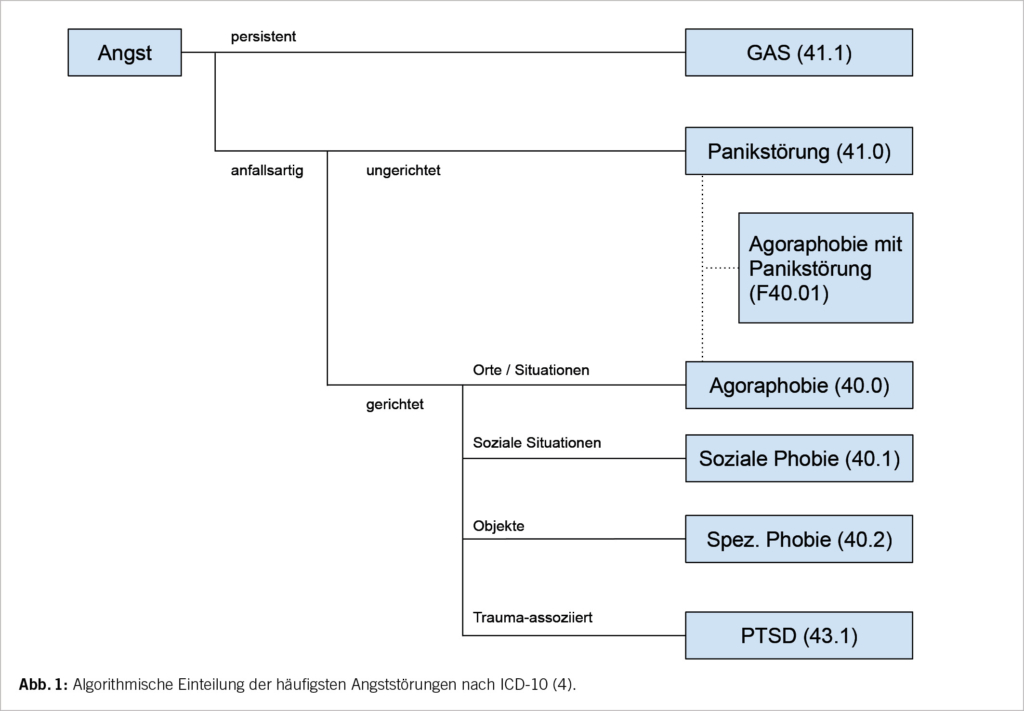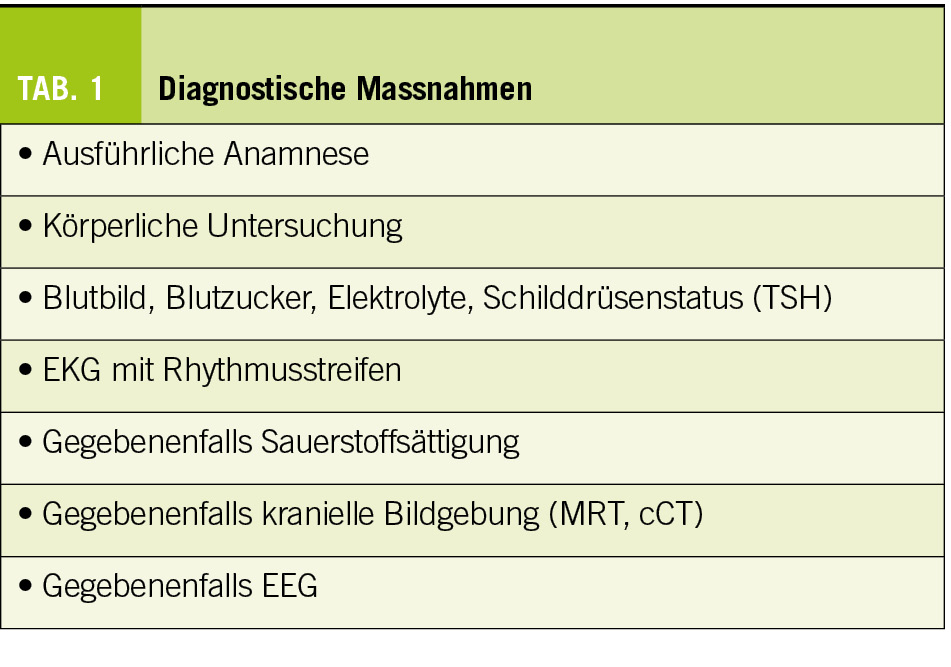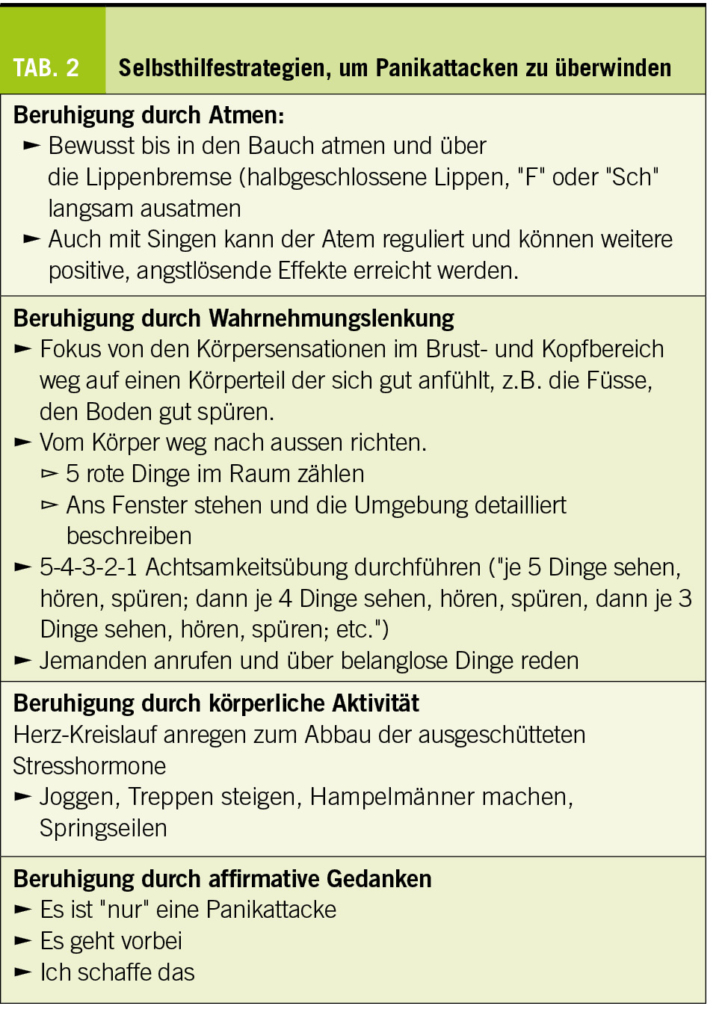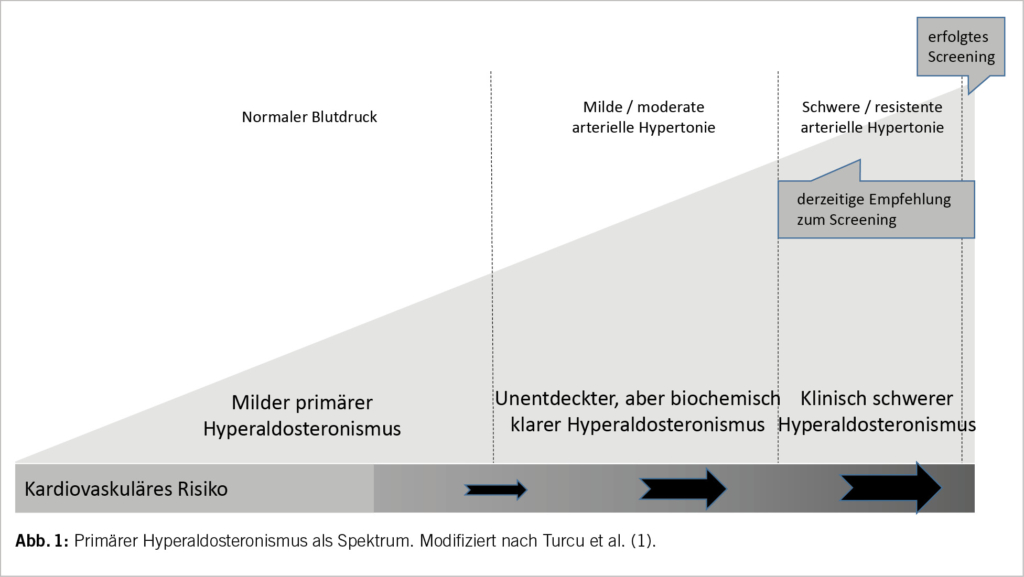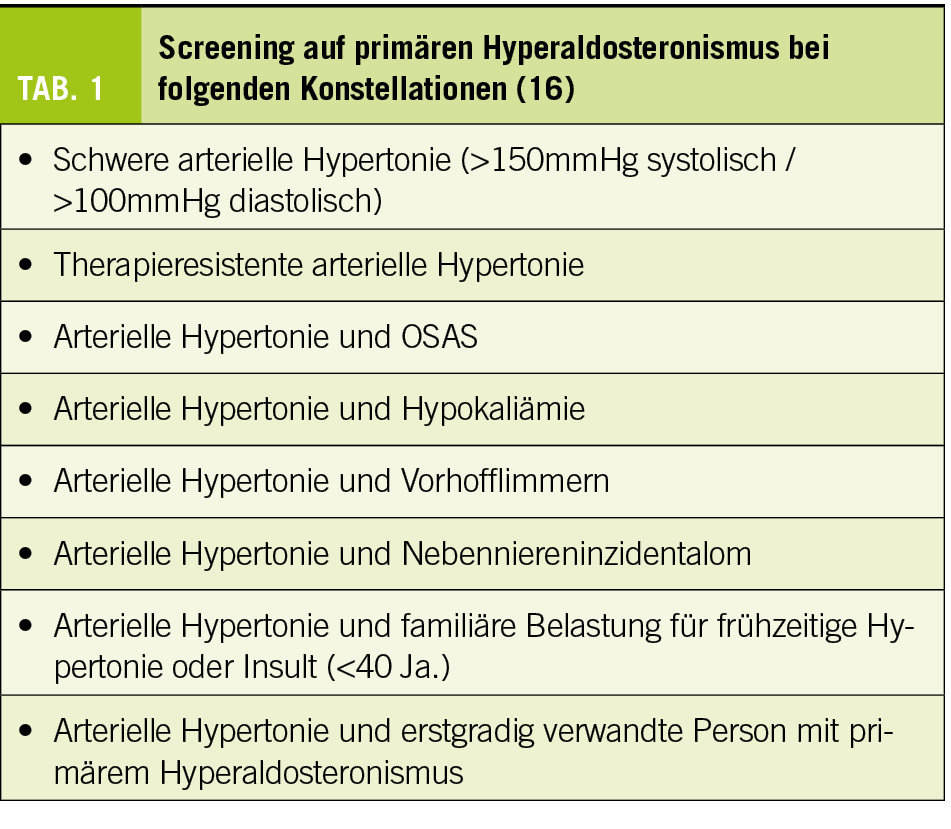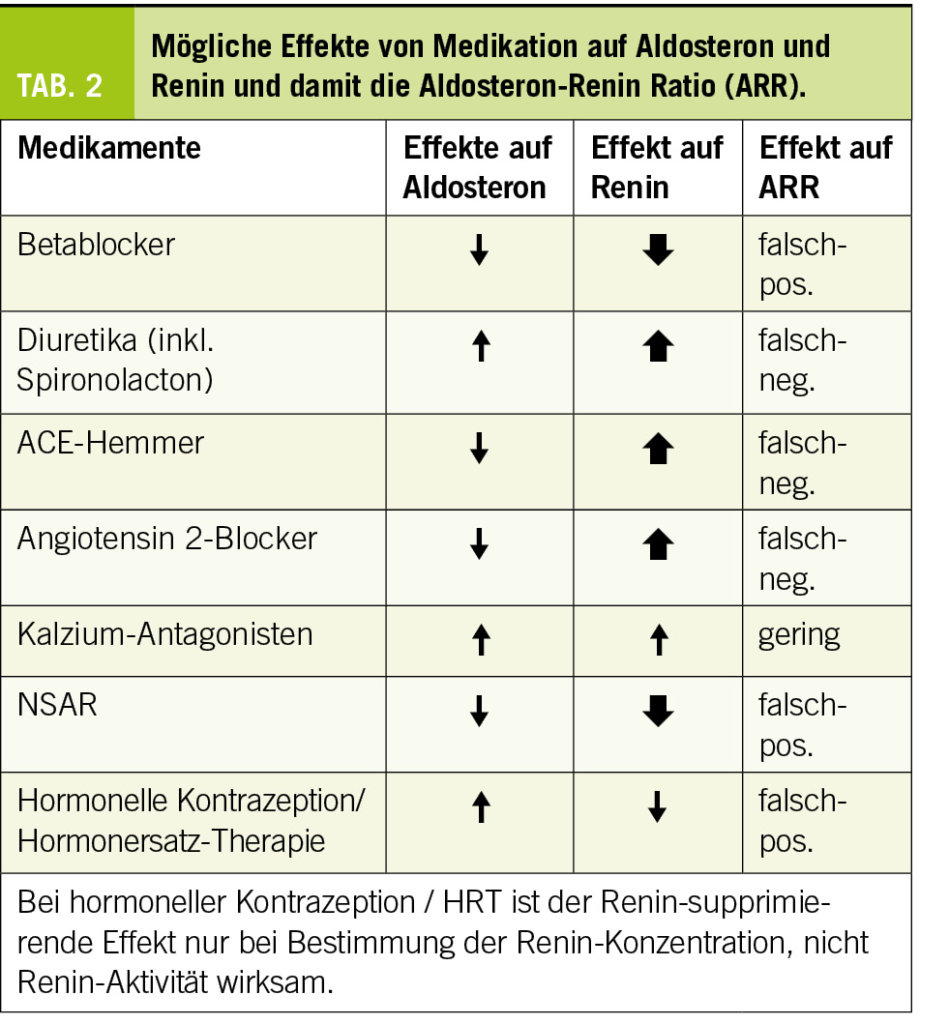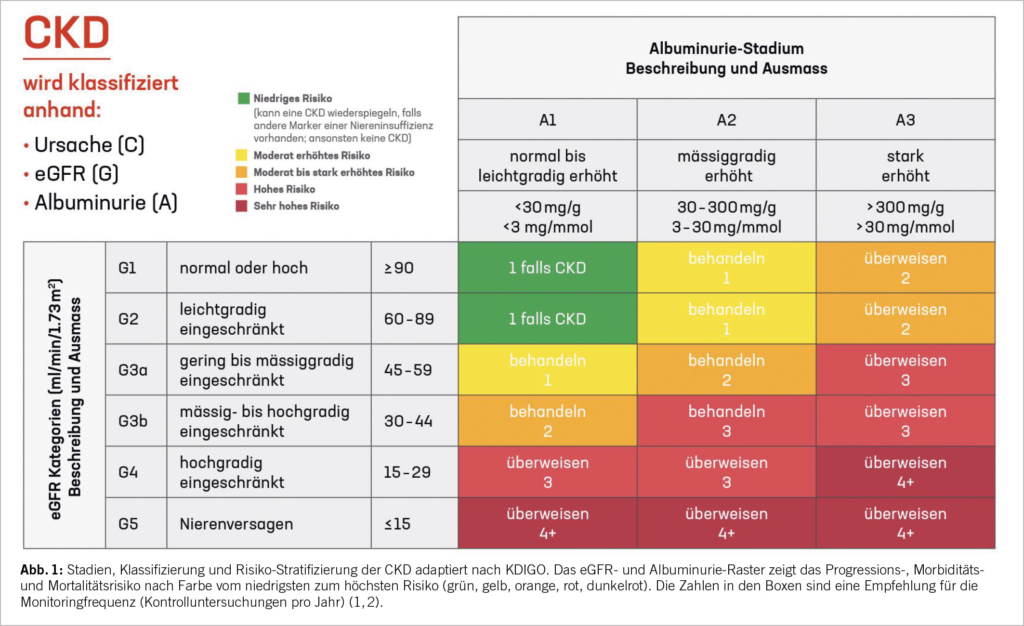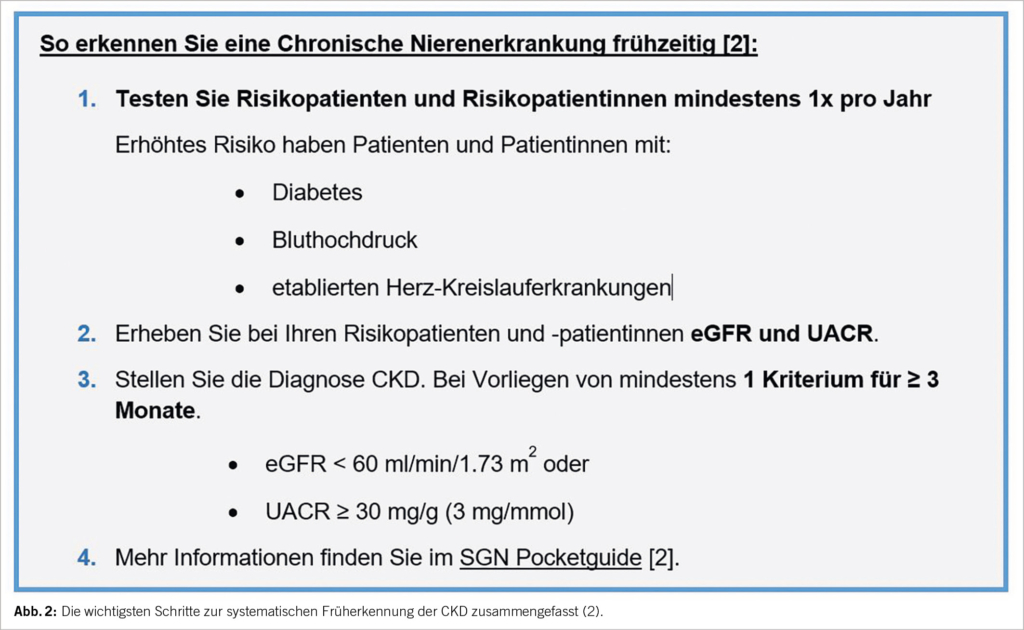COPD und Asthma
Frühe Diagnose und adäquate Behandlung samt Patientenschulung hat positive Effekte für Patienten und auf die Gesundheitskosten
Hintergrund: Es gibt klare Hinweise, dass bei vielen Menschen – die Zahl ist von Land zu Land unterschiedlich – die Diagnose eines Asthma bronchiale oder einer chronisch obstruktiven Bronchitis (COPD) nicht oder erst sehr spät gestellt wird. Die Frage ist, ob eine frühe Diagnose für die Patienten einen Vorteil bringt.
Die Identifikation von Patienten mit einem undiagnostiziertem Asthma oder einer nicht diagnostizieren COPD ermöglicht eventuell präventive Massnahmen (Umwelt, Lebensstil), eine Behandlung, um Symptome zu lindern, oder die Wahrscheinlichkeit zukünftige Exazerbationen und Hospitalisationen zu verringern.
Das Ziel dieser Studie war, Menschen mit Atemwegssymptomen mit nicht diagnostiziertem Asthma oder COPD zu identifizieren. Ein weiteres Ziel war zu untersuchen, ob eine frühe Diagnose eines Asthma oder einer COPD und eine entsprechende Therapie die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen für Lungenerkrankungen verringert und die Gesundheit verbessert.
Einschlusskriterien: • Eine Liste mit Telefonnummern in einem definierten Umkreis eines Studienzentrums wurde erstellt; nach dem Zufallsprinzip wurden Nummern angerufen und es wurde gefragt, ob eine Person im Haushalt lebt, die älter als 18 Jahre ist und respiratorische Symptome hat (Dyspnoe, pfeifende Atmung, vermehrte Sputumproduktion, Husten). Alle Personen, die diese Kriterien erfüllten, wurden von der Studienkoordination kontaktiert und alle, die einverstanden waren, füllten einen «Asthmafragebogen» und teilweise auch den COPD-Fragebogen aus. • Patienten mit einem Score von 6 oder mehr im Asthma-Fragebogen oder mit einem Score von 20 oder mehr im COPD-Fragebogen wurden für eine Spirometrie in eines der Studienzentren eingeladen. • Aufgrund der anerkannten Kriterien wurden die Ergebnisse der Spirometrie als Asthma, COPD oder normal klassifiziert.
Ausschlusskriterien: • Patienten mit bekannten Lungenerkrankungen, andere schwere Krankheiten.
Studiendesign und Methode: «Case-finding» Studie (um Patienten zu identifizieren) und randomisierte Studie
Studienort: 17 Orte in Kanada
Interventionen: • Gruppe 1: Behandlung durch einen Pneumologen und «Asthma und COPD educator», behandelt entsprechend den Guidelines (z.B. Medikamente, Aktionsplan, Inhalationsinstruktion) • Gruppe 2: Behandlung bei Grundversorgern, «usual care». • Teilnehmer beider Gruppen erhielten eine Rauchstoppberatung.
Outcome: Primärer Outcome • Inanspruchnahme medizinischer Leistungen wegen Lungenkrankheiten im Jahr nach der Randomisierung.
Sekundäre Outcomes • Krankheitsspezifische Lebensqualität (erfasst mit St. George Fragebogen). • Rauchstopp nach einem Jahr (bestätigt mit Cotinintest)
Resultat: • Über eine Million Personen erhielten einen Telefonanruf, fast 50’000 Personen über 18 Jahre hatten respiratorische Symptome, bei 2857 Patienten wurde eine Spirometrie durchgeführt, bei 595 Patienten wurde ein Asthma oder eine COPD diagnostiziert und 508 Patienten konnten randomisiert werden. • Das mittlere Alter betrug etwa 63 Jahre, etwa 60 % waren männlich; jeweils die Hälfte der Patienten hatten ein Asthma oder eine COPD. Etwa die Hälfte waren Ex-Raucher, ein Viertel waren immer noch Raucher.
• Während der Studienperiode von einem Jahr wurde bei 92 % in der Interventionsgruppe und bei 60 % in der «usual care» Gruppe eine krankheitsspezifische Therapie begonnen. • Die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen war in der Interventionsgruppe deutlich geringer als in der Vergleichsgruppe (0.53 versus 1.12 Ereignisse – Inanspruchnahmen – pro Jahr). • Die Hospitalisationsrate war insgesamt gering, aber in der Interventionsgruppe lag sie um ein Drittel tiefer als in der «usual care»-Gruppe. Die Häufigkeit von Konsultationen einer Notfallstation oder beim Grundversorger waren in der Interventionsgruppe tiefer als in der Vergleichsgruppe. • Auch die Lebensqualität und der Anstieg von FEV1 waren in der Interventionsgruppe, verglichen mit «usual care», höher. • 14 % der Raucher in der Interventionsgruppe und 9 % in der «usual care» Gruppe gaben das Rauchen auf.
Kommentar: • Diese Studie liefert klare Hinweise, dass Menschen mit Atemwegsproblemen (die auf ein Asthma oder eine COPD hinweisen) von einer frühen Diagnose – Asthma oder COPD – und einer fachärztlich geleiteten Therapie mit einer professionellen «Schulung», verglichen zu «usual care», deutlich profitieren. • Die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen (Arztbesuche, Notfallkonsultationen und Hospitalisationen) ist in der Interventionsgruppe deutlich tiefer als in der «usual care»-Gruppe. • Eine frühe Diagnosestellung und adäquate Therapie von Asthma und COPD wäre ein guter Parameter für die Qualitätssicherung in der Medizin.
Prof. em. Dr. med. Johann Steurer
Literatur: Aaron S.D. et al. Early Diagnosis and Treatment of COPD and Asthma – A Randomized, Controlled Trial. N Engl J Med. 2024; 390: 2061-2073.
Blutuntersuchung zur Frühdiagose des Morbus Parkinson
Die Parkinson-Krankheit ist die weltweit am schnellsten zunehmende neurodegenerative Erkrankung mit weltweit etwa 10 Millionen Patienten. Pathophysiologisch wird eine vermehrte Ablagerung von Alpha-Synuclein in Hirnzellen postuliert, welche in histologischen Präparaten als Lewy-Körperchen sichtbar werden. Die Erkrankung beginnt in den dopaminergen Zellen und breitet sich langsam über das Gehirn aus. Die Diagnose der Erkrankung kann heute in einer Liquorprobe durch einen «seed amplification assay» bestätigt werden, der die pathologische Aggregation von Alpha-Synuclein im Labor imitiert.
Die Autoren validierten einen gezielten Multiplex-Massenspektrometrie-Assay für Blutproben von kürzlich diagnostizierten motorischen Parkinson-Patienten (n = 99), prämotorischen Personen mit isolierter REM-Schlafverhaltensstörung (zwei Kohorten: n = 18 und n = 54 longitudinal) und gesunden Kontrollpersonen (n = 36). Bekanntlich schreitet der Morbus Parkinson vom prämotorischen Stadium (gekennzeichnet durch nicht-motorische Symptome wie REM-Schlafstörung) zum behindernden motorischen Stadium fort. Die Expression von acht Proteinen – Granulin-Vorläufer, Mannan-Bindungslektin-Serin-Peptidase-2, Endoplasmatisches Retikulum-Chaperon-BiP, Prostaglandin-H2-D-Isomerase, Intercellular-Adhäsionsmolekül-1, Complement C3, Dickkopf-WNT-Signalweg-Inhibitor-3 und Plasma-Protease-C1-Inhibitor – führte mit einem maschinellen Lernmodell dazu, dass alle Parkinson-Patienten genau identifiziert werden konnten. Zudem klassifizierte das Modell 79 % der prämotorischen Personen bis zu 7 Jahre vor dem motorischen Beginn. Diese acht Biomarker korrelieren auch mit der Schwere der Symptome.
Fazit: Diese acht spezifischen Serum-Proteine weisen auf molekulare Ereignisse in frühen Stadien des Morbus Parkinson hin und könnten helfen, eine Frühdiagnose des Morbus Parkinson zu stellen und klinische Studien zur Verlangsamung/Vorbeugung der motorischen Parkinson-Krankheit im Frühstadium durchzuführen.
KD Dr. med. Marcel Weber
Literatur: Hällqvist J et al. Plasma proteomics identify biomarkers predicting Parkinson’s disease up to 7 years before symptom onset. Nat Commun 2024;15(1):4759-76.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38890280/
Gesunde Ernährung verlangsamt das Tempo des biologischen Alterns und schützt vor Demenz
Von n=1644 eingeschlossenen Teilnehmern (Alter 69.6, 54 % weiblich) der Framingham Cohorte entwickelten n=140 eine Demenz und n=471 starben über 14 Jahre Nachbeobachtung. Gesunde Ernährung hiess in dieser Studie langfristige Einhaltung der Mediterranean-DASH-Intervention für neurodegenerative Verzögerungsdiät (MIND, 15 Nahrungsmittelgruppen, über 4 Konsultationen von 1991–2008). Das Alterungstempo wurde anhand von Blut-DNA-Methylierungsdaten gemessen, die 2005–2008 mit der epigenetischen Uhr DunedinPACE gesammelt wurden. Demenz und Mortalität wurden anhand von Studienaufzeichnungen in den Konsultationen 2005–2008 bis 2018 erfasst.
Ein höherer MIND-Score war mit einem langsameren DunedinPACE und einem geringeren Risiko für Demenz und Mortalität verbunden. Langsameres DunedinPACE korrelierte mit einem geringeren Risiko für Demenz und Mortalität. In der Mediationsanalyse machte das langsamere DunedinPACE 27 % der Diät-Demenz-Assoziation und 57 % der Diät-Mortalitäts-Assoziation aus.
Fazit: Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein langsameres Alterungstempo einen Teil des Zusammenhangs zwischen gesunder Ernährung und einem verringerten Demenzrisiko erklärt. Die Beachtung des Alterungstempos kann die Demenzprävention beeinflussen. Dennoch bleibt ein grosser Teil der Assoziation zwischen Ernährung und Demenz ungeklärt. Es ist denkbar, dass es direkte Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gehirnalterung gibt, welche nicht mit anderen Vorgängen erklärbar sind.
KD Dr. med. Marcel Weber
Literatur: Thomas A. et al. Diet, Pace of Biological Aging, and Risk of Dementia in the Framingham Heart Study. Ann Neurol 2024;95:1069
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38407506/