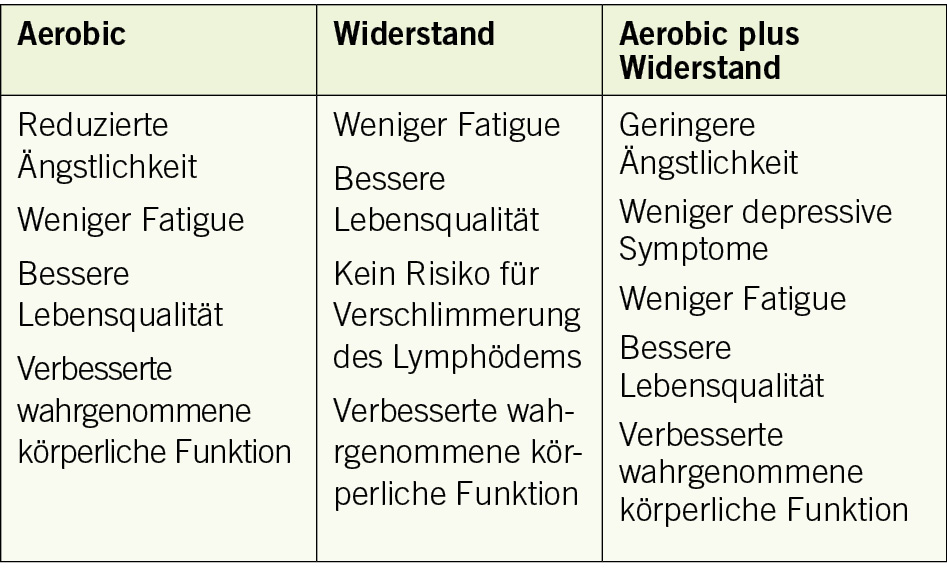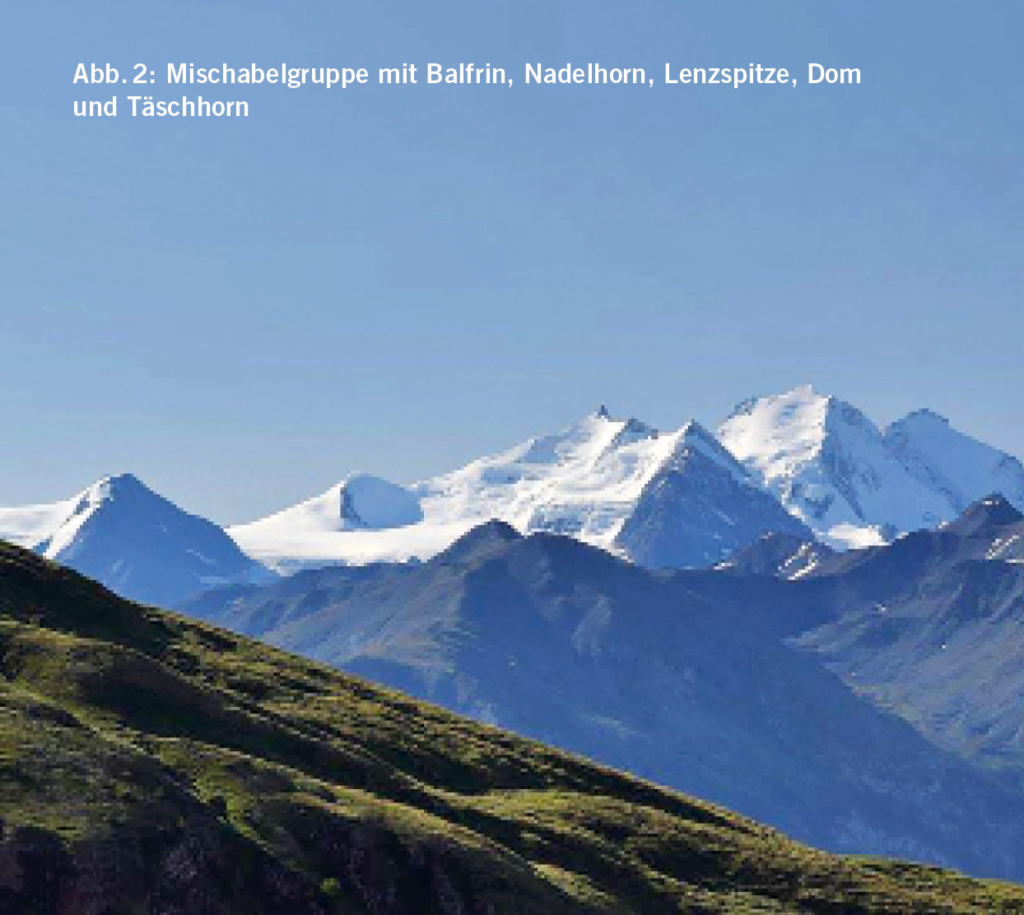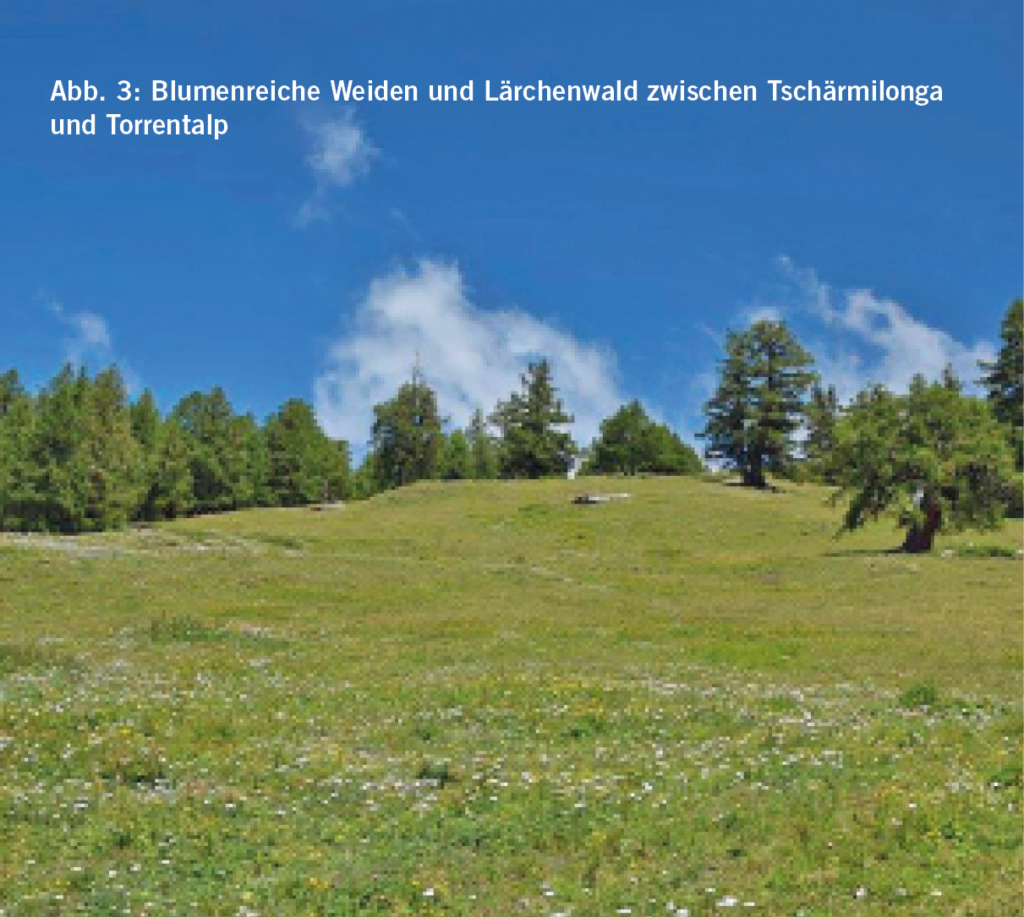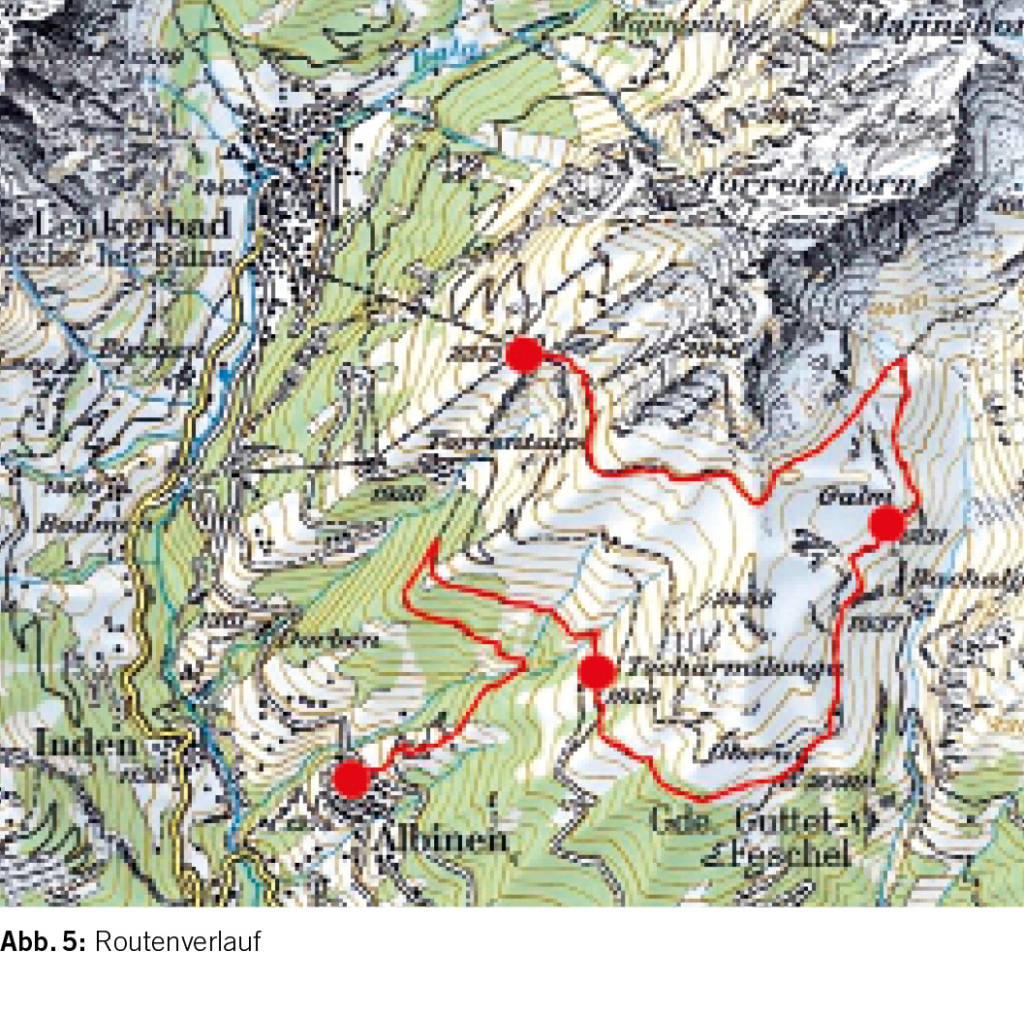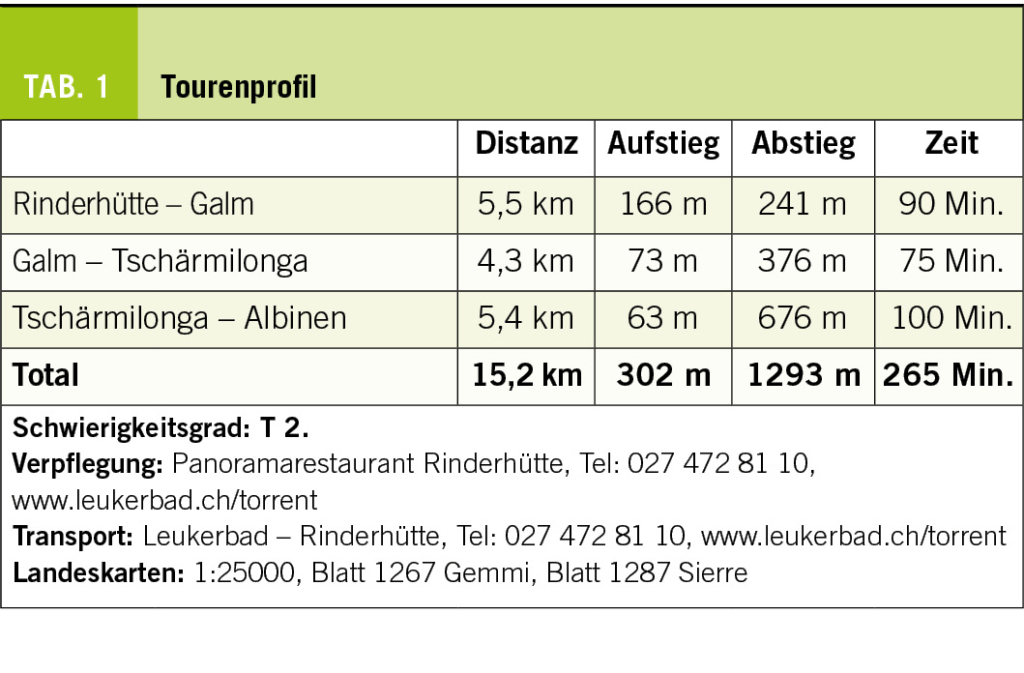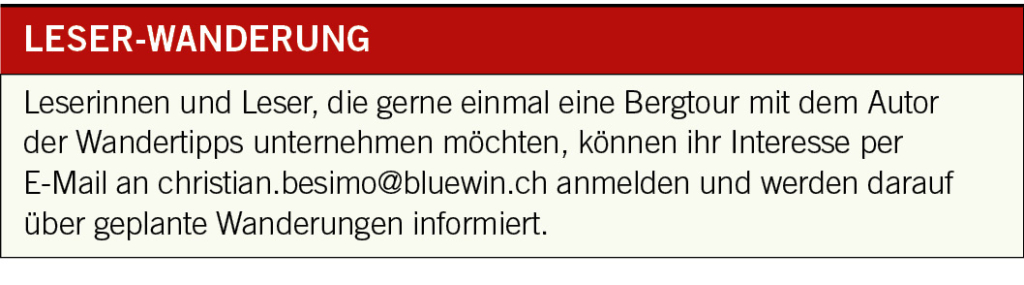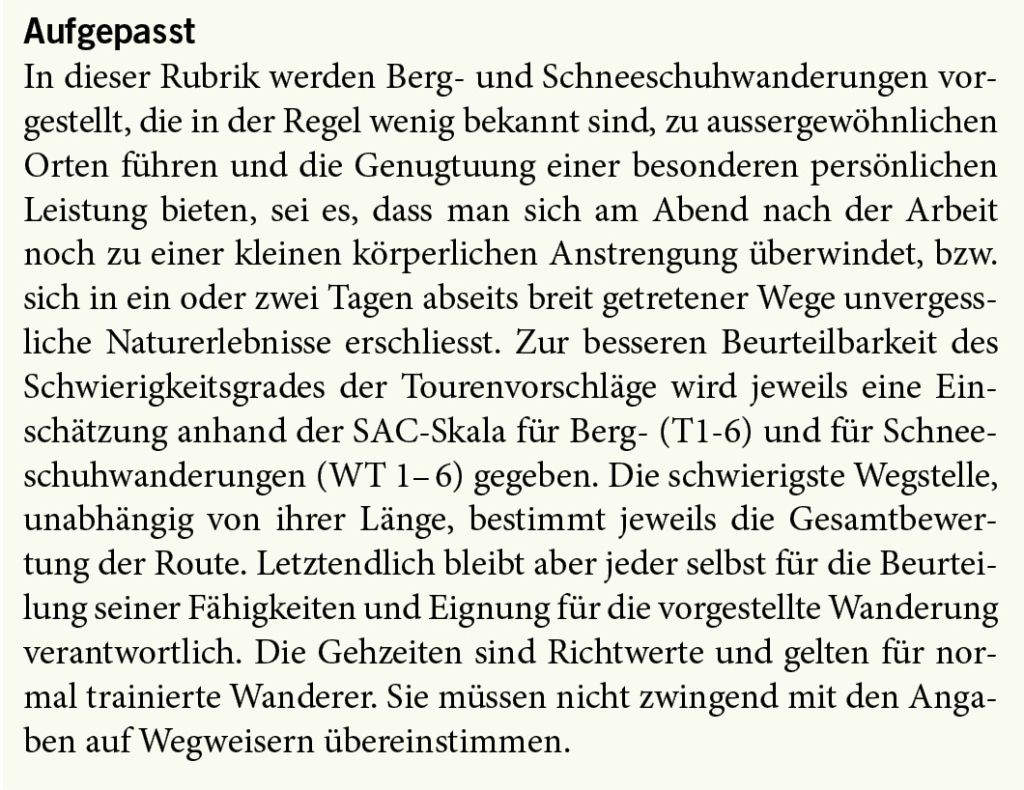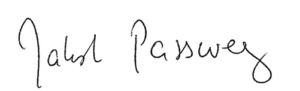Der 63. Ärztekongress in Davos von Lunge-Zürich stand unter dem Motto «interaktiv – interdisziplinär – inspirierend». Dieser Bericht beschäftigt sich mit dem Workshop zum Thema Pneumologie, cystische Fibrose und eosinophile Ösophagitis
Update Pneumologie
Asthma
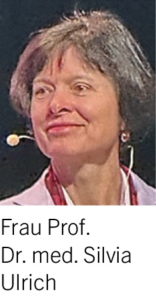
Asthma-Diagnostik: Deutsche Leitlinie nimmt exhaliertes NO (FeNO) und Eosinophile auf. Asthma ist weitgehend eine klinische Diagnose, stellte Prof. Dr. med. Silvia Ulrich, Direktorin der Klinik für Pneumologie, einleitend fest.
Lungenfunktion: Die Normalisierung der Obstruktion bestätigt die Diagnose. Ein negativer Reversibilitätstest schließt Asthma nicht aus. Bronchoprovokationstest (auch mit Prämedikation möglich). Weitere diagnostische Hilfsmittel und Phänotypisierung: FeNO, Eosinophile, Allergie. Das Management-Schema bei Erwachsenen umfasst 5 Stufen.
Stufe 1: Fixkombination aus ICS niedrig dosiert/Formoterol als Bedarfstherapie. Oder ICS niedrg dosiert als Langzeittherapie + SABA als Bedarfstherapie.
Stufe 2: ICS niedrig dosiert als Langzeittherapie + SABA als Bedarfstherapie oder Fixkombination aus ICS niedrig dosiert/Formoterol als Bedarfstherapie. Alternativ in begründeten Fällen: LTRA-Langzeittherapie + SABA-Bedarfstherapie.
Stufe 3: ICS niedrig dosiert + LABA (bevorzugt) oder ICS mittel dosiert. Alternativen in begründeten Fällen ICS niedrig dosiert + LAMA oder ICS niedrig dosiert +LTRA. Zusätzliche Bedarfstherapie SABA oder Fixkombination ICS + Formeterol, wenn diese auch die Langzeittherapie darstellt.
Stufe 4: ICS mittel bis hoch dosiert + LABA (bevorzugt) oder ICS mittel bis hoch dosiert + LABA + LAMA, Alternative in begründeten Fällen ICS mittel bis hoch dosiert + LABA + LTRA oder ICS mittel bis hoch dosiert + LAMA.
Stufe 5: ICS in Höchstdosis + LABA ± LAMA, Je nach Phänotyp additive Therapie mit einem Antikörper der folgenden Biologika-Klassen Anti-IgE, Anti-IL-5-®, Anti-IL-4-R, Anti-TSLP. OCS nur bei fehlender Indikation oder Versagen einer Biologika-Therapie. Allergen-Immuntherapie bei gegebener Indikation (Asthmaschulung, Allergie-/Umweltkontrolle, körperliche Bewegung/Sport, Behandlung Komorbiditäten, Rehabilitation).
Schweres Asthma
Schweres Asthma ist definiert als unkontrolliertes Asthma unter Hochdosistherapie oder kontrolliertes Asthma, das nach Absetzen hochdosierter Kortikosteroide unkontrolliert wird. Bei schwerem Asthma wird zunehmend eine Phänotypisierung mit individualisierter Therapie durchgeführt.
Ziel der Behandlung mit Biologika bei schwerem Asthma ist die Reduktion der Exazerbationen, die Reduktion der systemischen Kortikosteroide, die Verbesserung der Asthmakontrolle, die Verbesserung der Lungenfunktion, die Reduktion der Bedarfsmedikation, die Verbesserung der Lebensqualität, die Aufrechterhaltung der Verträglichkeit.
Schweres Asthma mit ≥ 1 Exazerbation in den letzten 12 Monaten: Therapie mit Biologikum (Anti-IL-5-®, Anti-IL-4-R, Anti-TSLP). Auswahl nach Anamnese, Biomarker-Expression und Komedikation.
Weitere Anwendungen der Biologika
Omalizumab: Chronische spontane Urtikaria, Chronische Rhinosinusitis mit Polyposis nasi
Mepolizumab: Hypereosinophilie, chron. Rhinosinusitis mit Polyposis nasi, Churg Strausssyndrom
Dupilumab: Atopische Dermatitis, chron. Rhinosinusitis mit Polyposis nasi, Eosinophile Ösophagitis, Prungo nodularis
COPD
PRISm = preserved ratio impaired spirometry
Die Definition lautet≥0,7: FEV1/FVC +FEV1 <80% kombiniert mit respiratorischen Symptomen analog zur COPD. PRISm hat eine hohe Prävalenz und ist mit erhöhten respiratorischen Symptomen, systemischer Entzündung und Mortalität assoziiert.
Zugrunde liegt möglicherweise eine kardiale Störung, eine beginnende obstruktive oder restriktive Lungenkrankheit, eine Krankheit der kleinen Atemwege, ein Emphysem mit «gefesselter» Luft, eine inkomplette Inspiration als Folge mangelnder Mitarbeit/Zwerchfellschwäche.
Raucher mit normaler Spirometrie – sehr hohe Krankeitslast – Symptome, Exazerbationen…
Es gibt keine gesunden Raucher. Hohes kardiovaskuläres Risiko und Progression zu höhergradiger COPD. Small airway disease, geht im CT dem Emphysem voraus und ist oft schon vorhanden. Hohes Todesrisiko bei COPD wenn mehr Mucus Plugs im CT – whs. wegen erhöhten Exazerbationen.
Oszillatorischer positiver Ausatmungsdruck. Therapie bei COPD: RCT
Patienten mit stabiler COPD und (fast) täglicher Sputumproduktion. Outcome: Husten-bezogene QoL: LeicesterCough-Fragebogen. Zusätzlich Fatigue (FACIT-Score), EuroQoL 5, subjektive und objektive Reduktion der Hustenhäufigkeit und Symptomdifferenz. Erste RCT – da die Therapie kaum Nebenwirkungen hat und kostengünstig ist, ist sie einen Versuch wert.
Alpha-1-Antitrypsin Substitution
Akutes Absetzen der Substitution ist deletär (dies zeigte sich, als die irische Regierung die Kostenübernahme für die Substitution einstellte). Substitutionstherapie verlängert das Überleben: 616 Patientinnen (Irland, Schweiz, Österreich) mit einem mittleren α1-Antitrypsinspiegel von 0,25g/l wurden untersucht. Die Studie zeigte erstmals einen Effekt der Therapie auf die Mortalität. FEV1 spielte für diesen Effekt keine Rolle. Absurderweise beharren regulatorische Behörden trotzdem auf FEV1.
Interstitielle Lungenkrankheiten
ILA: Interstitielle Lungenabnormailitäten
– Zufällig in der CT entdeckt z.B. bei Coro-CT oder Lungenkarzinom-Screening
– Milchglastrübungen, Retikulationen, Architekturstörung, Traktionsbronchiektasen (Honigwaben-) Zysten
– Betreffen mindestens 5% einer Lungenzone (Unterfeld, Mittelfeld, Oberfeld). Sie dürfen nur diagnostiziert werden, wenn kein Verdacht auf eine interstitielle Lungenerkrankung besteht.
Subkategorien von ILA (interstitielle Lungenauffälligkeiten)
– Nicht subpleural: ILAs ohne vorherrschende subpleurale Lokalisation
– Subpleural, nicht fibrotisch: ILAs mit überwiegend subpleuraler Lokalisation ohne Anzeichen einer Fibrose
– Subpleural fibrotisch: ILAs mit überwiegend subpleuraler Lokalisation und Anzeichen einer Lungenfibrose z.B. anhand einer MESNA Arteriosklerose Studie: Insgesamt wurden im Zeitraum vom Jahr 2000-2012 fünf konsekutive CT in ca. 2-jährlichem Abstand, analysiert, 13944 Herz-CT. Raucherstatus (ex oder aktiv) und polygenetischer Risikoscore für idiopathische Lugenfibrose mit Inzidenz fibrotischer ILAs assoziiert (HR 2.31 bzw. 2.09).
ILA – Bedeutung und Management
– Je nach Kollektiv (Raucher-Screening, sonstige Zufallsbefunde) variiert die Prävalenz. In einem asiatischen Gesundheitsscreening betrug sie ca. 3%. Eine Progression ist bei 20% bis 80% in 2 bis 3 Jahren beschrieben. Subpleural am häufigsten progredient. Korrelation zur Histologie und genetischen Markern. Es wurden verschiedene Algorithmen vorgeschlagen, dabei ist aber noch viel zu definieren.
Fazit für die Praxis: Darauf achten und insbesondere bei klinischem Korrelat nachverfolgen.
Diffuse parenchymatöse Lungenkrankheiten
Bekannte Ursache , medikamentöse Therapie, Kollagenose
Idiopathische interstitielle Pneumonien, granulomatöse Sarkoidose, Andere (Lymphangioleiomyomatose, Langerhanszellhistiozytose). Man unterscheidet Nicht-Familiär (>80%) und Familiär (2-20%), sowie – Chronisch fibrosierend: idiopathische pulmonale Fibrose und idiopathisch nicht spezifische interstitielle Pneumonie (IPF)
– Akut-subakut-fibrosierend: Cryptogene organisierende Pneumonie und akute interstitielle Pneumonie.
– Raucher-assoziiert: Respiratorische Bronchiolitis interstitielle Lungenkrankheit, desquamative interstitielle Pneumonie.
Für anti-fibrotische Therapie braucht es bei Nicht IPF Fibrose den Nachweis eines progressiven Verlaufs (=progressive fibrosierende interstitielle Lungenkrankheiten).
Die Referentin präsentierte einen umfassenden Therapiealgorithmus (Podolanczuik AJ. ERJ 2023;61: 2200957).
Zusammenfassung zur Therapie der Lungenfibrose
– Genaue Diagnose und Einteilung, welche dann die Therapie (mit)bestimmt
– Gesamtkonzept einschliesslich pneumologischer Rehabilitation so früh wie möglich und an Lungentransplantation denken!
– Antifibrotische Therapie als first-line Therapie nur bei IPF (idiopathischer pulmonaler Fibrose), Sklerodermie assoziierter ILD und möglicherweise rheumatoider Arthritis mit ILD (insbesondere bei UIP-Muster)
– Nicht-IPF Risikostratifizierung für die Prognose wichtig, aber Kriterien für «progressive» noch nicht abschliessend festgelegt, >10% Abfall FVC in 2 Jahren
– Bei Patienten mit progressiver pulmonaler Fibrose (PPF)sollte immer versucht werden Kortikosteroide zu reduzieren oder abzusetzen und ggf. durch alternative Immunsuppressiva zu ersetzen, Nintendanib in Studien wirksam!
Pulmonale Hypertonie
Neue Therapieoptionen bei PAH dringend nötig stellte Frau Prof. Ulrich, fest.
Sotatercept – Activin II Rezeptor wird gehemmt – antiproliferativ.
Sotatercept ist hoffentlich bald eine neue, antiproliferative Therapieoption für schwere PAH. Fast alle Zusatz-Endpunkte sind positiv.
Schlaf-assoziierte Atemstörung
Korrekte Diagnose von Schlafapnoe: es braucht eine Level III Schlaf-Studie mit mind..4 Kanälen:
– Atemeffort (respiratory inductance plethysmography. RIP)
– Pulsoximetrie
– Nasenfluss
– EKG
Gemäss der American Academy of Sleep Medicine , dem American College of Chest Physicians und der American Thoracic Society werden IV Typen unterschieden.
Typ I Vollständig betreute Polysomnographie (sieben
oder mehr Kanäle) in einer Laborumgebung
Typ II Vollständige unbeaufsichtigte Polysomnographie
(sieben oder mehr Kanäle) Laborumgebung
Typ III Geräte mit begrenzten Kanälen (vier bis sieben Kanäle)
Typ IV Ein oder zwei Kanäle, in der Regel mit Oxymetrie
als einem der Parameter
Zusammenhang obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und kardiovaskuläre Risikofaktoren
Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom (OSA) ist belegt. Bei Therapie-refraktärer arterieller Hypertonie immer an OSA denken, insbesondere wenn 24h BD keinen nächtlichen Abfall zeigt. Die CPAP-Therapie hat einen positiven Einfluss auf kardiovaskuläre Risikofaktoren und Endpunkte (MACE), Dies hängt aber von der Adhärenz ab. Ein Nutzen wird dann ersichtlich, wenn CPAP mind. 6h getragen wird.
Cystische Fibrose, früher Todesurteil, heute normales Leben?

Der Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) transportiert Chloridionen über die Zellmembran und spielt damit eine zentrale Rolle bei der Flüssigkeitshomöostase der Atemwege, indem er die Ionenkonzentration und den pH-Wert kontrolliert. Das CFTR-Protein reguliert den Wasser- und Salztransport in der Membran von Epithelzellen, stellte Prof. Dr. med. Alexander Möller, Universitäts-Kinderklinik Zürich, eingangs fest.
Mutationen im CFTR-Gen können die Bildung dieses Membranproteins beeinträchtigen. Die Konsequenzen sind eine Einschränkung des Chlorid-Ionen-Transports. Die veränderten Konzentrationsunterschiede der Ionen innerhalb und ausserhalb der Zelle führen zu Sekreten mit verringertem Wassergehalt und dadurch zähflüssigen Sekreten, die die feinen Kanäle verstopfen. Dies kann beispielsweise in der Lunge vorkommen.
Es existieren mehr als 2000 CFTR-Mutationen. Etwa die Hälfte sind F508del Homozygote. Am zweithäufigsten sind 508del Heterozygote, gefolgt von Gaiting Mutationen und ultraseltenen Mutationen.
CFTR-Mutation und Struktur
Grundsätzlich werden 2 Arten von Mutationen beschrieben, Mutationen, die die Anzahl CFTR-Proteine beeinträchtigen (Mengendefekt und Mutationen, welche die Funktionn des CFTR-Proteins beeinträchtigen (Funktionsstörung). Eine Abnahme der Wirkung des CFTR-Proteins auf 50% sieht man bei heterozygoten Gen-Trägern. Bei einer Abnahme auf 40% treten Symptome auf (z.B. chronischer Husten), bei einer Abnahme auf 25% treten CFTR-assoziierte Erkrankungen auf, wie Pankreatitis, Sinusitis, Infertilität nd bei einer Abnahme auf 10 % die cystische Fibrose, das Pankreas-ist noch suffizient, bei gänzlichem Ausfall der CFTR-Aktivität tritt Cystische Fibrose und Pankreas-Insuffizienz ein.
Cystische Fibrose – eine Multiorgankrankheit
Die verschiedenen Krankheiten, die mit der Cystischen Fibrose auftreten sind verminderte Lungenfunktion, häufige Lungeninfektionen, Entzündungen und fortschreitende Lungenerkrankungen, abnorm hohe Ausscheidung von Natrium und Chlorid über den Schweiss. Die exokrine Pankreasinsuffizienz und die daraus resultierende Unterernährung führen zu Gedeihstörungen, Verdauungsstörungen und Darmverschlüssen. Weiter treten Infektionen der Nasennebenhöhlen und Nasenpolypen auf. CFTR-Gen-Mutationen wurden ferne bei 42% von infertilen Männern mit CBAVD (Congenitale Bilaterale Aplasie des Vas delerens) gefunden.
Die Cystische Fibrose ist eine fortschreitende Erkrankung und eine tödliche Krankheit mit einem Mortalitätspeak bei 21-30 Jahren sowohl für Männer als auch für Frauen.
Therapeutische Optionen: heute, morgen, übermorgen
Die klassischen Therapieformen beinhalten den Einsatz von Mukolytika, Bronchodilatatoren, Inhalatoren mit hochprozentiger Kochsalzlösung, Antibiotika und autogene Drainage, eine physiotherapeutische Übung mit einer speziellen Atemtechnik, die das Abhusten erleichtern soll.
Neu sind die CFTR-Modulatoren. Sie haben das Ziel die Funktion des CFTR-Kanals zu verbessern oder sogar wiederherzustellen, damit der Salz-Wasser-Haushalt wieder im Gleichgewicht ist. Man unterscheidet Potentiatoren, Korrektoren 1 und Korrektoren 2.
Die Potentiatoren aktivieren die Öffnung des Kanals, die Korrektoren 1 vermindern die Elimination des Proteins und verbessern die Ausreifung des Proteins und die Korrektoren 2 verbessern die Proteinfaltung. Die CFTR-Modulatoren normalisieren die Lungenfunktion, erhöhen das Körpergewichts und verbessern die Pankreasfunktion. Der erste Potentiator der Kanalfunktion, der zugelassen wurde, ist Ivacraftor (Kalydeco®). Kalydeco® verbessert die Lungenfunktion und den Schweisstest. Zu den Korrektoren 1 gehören Orkambi® (Lumakraftor/Ivakraftor) und Symdeko® (Texacaltor/Ivacraftor und Ivacaltor), Trikafta (Elexacaltor, Tezacaltor, Ivacaltor) ist ein Korrektor 2. Diese CFTR-Modulatoren wirken bei unterschiedlichen Mutationen. Es sind aber noch nicht alle Mutationen abgedeckt, weshalb ein Teil der CF-Betroffenen noch nicht geheilt werden kann.
Konklusionen
– Die hocheffektiven CFTR-Modulator-Therapien haben profunde Effekte auf das Leben der behandelten CF-Betroffenen
– Physiologisch gesehen, «stoppen» CTFR die CF
– Die Patienten berichten über einen «Lichtschalter»-Effekt
– Viele erwachsene Betroffene haben nun ein «normales» Leben
– Bei Beginn im Säuglingsalter sind die Kinder evtl. sogar ganz «gesund»
– Die hochgerechnete Lebenserwartung liegt dann bei <80 Jahren
– Es stellen sich aktuell viele Fragen im Management der CF-Betroffenen
– Nun brauchen die 13-15% nicht behandelbaren Betroffenen unseren Fokus in Klinik und Forschung
Die eosinophile Ösophagitis – wenn die Speiseröhre Asthma hat
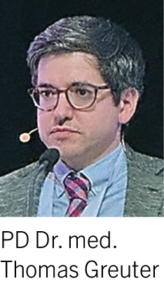
Die eosinophile Ösohagitis (EoE) ist eine klinisch-pathologische Diagnose. Kinder haben unspezifische Beschwerden, wie Bauchschmerzen, Thoraxschmerzen, Husten, Sodbrennen, verminderten Appetit, Dysphagie; Wachstumsstörung, Regurgitation und Schlafstörungen. Bei Erwachsenen tritt die EoE mit Dysphagie, Bolusobstruktion, retrosternalen Schmerzen, Thoraxschmerzen, Sodbrennen, Regurgitation auf, stellte PD Dr. med. Thomas Greuter, Wetzikon, eingangs fest. Die Diagnose erfolgt durch Endoskopie. Der Nachweis von mindestens 15 Eosinophilen pro Hauptgesichtsfeld mit einer Standardgröße von ca. 0,3 mm2 gilt als valide.
Pathophysiologisch liegt der EoE eine TH2-Immunantwort zugrunde, an welcher aktivierte Eosinophile, Mastzellen und die Zytokine Eotaxin-3, Interleukin-5 und Interleukin-13 beteiligt sind. Das Krankheitsbild der EoE wurde in den 1990er-Jahren von Prof. Stephen Attwood aus England und Prof. Alex Straumann aus der Schweiz unabhängig voneinander beschrieben.
Die EoE zeigt eine steigende Inzidenz und Prävalenz. Sie gilt erst seit kurzem als eigenständiges Krankheitsbild. Ärztliches Fachpersonal schätzt, dass ungefähr eine Person unter 2‘500 bis 4‘000 Einwohnern mit einer EoE lebt. Vermutlich ist die Dunkelziffer aber noch höher, weil nicht jede betroffene Person mit Eosinophiler Ösophagitis eine Diagnose erhält.
Epidemiologie
Chronische, nahrungsmittel-getriggerte allergie-artige Entzündung der Speiseröhre. Häufig allergische Komorbiditäten. Kommt im Kindes-/Erwachsenenalter vor. Das Verhältnis Männer: Frauen beträgt 3:1. Es sind genetische Suszeptibilitätsfaktoren beschrieben worden: TSLP (Thymic Stromal Lymphopoietin), CAPN (Calpain).
EoE – eine TH2 mediierte Erkrankung – eine Systemerkrankung?
Die EoE zählt zu den eosinophilen Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Innerhalb dieser Erkrankungen unterscheidet man die primären Formen (z.B. eosinophile Ösophagitis) und sekundäre Formen, die infolge anderer Systemerkrankungen auftreten können. Die Mechanismen sind IgE-unabhängig. Sie entsprechen einer TH2-Immunantwort mit Aktivierung von Eosinophilen und Mastzellen, getriggert durch Nahrungsmittel.
Therapeutische Strategien: Die 3 D’s
Die 3 D’s sind Drugs, Diet und Dilation. Die medikamentöse Therapie umfasst eine topische Steroidtherapie (Budenosid ) während 48 Wochen zweimal täglich 0.5mg oder 1mg. The new kid on the block ist Dupilumab, welches die Aktivierung des spezifischen Gentranskriptionsprogramm inhibiert. Die Diät besteht in einer Eliminationsdiät, die Kuhmilch, Weizen, Eier, Soja, Nüsse, und Fisch/Meeresfrüchte umfasst.
Falls die medikamentöse Therapie und die Diät nicht mehr ausreichen kann eine Dilatation durchgeführt werden. Dies ist vor allem bei narbigen Verengungen der Fall, da diese medikamentös nicht beseitigt werden können. Dabei wird die Speiseröhre mit einem aufpumpbaren Ballon gedehnt oder sie wird mit einem Bougie-Clip bougiert.
Nachbetreuung
Die Nachbetreuung einer EoE ist chronisch:
1. Diagnose sichern und Therapie einleiten.
2. Kontrolle der Wirksamkeit der Therapie nach 8-12 Wochen
3. Langzeittherapie (Erhaltungsdosis). Topische Steroide sind nebenwirkungsarm
4. Regelmässige Nachsorge (Gastroskopie)
Therapiestopp: Es kommt fast immer zum Rückfall. Die Konsequenz ist kein Therapiestopp, stellte der Referent fest.
Fazit
– EoE st die häufigste Schluckstörung im jungen Erwachsenenalter
– EoE ist meist einfach zu behandeln (topische Steroide)
– Dupilumab als «new» kid on the bloc
– Langzeitbetreuung und Nachsorge sind wichtig
Die wirkliche Take Home Message des Referenten
Dysphagie ist nie normal und gehört immer abgeklärt mittels einer Gastroskopie.
riesen@medinfo-verlag.ch