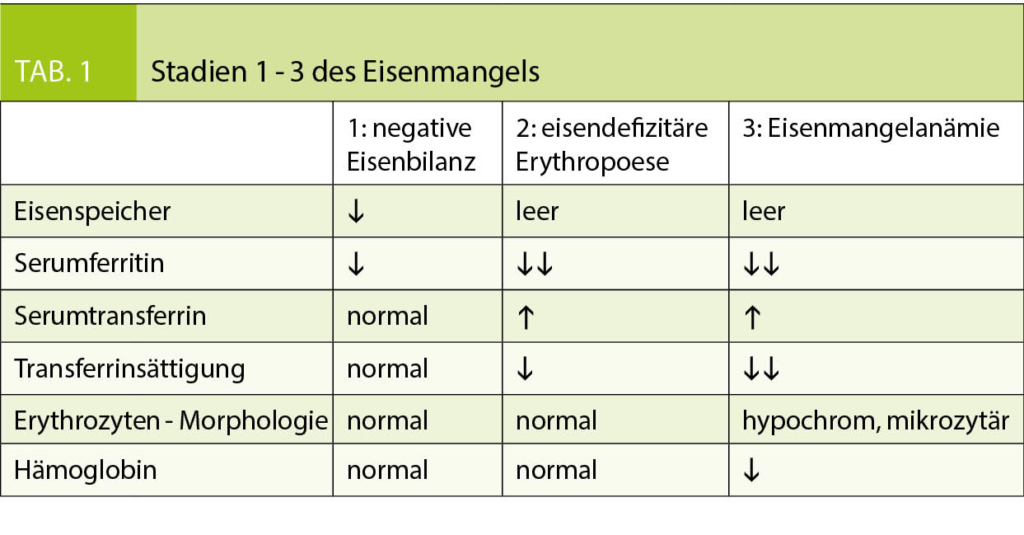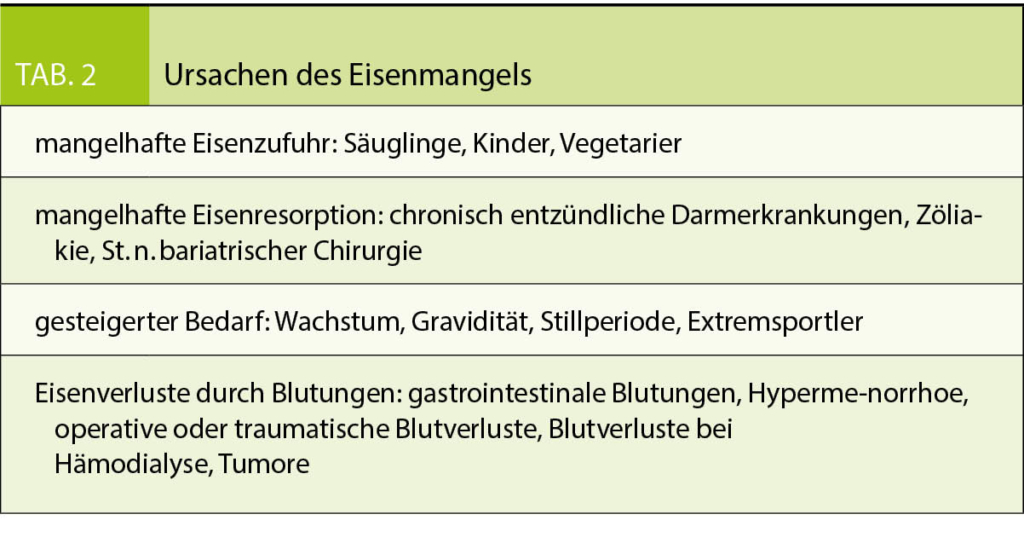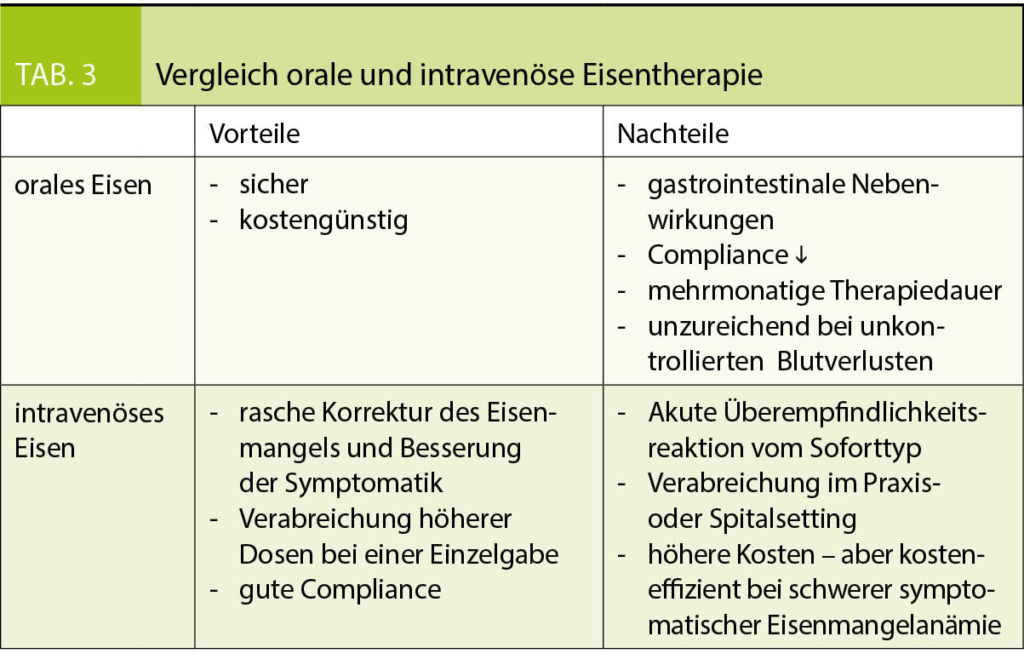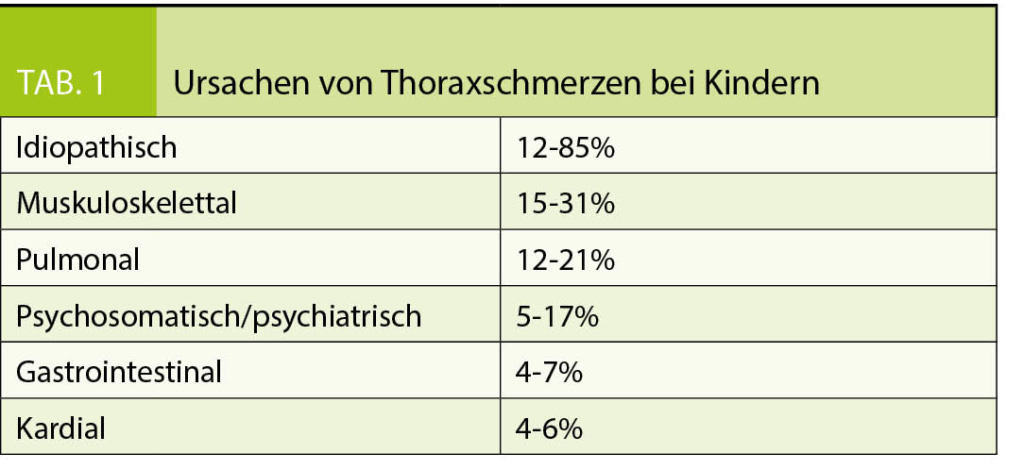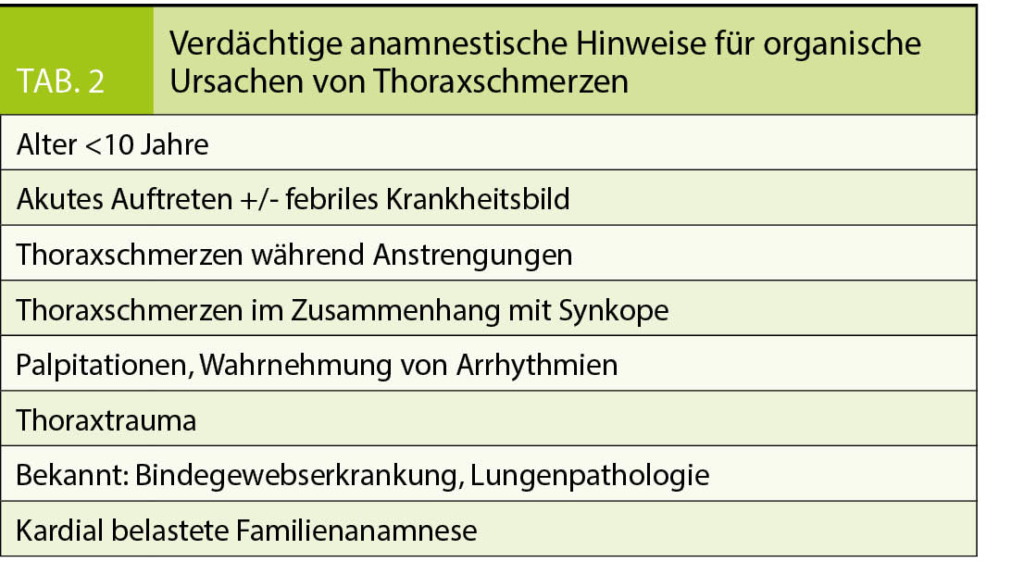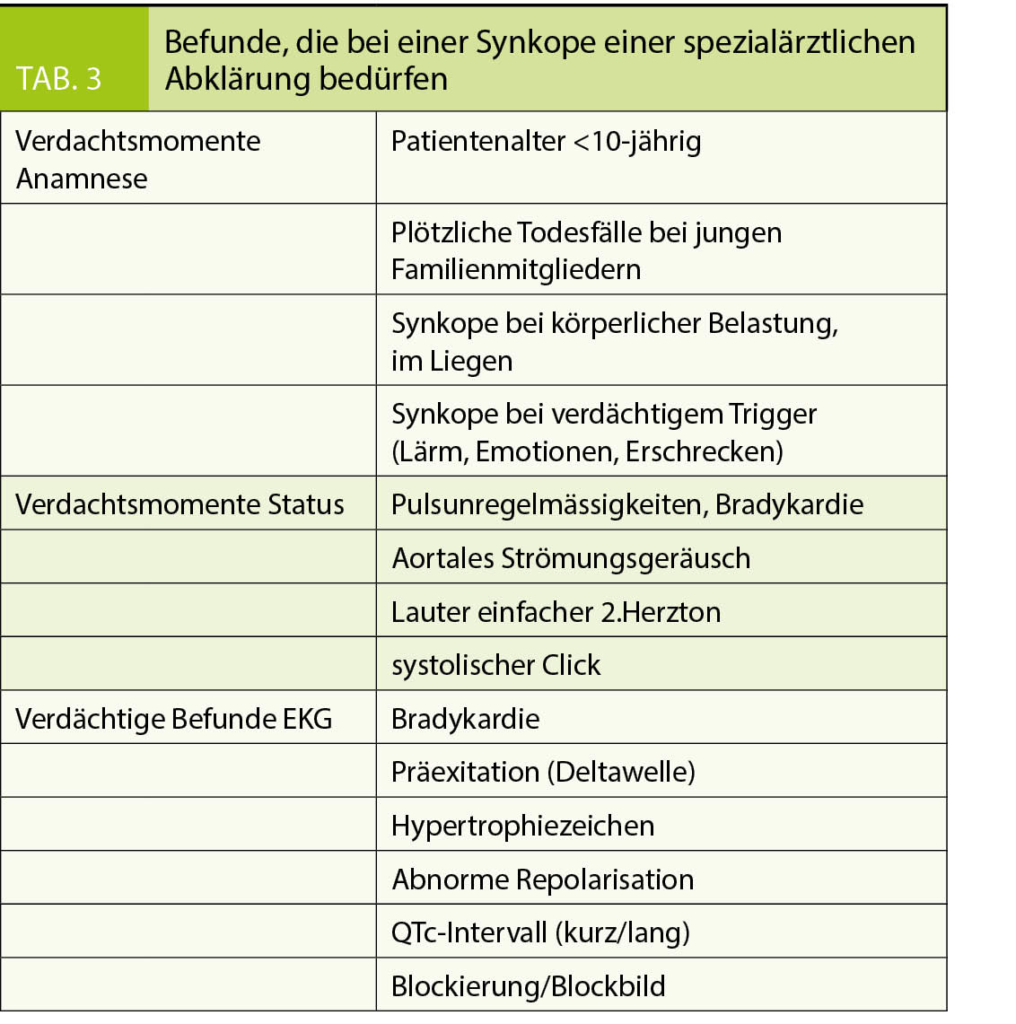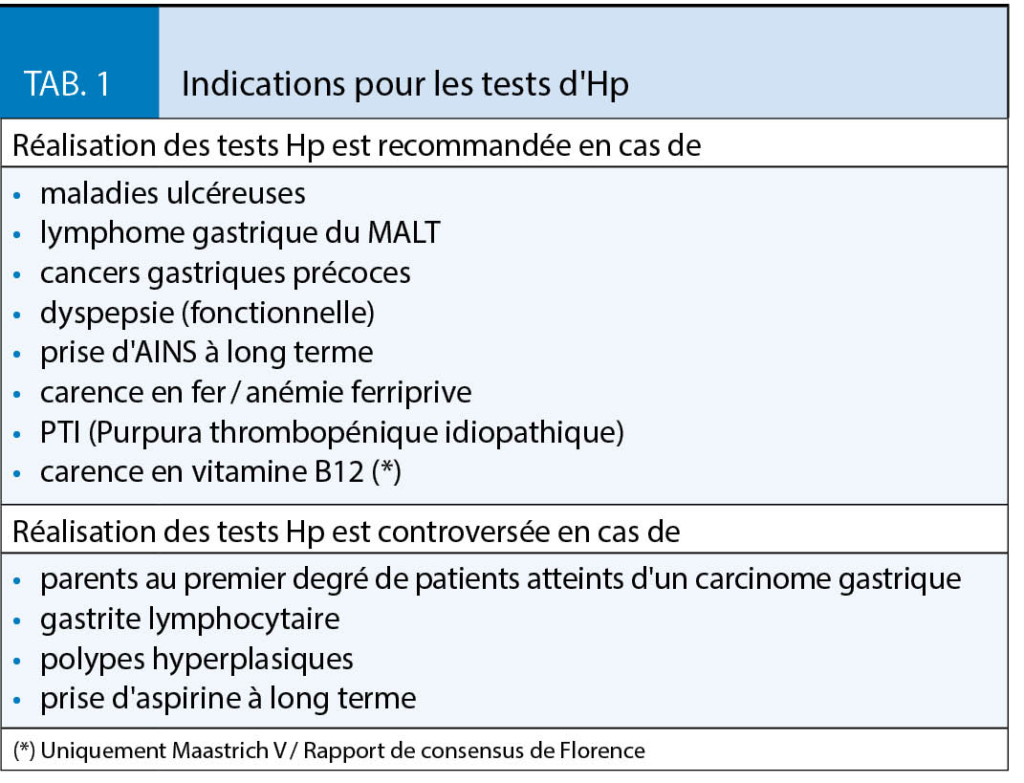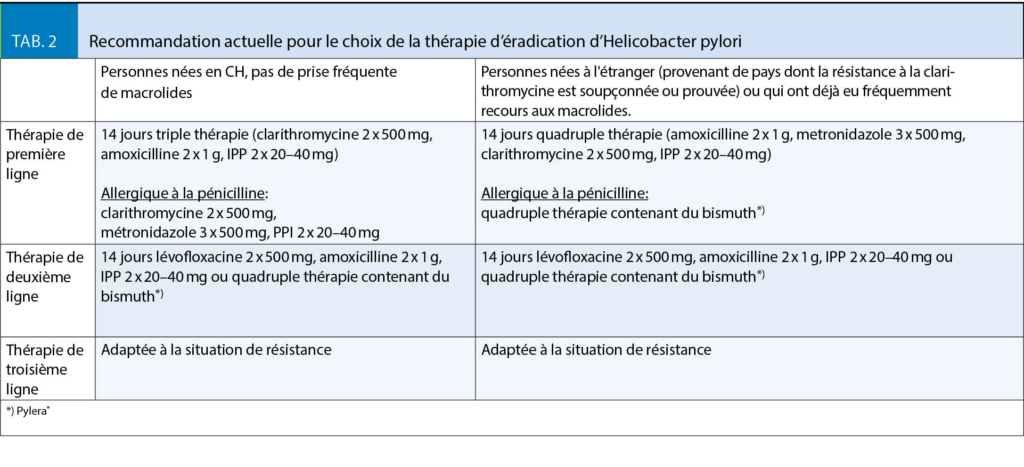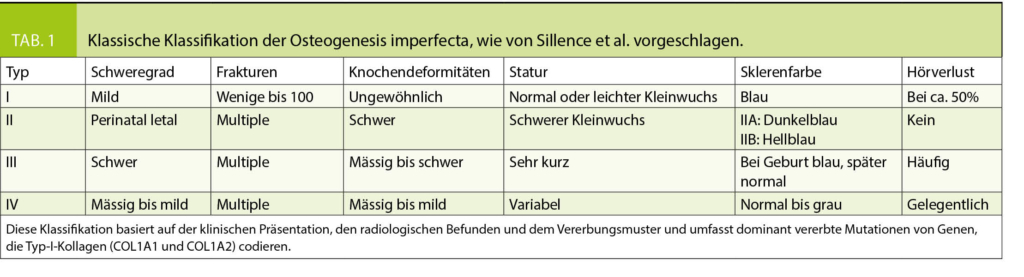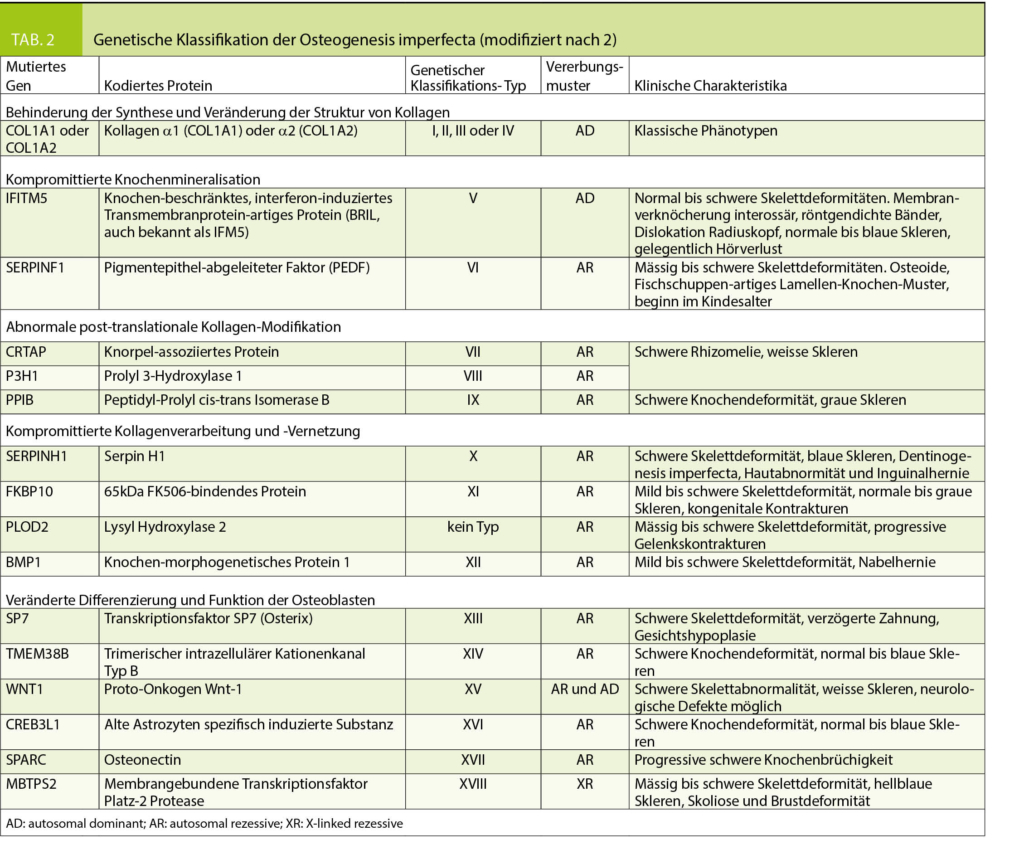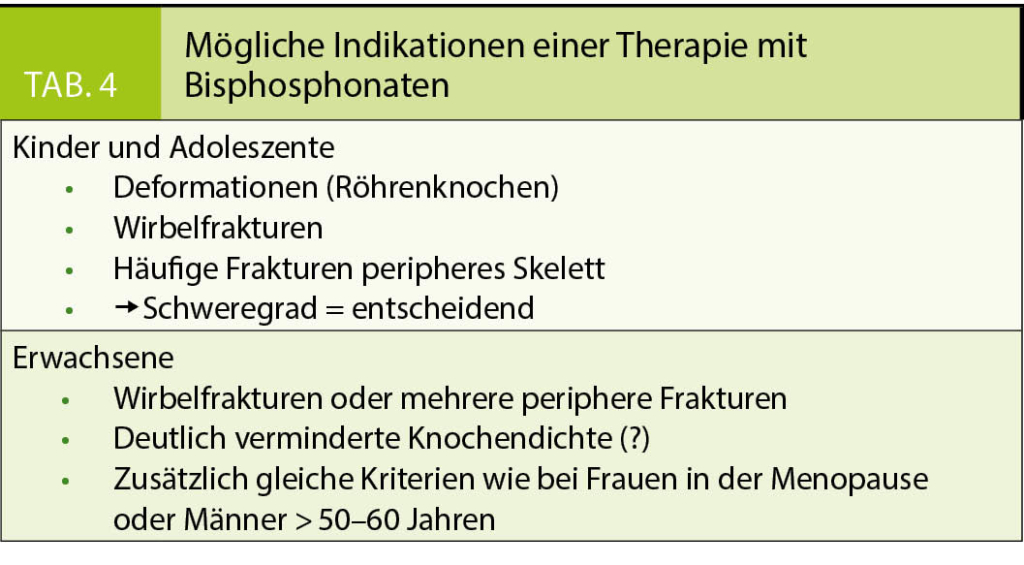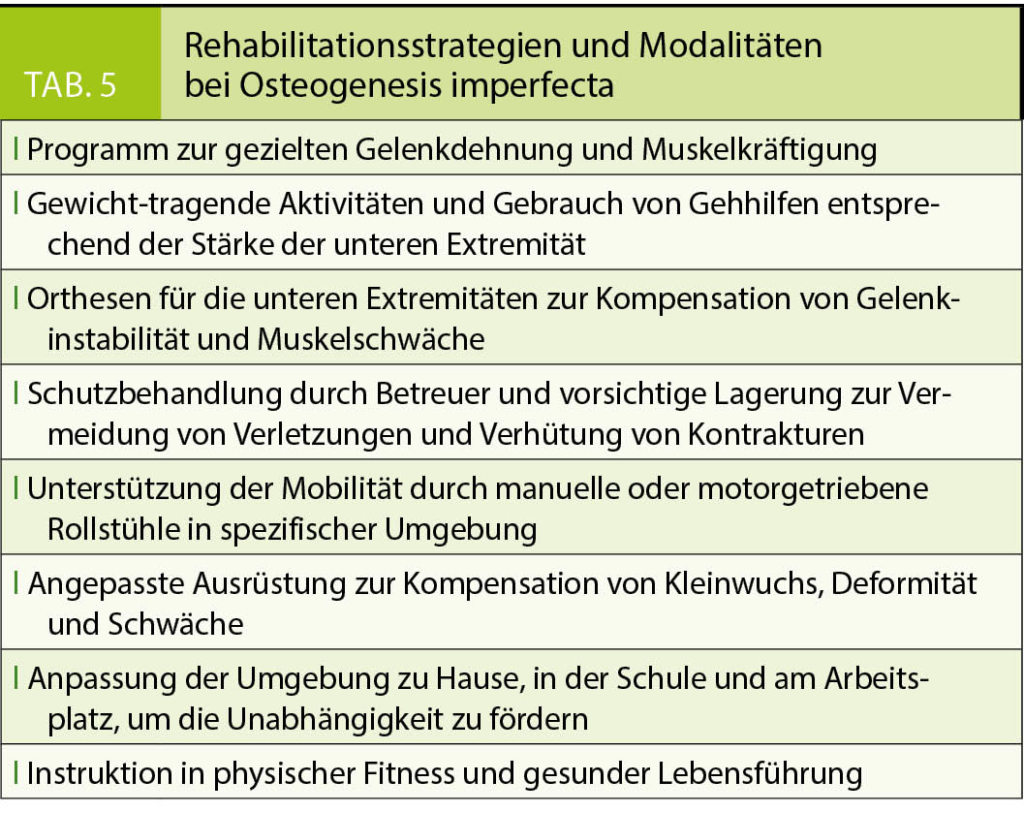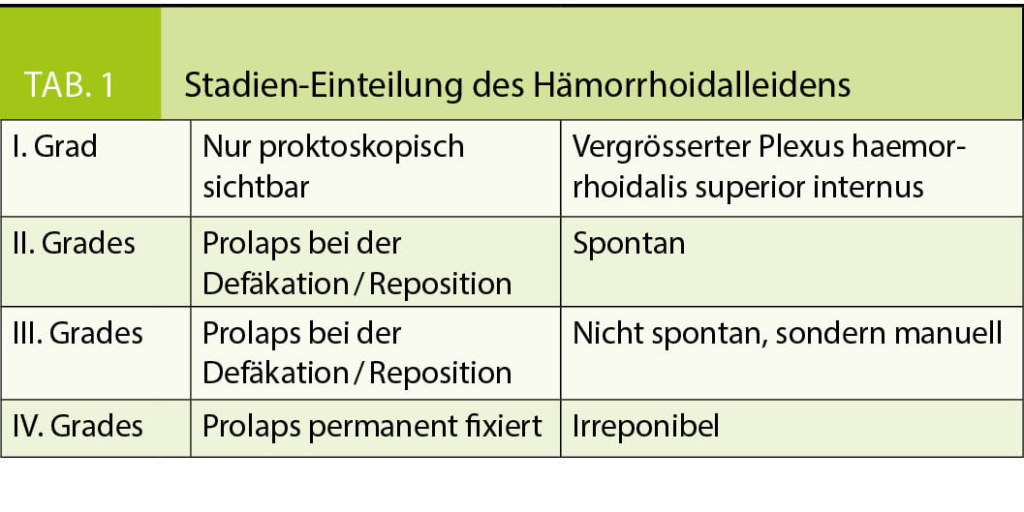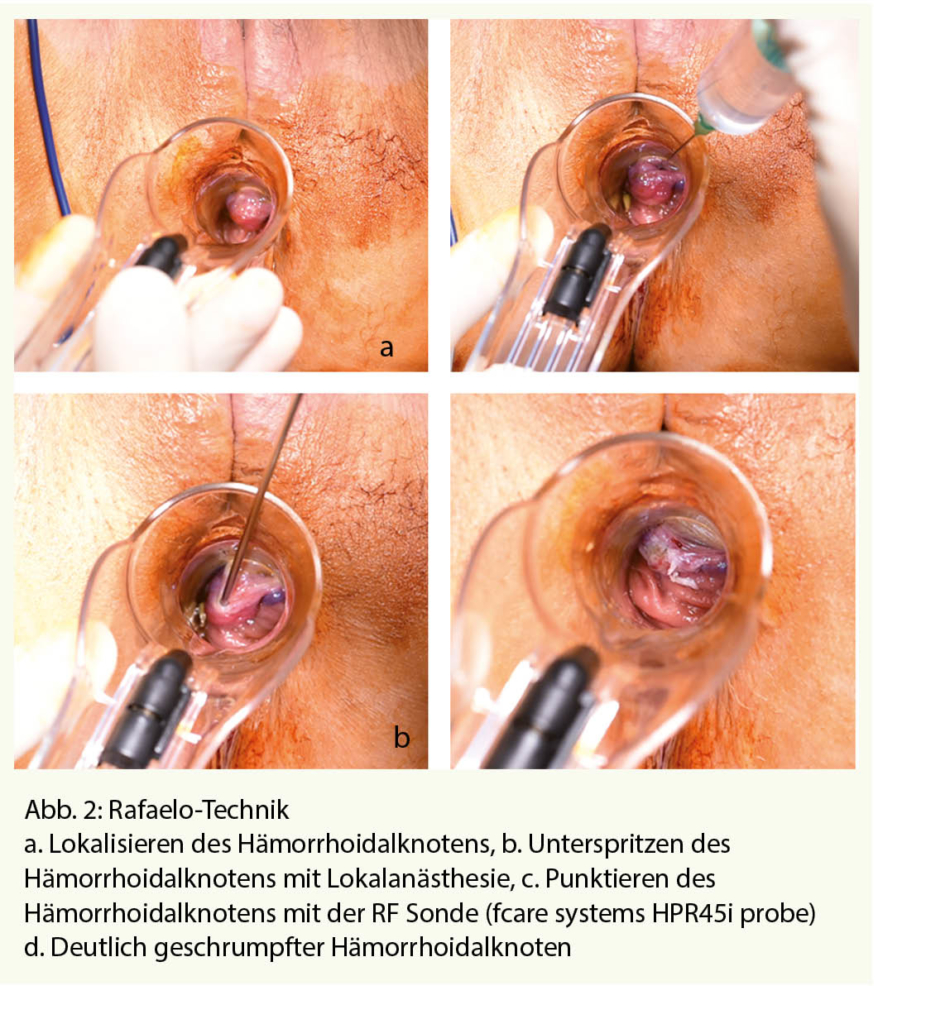In Publikationen für die allgemeine Öffentlichkeit werden Selen positive antivirale Auswirkungen attestiert sowie eine grosse Bedeutung für die erfolgreiche männliche und weibliche Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. Auch eine vorbeugende Wirkung vor Krebs-, Autoimmun- und Schilddrüsenerkrankungen (1). Zudem schütze Selen die Körperzellen vor den Angriffen freier Radikale und sei wegen der Stärkung der körpereigenen Abwehrkraft in der Lage, vor sehr vielen Krankheiten zu schützen (2). Solche und ähnliche Aussagen lassen die Vermutung aufkeimen, dass Selen ein wahres Wundermittel sei, womit wohl motiviert werden soll, Selen-Präparate zu kaufen und anzuwenden. In diesem Artikel werden physiologische Aspekte und ein möglicher therapeutischer Einsatz von Selen resümiert.
Selen, ein Halbmetall mit der Ordnungszahl 34, gehört zusammen mit Iod, Molybdän und Chrom und anderen zu den essentiellen Ultra-Spurenelementen, Substanzen deren täglicher Bedarf im µg-Bereich liegt. Zur Erinnerung: Der Bedarf an eigentlichen Spurenelementen wie Eisen, Zink, Kupfer, Fluor und Mangan liegt im mg-Bereich.
Selen hat vielfältige biologische Funktionen. Beobachtungen von endemischer Kardiomyopathie bei einer Population in China, die sich fast Selen-frei ernährt, und auf Supplementation mit Selen anspricht, sprechen für die Essentialität von Selen zum Erhalt der Gesundheit (3). Auch unter totaler parenteraler Ernährung, die früher ohne Selen-Zusatz verabreicht wurde, traten Fälle von unter Selen reversiblen Kardiomyopathien und Skelettmuskel-Dysfunktionen auf. Als weitere Folgen von Selenmangel werden Störungen der Immunfunktion, Thyroiditis, Krebsarten, kardiovaskuläre Krankheiten und Störungen des Glukose-Metabolismus diskutiert, ohne klar etabliert zu sein (4).
Der Selenbedarf eines gesunden Erwachsenen liegt gemäss «Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr der Gesellschaften für Ernährung in Deutschland (DGE), Österreich (ÖGE) und der Schweiz (SGE)» für Frauen bei geschätzten 60 und für Männer bei 70 µg pro Tag, wobei die Grenze zu potentiell zu hoher Einnahme bereits bei rund 400 µg pro Tag erreicht ist. Damit ist der Bereich für eine Supplementation schmal, so dass eine solche höchstens bei Personen mit einem klaren Selen-Mangel sinnvoll und sicher ist (5).
Der Gehalt von Selen in pflanzlichen Lebensmitteln hängt vom Selengehalt des Bodens ab, auf dem sie wachsen. In der Schweiz sind wie im übrigen Europa die Böden eher arm an Selen, während die Böden in den USA noch relativ reich an Selen sind. Bei tierischen Lebensmitteln hängt der Selengehalt vom Futter resp. von der Selenzugabe zum Futter ab. In der Schweiz trägt der Teigwarenkonsum mit 15.7 µg /d am meisten zur durchschnittlichen Gesamteinnahme von 66 µg Selen/d bei, gefolgt von Fleisch, Fisch und Ei. Daran hat auch der rückläufige Import von Hartweizen aus Nordamerika mit seinem hohen Selengehalt mindestens bis 2010 nichts geändert. Eine 2010 publizierte Studie kam zum Schluss, dass die Selenversorgung in der Schweiz seit annähernd 25 Jahren stabil und noch ausreichend sei (6). Modellrechnungen zeigen jedoch, dass es im Zusammenhang mit dem Klimawandel in den nächsten Dezennien in rund zwei Dritteln der weltweit landwirtschaftlich genutzten Flächen zu einem durchschnittlichen Selenverlust von rund 9% kommen wird. Damit ist anzunehmen, dass die Zahl von Menschen mit Selenmangel zunehmen wird (7).
Selen liegt in der organischen Natur hauptsächlich in gebundener Form vor, in welcher es vom Menschen überwiegend mit der Nahrung aufgenommen wird. In Pilzen und Pflanzen in Form von Selenmethionin. Es handelt sich dabei um Methionin, bei welchem das Schwefelatom durch Selen ersetzt ist und das auch bei Tieren und Menschen unspezifisch an Stelle von Methionin in viele Proteine eingebaut wird. Die Resorption im Darm erfolgt aktiv, die Bioverfügbarkeit ist hoch. Hingegen wird bei Mensch und Tier Selenocystein als 21. Aminosäure aktiv in sogenannte Selenoproteine eingebaut. Selenocystein, bei dem das Schwefelatom von Cystein durch Selen ersetzt ist, wird sowohl intestinal resorbiert, wie auch aus Selenmethionin oder via eine spezifische Transfer-RNS aus L-Serin synthetisiert. Bei katabolen Prozessen freigesetztes Selen wird hauptsächlich im Urin ausgeschieden (8).
Beim Menschen sind mehr als 30 Selenoproteine bekannt, die wichtigsten sind vier Glutathionperoxidasen (GPX) mit antioxidativer Wirkung und drei Iodo-Thyronin Deiodasen, welche die Umwandlung von T4 zum aktiven T3 und die Deiodierung von T3 zu inaktivem T2 bewirken, sowie die lokale Konzentration von T3 regulieren. Weiter sind die Thioredoxin Reduktasen 1-3 erwähnenswert sowie das humane Selenoprotein P (SEPP1), welches sehr reich an Selenocystein ist und nach Synthese in der Leber zur Hauptsache andere Organe wie Gehirn, Nieren und Testes mit Selen versorgt. Die Plasmakonzentration von SEPP1 fällt bei Selenmangel ab, weshalb es zusammen mit der Aktivität von GPX3 als Index für die aktuelle nutritive Versorgungssituation Verwendung findet (9).
Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen einer Korrektur eines Selenmangels und dem prophylaktischen Einsatz von Selen bei Personen mit normalem Selenstatus. Die Interpretation von Studien über den Effekt von Selen-Supplementation auf diverse Endpunkte ist insofern schwierig, als oft nicht klar ist, ob es sich bei der Studienpopulation um Personen mit normalem Selenstatus oder Selenmangel handle. Die folgenden Kernaussagen beziehen sich auf Populationen mit normalem Selenstatus.
Diabetes mellitus
Nachdem epidemiologische Studien bei Diabetikern eine inverse Korrelation zwischen Selen-Spiegel im Blut resp. -Gehalt in Nägeln und Blutzucker sowie zwischen bestimmten Selenoproteinen und Glukosemetabolismus gefunden haben und in vitro-Versuche eine Verbesserung der Insulin-Synthese und -Sekretion in Inselzellen unter Selen gezeigt hatten, wurde die Hypothese aufgestellt, dass Selen zur Prophylaxe und Behandlung von Diabetes Typ 2 einen Stellenwert haben könnte. Randomisierte, plazebokontrollierte Studien (PCT) zeigten indessen bei Probanden ohne Selenmangel keinen oder sogar einen nachteiligen Effekt auf Blutzucker und Lipidprofil (5, 10–12). Offensichtlich ist die Interaktion von Selen mit Diabetes komplex, diskutiert wird eine U-förmige Interaktion, indem sowohl extremer Selenmangel wie -Überfluss sich nachteilig auf den Glukosemetabolismus auswirken können. Von einer Selen-Supplementation von normal ernährten Personen zur Vorbeugung oder Behandlung von Diabetes Typ 2 muss abgeraten werden.
Karzinomprophylaxe
Ähnlich wie beim Diabetes führten epidemiologische Studien mit dem Nachweis eines möglichen Zusammenhanges zwischen Selen und Krebsmortalität sowie entsprechende Tier- und in vitro-Studien zu zahlreichen Untersuchungen, die den Nachweis einer möglichen Rolle von Selensupplementation zur Karzinomprophylaxe zum Ziel hatten. Die grösste Auswertung solcher Studien findet sich in der 3. Überarbeitung eines Cochrane Reviews, in welchem 83 klinische und kontrollierte Studien ausgewertet wurden (13). Dabei zeigte die Selensupplementation keinen Vorteil in Bezug auf die Inzidenz aller Karzinome und insbesondere nicht auf diejenige von Colon, Nicht-Melanom-Hautkrebse, Bronchial-, Mamma-, Blasen- oder Prostata-Karzinom. Auch in dieser Analyse fand sich zwar eine erniedrigte Karzinom-Inzidenz und -Mortalität in der Kategorie mit der höchsten Selen-Exposition verglichen mit der tiefsten, jedoch wiesen viele Studien erhebliche Mängel auf, wie Fehlklassifikationen und v.a. mangelnde Berücksichtigung von Begleitvariablen. Zudem fehlt eine Dosis-Wirkungsrelation, so dass die Autoren zum Schluss kamen, dass Selen-Supplementation keinen günstigen Effekt in Bezug auf Reduktion des Krebsrisikos zeige. In der Selen und Vitamin E Krebspräventionsstudie SELECT mit 35533 Männern fand sich sogar eine nichtsignifikante Erhöhung des Risikos für Prostata-Karzinom um absolut 0.8 unter Selen- und signifikant um 1.6 unter Vitamin-E-Supplementation (14). Bezüglich Nicht-Melanom-Hautkrebs kam es im Nutritional Prevention of Cancer Trial zu einer signifikanten Erhöhung des Risikos unter Supplementation mit 200 µg/d (15).
Schilddrüse
Basierend auf der Hypothese, dass Selen die Immunfunktion verbessere und insbesondere bei Personen mit relativem Selenmangel in der Lage sei, Entzündungsprozesse zu beeinflussen, wurde bei 55 Patienten mit chronischer Autoimmunthyreoiditis und Thyroperoxidase (TPO) Antikörpern in einem RCT der Einfluss von 200 µg / d Selenomethionin gegen Plazebo untersucht (16). Nach 6 Monaten konnte in der Verumgruppe ein hoch signifikanter Abfall von AntiTPO um 20% als Hinweis auf eine günstige Beeinflussung der entzündlichen Aktivität dokumentiert werden. Ebenso war Selen bei Schwangeren mit positiven AntiTPO ab der 12. Gestationswoche in der Dosis von 200 µg/d verabreicht in der Lage, das Risiko für eine Postpartum Thyroiditis von 49 auf 29% und damit auch das Risiko für eine permanente Hypothyreose zu reduzieren (17). Die Fallzahlen dieser Studien sind klein und ein vorbestehender Selenmangel kann bei der Studienpopulation aus Italien nicht ausgeschlossen werden, so dass ein routinemässiger Einsatz von Selen in dieser Situation nicht vorbehaltlos empfohlen werden kann.
Während einzelne Studien einen günstigen Effekt auf die Entwicklung einer endokrinen Orbitopathie vermuten liessen (18), konnte der M. Basedow per se durch Selen-Supplementation in seinem Verlauf nicht beeinflusst werden (19).
Selenmangel
Selenmangel weist eine Korrelation mit der Prävalenz von Erkrankungen wie Atherosklerose, Rheumatoide Arthritis und virale Erkrankungen inkl. HIV auf. Selen spielt eine wesentliche Rolle bei der Initiierung von Immunität und der Regulation von überschiessender Immunreaktion und chronischer Entzündung. Dies kann erklären, warum bei Selenmangel eine Ergänzungsbehandlung Gesundheitszustand und Lebensqualität verbessern kann (20).
Ein klinisch bedeutsamer Selenmangel kann sich nutritiv oder aufgrund von Verlusten ergeben. Personen mit erhöhtem Risiko für einen nutritiven Mangel können reine Vegetarier oder Veganer sein, Personen mit einseitiger Ernährung, z.B. Alkoholiker, extremer Hungerzustand, Anorexia nervosa, Bulimie und solche unter selenfreier oraler oder parenteraler Ernährung (21). Verluste können sich über den Darm einstellen (protrahierte Diarrhoe, Malabsorption, Laxantienabusus), über den Urin (Proteinurie, nephrotisches Syndrom, Diabetes insipidus, Diuretika), unter verlängertem kontinuierlichem Nierenersatzverfahren (22), bei protrahiertem Blutverlust und langer Stillzeit.
Ein Selenmangel wird anhand der Resultate der Messung des totalen Selengehalts mittels Massenspektrometrie (ICP-MS) erfasst, im Serum, um die aktuelle, und im Vollblut, um eher die langfristige Versorgungssituation zu erfassen (Tarif-Code 1665.00, Kosten CHF 105.-, Referenzbereich 0.76 – 1.65 µmol / l, resp. 60 – 130 µg / l) (23). Alternativ kann der Spiegel von Selenoproteinen wie SEPP1 und die Aktivität GPX gemessen werden, wobei v.a. das Letztere rasch auf eine Mangelsituation reagiert. Ein suboptimaler Selenstatus bei Erwachsenen liegt bei einem Selengehalt des Serums von < 0.64 µmol / l resp. < 50 μg / l vor, bei Kindern liegen die Gehalte niedriger. Es ist sinnvoll, einen suboptimalen Selenstatus durch Gabe von Selenpräparaten (Natriumselenit, Selenomethionin, Selenhefe) zu beheben, um den antioxidativen Schutz zu verbessern bzw. wiederherzustellen. Für den peroralen Einsatz ist von der Swissmedic das Präparat selenase® peroral als Monosubstanz mit 166,5 µg Natriumselenit 5 H2O (entsprechend 50 µg Selen) pro ml Lösung in der Abgabekategorie B zugelassen, daneben ist Selen in verschiedensten Kombinationen mit einem Gehalt zwischen 28 und 60 µg in der Abgabekategorie C (Andreavit®, Premavid®) und D erhältlich (Burgerstein Geriatrikum und TopVital, Pharmaton Vital und Ginseng, Supradyn) (24, 25). Weitere Präparate wie z.B. Burgerstein Selenvital werden als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als zugelassene Medikamente vermarktet. Vom deutschen Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) sind Nahrungsergänzungsmittel zum vorbeugenden Gesundheitsschutz bis zu einer Höchstzufuhr von 30 μg Se / Tag zugelassen (21, 26).
Facharzt FMF Innere Medizin und Gastroenterologie
Neuhausstrasse 18
8044 Zürich
Schulthess_hk@swissonline.ch
Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.
1. Selen: Wirkung, Dosierung, Mangel & Nebenwirkungen – VitaminExpress [Stand: 28.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.vitaminexpress.org/de/selen.
2. Selenmangel – Ursache vieler Beschwerden [Stand: 28.05.2018]. Verfügbar unter: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/selenmangel-ia.html.
3. Observations on effect of sodium selenite in prevention of Keshan disease. Chin Med J 1979; 92(7):471–6.
4. Loscalzo J. Keshan Disease, Selenium Deficiency, and the Selenoproteome. New England Journal of Medicine 2014; 370(18):1756–60. doi: 10.1056/NEJMcibr1402199.
5. Rayman MP. Selenium and human health. Lancet 2012; 379(9822):1256–68. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61452-9.
6. Jenny-Burri J, Haldimann M, Dudler V. Estimation of selenium intake in Switzerland in relation to selected food groups. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess 2010; 27(11):1516–31. doi: 10.1080/19440049.2010.506603.
7. Jones GD, Droz B, Greve P, Gottschalk P, Poffet D, McGrath SP et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proc Natl Acad Sci U S A 2017; 114(11):2848–53. doi: 10.1073/pnas.1611576114.
8. Thomson C RM. Selenium. In: Macrae R, Robinson RK, Sadler MJ., Hrsg. Encyclopedia of food science, food technology, and nutrition: Selenium. London: Academic Press; 1993.
9. Burk RF, Hill KE. Selenoprotein P—Expression, functions, and roles in mammals. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects 2009; 1790(11):1441–7. doi: 10.1016/j.bbagen.2009.03.026.
10. Stranges S, Marshall JR, Natarajan R, Donahue RP, Trevisan M, Combs GF et al. Effects of Long-Term Selenium Supplementation on the Incidence of Type 2 Diabetes. Ann Intern Med 2007; 147(4):217. doi: 10.7326/0003-4819-147-4-200708210-00175.
11. Thompson PA, Ashbeck EL, Roe DJ, Fales L, Buckmeier J, Wang F et al. Selenium Supplementation for Prevention of Colorectal Adenomas and Risk of Associated Type 2 Diabetes. J Natl Cancer Inst 2016; 108(12). doi: 10.1093/jnci/djw152.
12. Rayman MP, Stranges S. Epidemiology of selenium and type 2 diabetes: can we make sense of it? Free Radic Biol Med 2013; 65:1557–64. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.04.003.
13. Vinceti M, Filippini T, Del Giovane C, Dennert G, Zwahlen M, Brinkman M et al. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev 2018; 1:CD005195. doi: 10.1002/14651858.CD005195.pub4.
14. Klein EA, Thompson IM, Tangen CM, Crowley JJ, Lucia MS, Goodman PJ et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011; 306(14):1549–56. doi: 10.1001/jama.2011.1437.
15. Duffield-Lillico AJ, Slate EH, Reid ME, Turnbull BW, Wilkins PA, Combs GF, JR et al. Selenium supplementation and secondary prevention of nonmelanoma skin cancer in a randomized trial. J Natl Cancer Inst 2003; 95(19):1477–81.
16. Farias CR de, Cardoso BR, de Oliveira, G. M. B., de Mello Guazzelli, I. C., Catarino RM, Chammas MC et al. A randomized-controlled, double-blind study of the impact of selenium supplementation on thyroid autoimmunity and inflammation with focus on the GPx1 genotypes. Journal of Endocrinological Investigation 2015; 38(10):1065–74. doi: 10.1007/s40618-015-0285-8.
17. Negro R, Greco G, Mangieri T, Pezzarossa A, Dazzi D, Hassan H. The Influence of Selenium Supplementation on Postpartum Thyroid Status in Pregnant Women with Thyroid Peroxidase Autoantibodies. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(4):1263–8. Verfügbar unter: https://academic.oup.com/jcem/article-pdf/92/4/1263/9052154/jcem1263.pdf.
18. Marcocci C, Kahaly GJ, Krassas GE, Bartalena L, Prummel M, Stahl M et al. Selenium and the course of mild Graves‘ orbitopathy. N Engl J Med 2011; 364(20):1920–31. doi: 10.1056/NEJMoa1012985.
19. Kahaly GJ, Riedl M, König J, Diana T, Schomburg L. Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Trial of Selenium in Graves Hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2017; 102(11):4333–41. Verfügbar unter: https://academic.oup.com/jcem/article-pdf/102/11/4333/21533676/jc.2017-01736.pdf.
20. Prabhu KS, Lei XG. Selenium. Adv Nutr 2016; 7(2):415–7. doi: 10.3945/an.115.010785.
21. Bekanntmachung des Umweltbundesamtes¶Selen und Human-BiomonitoringStellungnahme der Kommission «Human-Biomonitoring» des Umweltbundesamtes. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2002; 45(2):190–5. doi: 10.1007/s00103-001-0357-0.
22. Ben-Hamouda N, Charriere M, Voirol P, Berger MM. Massive copper and selenium losses cause life-threatening deficiencies during prolonged continuous renal replacement. Nutrition 2017; 34:71–5. doi: 10.1016/j.nut.2016.09.012.
23. RKI. Selen in der Umweltmedizin. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2006; 49(1):88–101. doi: 10.1007/s00103-005-1185-4.
24. Arzneimittelinformation [Stand: 10.07.2018]. Verfügbar unter: http://www.swissmedicinfo.ch/.
25. compendium.ch [Stand: 10.07.2018]. Verfügbar unter: https://compendium.ch/search/Selen/de.
26. BVL. Nahrungsergänzungsmittels mit Zusatz von Vitamin E und Selen. Zu Nr. 2002-002-00 [Stand: 02.07.2018]. Verfügbar unter: https://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/07_Allgemeinverfuegungen/01_Archiv_Uebersicht/07_Nahrungsergaenzungsmittel/lm_av2002_002_00_basepage.html.